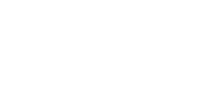Sozialstaatskommission: Wohin weist der Bericht?
Die Empfehlungen der Sozialstaatskommission wecken Hoffnungen auf Vereinfachung und Entlastung. Doch über den Kurs bei Leistungsniveau, Finanzierung und Verteilung wird erst entschieden – und hier liegen die Konflikte noch vor uns, sagt die Volkswirtin Irene Becker. Sie ordnet die Vorschläge der Kommission in die aktuelle sozialpolitische Debatte ein.
Interview: Johanna Ritter
Frau Becker, Sie haben sich intensiv mit dem Bericht der Sozialstaatskommission befasst. Der Bericht hat in Praxis und Politik viel Zustimmung ausgelöst – gleichzeitig erleben wir sehr polarisierte sozialpolitische Debatten. Wie passt das zusammen?
Diese Zustimmung erklärt sich vor allem aus einer Hoffnungshaltung. Viele Akteure verbinden mit dem Bericht die Erwartung, der Sozialstaat könne verschlankt, Verwaltung vereinfacht und Kosten gesenkt werden. Diese Hoffnung eint sehr unterschiedliche Lager: Diejenigen, die seit Jahren einen angeblich ausufernden Sozialstaat kritisieren, genauso wie jene, die völlig zu Recht auf Überbürokratisierung und mangelnde Digitalisierung hinweisen. Der Konsens entsteht also aus der Erwartung, dass hier endlich „etwas passiert“.
Der Bericht lässt aber viele Fragen der Umsetzung offen. Man kann einem Fahrplan leichter zustimmen als konkreten Entscheidungen über Leistungsniveaus, Finanzierungsfragen oder Verteilungswirkungen. Die entscheidenden Stellschrauben sind noch nicht justiert – und hier gibt es das größte Konfliktpotenzial und erhebliche Risiken, was am Ende für Menschen im Niedrigeinkommensbereich herauskommt.
Was ist aus Ihrer Sicht tatsächlich neu an den Vorschlägen der Kommission?
Inhaltlich ist vieles nicht neu, aber es ist gut, dass es endlich angegangen wird. Forderungen nach Digitalisierung, Rechtsvereinfachung oder der Bündelung von Leistungen gibt es seit Jahren aus Wissenschaft, Verbänden und Verwaltung. Auch praktische Erprobungen, etwa bei familienbezogenen Leistungen, existieren längst. Neu ist etwas anderes: Erstmals hat sich ein ressortübergreifendes politisches Gremium, über alle föderalen Ebenen hinweg, auf einen gemeinsamen Reformpfad verständigt. Gerade im Sozialbereich mit seinen zersplitterten Zuständigkeiten ist das bemerkenswert. Dass dies ausgerechnet nach dem Scheitern der Kindergrundsicherung geschieht, macht es umso überraschender.
Als weitreichendste Empfehlung gilt der Vorschlag eines einheitlichen Sozialleistungssystems. Was ist davon zu erwarten?
In der Zusammenlegung von Wohngeld und Kinderzuschlag liegt in der Tat einer der größten Knackpunkte. Die Zusammenlegung bleibt extrem unkonkret. Unklar ist, welches Schutzniveau gelten soll, ob es bei den bisherigen Mietenstufen bleibt, wie zuschussfähige Wohnbedarfe abgegrenzt werden und wie Vermögensprüfungen aussehen.
Die beiden Leistungen sollen künftig in einer „Existenzunterstützung“ zusammenfließen, die an den Bereich der „Existenzsicherung“ (SGB II) anschließen und ebenfalls von den Jobcentern beziehungsweise Sozialämtern verwaltet werden soll. Doch auch dieser Übergang ist nicht klar ausformuliert. Wenn der Übergang wirklich nahtlos und ohne Sprungstellen und Abbruchkanten verlaufen soll, stellt sich die Frage, warum man überhaupt zwei Leistungsarten beibehält. Alternativ könnte man beides in einem System ausbuchstabieren und die Regelungen des Wohngelds und des Kinderzuschlags hinsichtlich des Leistungsniveaus implementieren. Das vorgesehene Nebeneinander von zwei Leistungen erzeugt zwangsläufig Brüche, Grenzfälle und neue Unsicherheiten. Und somit wird es auch wieder Verlierer*innen geben.
Wer könnte von dieser Neuordnung profitieren – und wer verlieren?
Gewinner*innen gäbe es dann, wenn die Nicht-Inanspruchnahme von Leistungen deutlich sinkt. Gerade bei Wohngeld und Kinderzuschlag ist sie sehr hoch. Wenn mehr Menschen einen besseren Zugang zu Leistungen haben, die ihnen zustehen, wäre das sozialpolitisch ein Erfolg – allerdings auch fiskalisch mit Kosten verbunden.
Verlierer*innen drohen, wenn Einkommens- oder Belastungsgrenzen nach unten angepasst werden. Dann können Menschen ihren bisherigen Anspruch verlieren. Der Hinweis im Bericht, es solle keine „systematischen Schlechterstellungen“ geben, schließt individuelle Verluste nicht aus.
Ein weiterer Aspekt ist die Stigmatisierung, etwa dadurch, dass die Vorschläge der Zusammenlegung von Leistungen bedeuten, dass mehr Menschen die Jobcenter als Anlaufstelle nutzen müssten als bisher. Der Gang zum Jobcenter gilt als belastend.
Die Stigmatisierung entsteht weniger durch Institutionen als durch öffentliche Diskurse. Politische Rhetorik, soziale Medien und Narrative von „Trägheit“ oder „sozialer Hängematte“ prägen das Bild. Jobcenter können respektvoll arbeiten, aber die öffentliche Debatte ist entscheidend. Auch das Thema Erwerbsanreize ist hierbei ganz wichtig.
Was meinen Sie damit?
Der dominante Fokus auf sogenannte Erwerbsanreize in der öffentlichen Debatte suggeriert, Leistungsbeziehende seien grundsätzlich frei in ihrer Arbeitszeitwahl und müssten nur motiviert werden. Das blendet strukturelle Zwänge aus: Teilzeitdominanz in bestimmten Branchen, fehlende oder unzulängliche Kinderbetreuung, gesundheitliche Einschränkungen oder konjunkturelle Risiken. Sozialpolitik muss aber genau diese Lebensrealitäten im Blick haben.
Ein wichtiger Punkt sind die Transferentzugsraten, also die allmähliche Abschmelzung von Sozialleistungen bei steigendem Einkommen. Will man dies ernsthaft diskutieren, sollte es weniger um Misstrauen gehen als um Aspekte der Leistungsgerechtigkeit. Wer bei Transferentzugsraten von derzeit 80 bis 90 Prozent oder künftig vielleicht 70 Prozent arbeitet, hat ohnehin einen starken Willen, von Unterstützung möglichst unabhängig zu werden – und das trifft auf diejenigen ohne gesundheitliche Einschränkungen ganz überwiegend zu.
Mehr Leistungsgerechtigkeit würde geringere Transferentzugsraten erfordern. Diese können allerdings nicht beliebig gesenkt werden, ohne erhebliche Kosten auszulösen. Deshalb bleibt es auch bei den Kommissionsvorschlägen bei nur moderaten Änderungen der Transferentzugsraten und somit einer nur geringen Anerkennung von Leistung in Form von Erwerbsarbeit. Der Konflikt zwischen Leistungsgerechtigkeit und fiskalischen Abwägungen wird in der öffentlichen Debatte oft unterschlagen.
Ein wiederkehrendes Argument ist das Einsparpotenzial durch die Vorschläge. Wie realistisch ist das?
Meiner Ansicht nach wird dieses Potenzial deutlich überschätzt – es sei denn, man kürzt oder streicht Leistungen. Der Vorschlag der Kommission, den Sofortzuschlag für Kinder abzuschaffen, wäre genau das: eine systematische Schlechterstellung. Der Zuschlag wurde ja eingeführt, weil die Bedarfsbemessung für Kinder nach SGB II als nicht ausreichend angesehen wurde. Ändert man aber nun nichts an der Berechnungsmethode der Regelbedarfe und streicht den Sofortzuschlag, geht das wieder zu Lasten von Kindern.
Digitalisierung kann zwar langfristig Effizienzgewinne bringen, erfordert aber zunächst erhebliche Investitionen. IT-Fachkräfte, Infrastruktur, Schulungen kosten zunächst einmal Geld. Und wenn die Digitalisierung dahingehend erfolgreich ist, dass durch den erleichterten Zugang mehr Menschen zustehende Leistungen in Anspruch nehmen, kostet das viel Geld. Und schließlich sehe ich Probleme darin, dass Gesetzgebungsverfahren und die Entwicklung von Digitalisierungskonzepten parallel laufen. Es wird sehr schwierig, dies aufeinander abgestimmt zu gestalten.
Was fehlt Ihnen insgesamt in der Debatte?
Die Empfehlung der Kommission, auf europäischer Ebene auf Einschränkungen der Freizügigkeit hinzuwirken, ist hochbrisant und wird kaum diskutiert. Es widerspricht dem Ziel eines solidarischen und zusammenwachsenden Europas, das wir gerade in der aktuellen geopolitischen Lage stärken müssten. Zum anderen ignoriert es die Realität des Arbeitsmarkts: Viele Branchen sind auf Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland angewiesen, häufig auch in Teilzeit – etwa in Gastronomie, Pflege oder haushaltsnahen Dienstleistungen.
Aber auch strukturelle Aspekte fehlen. Der Blick auf Infrastruktur, Kinderbetreuung, Wohnungsbau, Energieeffizienz im Wohnungsbau – all das beeinflusst, wie hoch existenzsichernde Leistungen sein müssen. Wohngeld beziehungsweise „Existenzunterstützung“ ohne sozialen Wohnungsbau ist letztlich eine Subventionierung der Vermieterseite, wodurch hohe und steigende Mieten durchsetzbar sind. Unbeachtet bleibt im Bericht auch, dass das sozialrechtliche Existenzminimum für Kinder weiterhin niedriger als das steuerlich anerkannte Existenzminimum ist.
Werden mit dem Bericht möglicherweise grundlegendere Reformen verpasst?
Der Bericht ist keine grundlegende Reform. Es handelt sich um überfällige Neuregelungen und Anpassungen technischer, rechtlicher und verwaltungspolitischer Art. Neben Infrastruktur, Sozialversicherung und Wohnungsmarkt wurden eine Vielzahl spezifischer Transfers für Teilgruppen und steuerfinanzierte Elemente der Rentenversicherung nicht in den Blick genommen. Das entspricht dem engen Auftrag, birgt aber die Gefahr, dass das Thema Sozialstaatsreform trotz der engen Perspektive des Kommissionsauftrags als „erledigt“ wahrgenommen wird.
Wir befinden uns im Jahr der sozialpolitischen Kommissionen. Was können wir davon erwarten?
Auf den ersten Blick erscheint die Vielzahl der Kommissionen als Zeichen einer sehr anpackenden Regierung. Probleme werden benannt, Expertise wird gesammelt, Prozesse werden angestoßen. Das signalisiert Handlungsfähigkeit. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Kommissionen Erwartungen erzeugen, die politisch nicht eingelöst werden. Bei vielen Themen sind die grundlegenden politischen Richtungen längst vorgezeichnet. Die Kommissionen strukturieren dann eher den Weg dorthin, als dass sie den Kurs offen aushandeln. Das sehen wir bei der Rentenpolitik sehr deutlich.
Hinzu kommt, dass die Kommissionen weitgehend nebeneinanderher arbeiten. Fragen der Existenzsicherung hängen aber eng mit Rente, Wohnen, Infrastruktur oder Pflege zusammen. Wenn diese Zusammenhänge nicht systematisch mitgedacht werden, haben wir am Ende viele Berichte, aber keine sozialpolitische Gesamtstrategie.
Wie kann die Forschung den weiteren Reformprozess begleiten?
Forschung kann versachlichen, differenzieren und gegen Schwarz-Weiß-Malerei argumentieren. Sie kann Vorurteile abbauen und komplexe Zusammenhänge erklären – auch wenn das nie einfach ist. Sie sollte politisch gehört werden, auch wenn dieses Ziel nicht immer erreicht wird. Aber gesellschaftlich ist diese Rolle unverzichtbar.
Irene Becker 2026, Sozialstaatskommission: Wohin weist der Bericht?, in: sozialpolitikblog, 06.02.2026, https://difis.org/blog/sozialstaatskommission-wohin-weist-der-bericht-189 Zurück zur Übersicht

Irene Becker, Dr. rer. pol., ist Dipl.-Volkswirtin und arbeitet als freiberufliche Wissenschaftlerin unter dem Label „Empirische Verteilungsforschung“. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen Analysen der Einkommens- und Vermögensverteilung mit dem Fokus auf Armut und Reichtum sowie Fragen der sozialen Sicherung und des Familienlastenausgleichs.