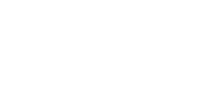"Es geht tatsächlich darum, ein, zwei gute Freunde oder Freundinnen um sich herum zu haben."
Ein Interview mit Yvonne Wilke rund um das Thema Einsamkeit, um die Arbeit des von ihr geleiteten Kompetenzzentrums Einsamkeit, um eine Einsamkeitspolitik und die Rolle von Sozialpolitik und Forschung zur Linderung von Einsamkeit.
Interview: Frank Nullmeier
Frau Wilke, Sie leiten das im August 2021 gegründete Kompetenznetz Einsamkeit. Was ist die Aufgabe des Kompetenznetzes?
Das Kompetenznetz Einsamkeit hat sich gegründet auf Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wie der Name sagt, handelt es sich in erster Linie um ein fluides Netzwerk, das verschiedene Akteur*innen im Bereich Einsamkeit zusammenbringt: Akteur*innen aus dem Bereich der Wissenschaft, der Politik, der Zivilgesellschaft. Wir versuchen durch verschiedene Veranstaltungsformate, Öffentlichkeitsarbeit und verschiedene Transferaktivitäten, aber insbesondere auch durch eigene Praxisforschung, dieses Thema voranzubringen. Das heißt, im Grunde handelt es sich um drei Aufgabenbereiche Forschung, Netzwerk und Transfer. Individuelle Beratung übernehmen wir nicht, das machen die Organisationen, die im Netzwerk mitarbeiten. Vor der Gründung des Kompetenznetzes gab es Aktivitäten vor allem auf Seiten zivilgesellschaftlicher Akteur*innen. Erste Initiativen entstanden schon in den 1990er Jahren, teilweise auch unter anderen Namen. Aber auf Einsamkeit bezogene Aktivitäten hat es in der Zivilgesellschaft insbesondere für ältere Menschen schon seit vielen Jahren gegeben. Im Bereich der Wissenschaft sind es Studien gerade aus der Psychologie gewesen, die hier Anstöße gegeben haben. Aber ein richtiger politischer Fokus ist erst jetzt im Zuge der Corona-Pandemie entstanden.
Und sind ältere Menschen die einzige Gruppe, die das Problem Einsamkeit kennt?
Nein, wir wissen schon seit etlichen Jahren, dass ganz verschiedene Altersgruppen von Einsamkeit betroffen sind. Das Phänomen ist bei älteren Menschen schon vor vielen Jahren entdeckt worden, gerade im Bereich der Pflege ist dieses Thema immer wieder aufgekommen, Pflege von älteren Menschen in Heimen, aber auch Pflege zu Hause, wo sich immer wieder Einsamkeitssituationen gezeigt haben und berichtet wurden von Pflegekräften oder von Angehörigen. Aber wir wissen heute, dass auch Kinder und Jugendliche und im Grunde alle Altersgruppen davon betroffen sind. Allerdings haben Studien vor der Corona-Zeit gezeigt, dass tatsächlich ältere Menschen am stärksten betroffen waren von Einsamkeit, also insbesondere auch Menschen über 75. Während der Corona-Zeit hat sich dieses Bild gewandelt. Nun hat es vor allen Dingen die jüngeren Altersgruppen betroffen und Eltern mit Kindern. Kinder und Jugendliche waren betroffen und auch Paarfamilien, insbesondere mit jüngeren Kindern. Und das hatten wir vorher so noch nicht gesehen.
Gibt es eine grobe Einteilung von Arten der Einsamkeit mit je unterschiedlichen Ausdrucksformen?
Ja, wir folgen in dieser Hinsicht dem Modell von Maike Luhmann, Professorin für Psychologie an der Ruhr Uni Bochum, die dazu für das Netzwerk eine Expertise verfasst hat. Danach lassen sich fünf Formen der Einsamkeit unterschieden. Zum einen die emotionale/intime Einsamkeit, das heißt, dass Menschen eine emotionale Bindung zu anderen Personen fehlt, denen man vertrauen kann. Das kann sich beispielsweise auch auf eine Partnerschaft beziehen. Und das ist auch unabhängig davon, wie viele Personen um einen herum sind, sondern in diesem Fall geht es wirklich um die Qualität der Beziehungen. Die relationale soziale Einsamkeit betrifft auch die Qualität von sozialen Beziehungen, nun aber das Nicht-Vorhandensein einer richtig guten, engen, vertrauten Beziehung zu Freund*innen, auch im Kontext eines Freundeskreises. Die dritte Form der Einsamkeit wird als kollektive Einsamkeit bezeichnet. Hier fehlt den Menschen wirklich der Zugang zu einer größeren Gruppe, es fehlt das Gemeinschaftserlebnis. Stattdessen herrscht das Gefühl, dass man keiner Gruppe zugehörig ist oder nicht so richtig dazugezählt wird. Die physische Einsamkeit beschreibt das Fehlen von körperlicher Nähe. Das geht so ein Stück weit einher auch mit der intimen Einsamkeit, die ich schon genannt habe. Und als fünfte Form hat Prof. Luhmann die kulturelle Einsamkeit genannt, die sich immer dann zeigt, wenn Menschen sich einer Kultur oder zum Beispiel auch eines sprachlichen Umfeldes nicht zugehörig fühlen. Diese Form beruht auf Beobachtungen, insbesondere bei Menschen mit Migrationshintergrund oder auch bei Menschen, die ausgewandert sind, dass in dem Moment, wo die Sprache, dort wo ich lebe, nicht meine Muttersprache ist oder auch dieses kulturelle Umfeld fehlt, es zu Einsamkeitsgefühlen kommt.
Mit wie vielen Menschen man Kontakt hat, ist also gar nicht das entscheidende Kriterium?
Nein. Wenig Kontakt zu haben, kann ein Grund für Einsamkeit sein. Die Studien haben aber gezeigt, dass es in erster Linie um die Qualität der Beziehungen geht und weniger um die Quantität. Wir führen auch qualitative Interviews mit Menschen durch, die von Einsamkeit betroffen sind oder waren. Und insbesondere bei den älteren Menschen geht es ganz gezielt immer um diese Qualität der Beziehungen. Es geht ihnen nicht mehr darum, viele Freundschaften zu schließen. Das ist in dem Alter auch gar nicht mehr möglich. Aber es geht tatsächlich darum, ein, zwei gute Freunde oder Freundinnen um sich herum zu haben. Ähnliches berichten aber auch Kinder und Jugendliche auf diese Frage.
Länder wie Großbritannien und Japan haben ja bereits Einsamkeitsministerien institutionalisiert. Das hat die Aufmerksamkeit auch in Deutschland auf das Phänomen Einsamkeit gesteigert. Ist Einsamkeit momentan ein Modethema? Oder ist die Aufmerksamkeit auf dieses Thema Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels?
Ja, es ist ein Stück weit beides. Die Gefahr ist ja immer bei politisch hochstilisierten Themen, dass sie sich irgendwann auch erschöpfen und dann auch nicht mehr auf der politischen Tagesordnung erscheinen. Der positive Effekt, den wir bei Einsamkeit im Moment beobachten, ist tatsächlich, dass das Thema international so groß aufgehängt ist und Deutschland hier ein Stück weit politisch nachgezogen hat. Wir haben kein Einsamkeitsministerium oder Einsamkeitsbeauftragte, aber es wird nun eine Strategie gegen Einsamkeit entwickelt. Die Geschäftsstelle dazu liegt auch bei uns im Kompetenznetz Einsamkeit. Das befördert natürlich den internationalen Blick auf das Thema Einsamkeit. Wir haben dadurch viele Möglichkeiten, uns auch mit internationalen Akteur*innen auf diesem Gebiet auszutauschen und von den Erfahrungen der anderen zu profitieren. Und vice versa natürlich. Was brauchen denn eigentlich die einzelnen Länder? Wie stellt sich dieses Phänomen der Einsamkeit überhaupt in den einzelnen Ländern dar? Welche Aktivitäten und Strategien, welche zivilgesellschaftlichen Akteur*innen gibt es schon und welche werden gebraucht? Welche Handlungsempfehlungen kann man dort aussprechen? So können wir auch ein Stück weit davon lernen und in Empfehlungen an die Politik weitergeben.
Einsamkeit ist danach definiert als ein soziales Problem, als eine negative Situation. Aber was ist das positive Ziel einer Einsamkeitspolitik? Gibt es einen Begriff für den Zustand, aus der Einsamkeit herausgekommen zu sein? Kann man das analog zu der Vorstellung von Krankheit zurück zur Gesundheit verstehen?
Da haben Sie einen wunden Punkt getroffen. Also seitdem es dieses Kompetenznetz gibt, machen wir uns auch im Team immer wieder Gedanken darüber. Was ist eigentlich die positive Umkehrung von Einsamkeit? Wir sprechen von Einsamkeit als negativ konnotiertes Gefühl. Es gibt ja auch die positiv konnotierte Einsamkeit, dass ich mich zurückziehe. Aber bei uns ist es ja negativ konnotiert und wir haben noch keine Begrifflichkeit für das positive Ziel gefunden. Und ich kann zumindest sagen, das politische Ziel ist definitiv, Handlungsempfehlungen zu entwickeln, um Einsamkeit bei betroffenen Menschen zu lindern und ihr präventiv entgegen zu wirken. Das ist ein Stück weit vergleichbar mit armutspolitischen Entwicklungen oder Handlungsempfehlungen, wo der Sozialstaat nicht den Anspruch hat, Armut komplett abzuschaffen, weil es auch nicht möglich ist. Und eine ähnliche Entwicklung erleben wir beim Thema Einsamkeit. Es geht letztendlich darum, einen Umgang, ich denke auch eine Sensibilisierung für das Thema Einsamkeit zu finden, einen Umgang mit Menschen, die Einsamkeitserfahrungen gemacht haben oder in Einsamkeit leben und letztendlich Handlungsempfehlungen für Politik und auch Zivilgesellschaft und die Betroffenen herauszugeben, um Einsamkeit lindern zu können.
Sie verwenden das Wort ‚lindern‘, das man ja gern auch bei Krankheiten bemüht. Hat Einsamkeit etwas mit Krankheit und damit auch dem medizinischen System zu tun?
Es gibt sehr verschiedene Forschungsansätze zum Thema Einsamkeit. In der Humanmedizin und der Sozialmedizin wird Einsamkeit als Krankheit angesehen. Darunter sind Studien, die kann man kritisch sehen. Ich selbst bin auch an manchen Stellen sehr kritisch. Aber es gibt Studien, die Einsamkeit als Krankheitsfaktor höher einschätzen als zum Beispiel Rauchen oder Alkoholkonsum, weil Einsamkeit so viele gesundheitliche Folgen mit sich bringt. Deshalb wird Einsamkeit als Krankheitsphänomen angesehen. Es gibt aber nicht die Bezeichnung Einsamkeit als Krankheit, was auch daher rührt, dass Einsamkeit als ein subjektives Empfinden bestimmt wird – im Unterschied zum Beispiel zum Konzept der sozialen Isolation, wo wir ja von einem objektiven Verständnis der sozialen Isolierung sprechen. Bei der Einsamkeit dagegen sprechen wir immer von einem subjektiven Empfinden.
Gibt es ein Messkonzept für Einsamkeit?
Wie einsam tatsächlich ein Mensch ist, ist schwer festzustellen, aber das subjektive Empfinden lässt sich erfragen. Das Sozioökonomische Panel hat alle vier Jahre Fragen zur Einsamkeit in seiner Erhebungswelle. Es gibt auch andere Messungsversuche, die sind allerdings recht unterschiedlich entwickelt. Aber uns fehlen insbesondere auch für ganz bestimmte Zielgruppen, insbesondere für vulnerable Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Menschen mit Migrationserfahrung, entsprechende Daten. Die Messwerte, die wir bisher haben, verbleiben relativ an der Oberfläche.
Was kann Sozialpolitik tun, wenn doch recht schwer zu fassen ist, ob und wann Einsamkeit besteht?
Wir haben jetzt gerade angefangen, in Fokusgruppen und über Interviews die empirischen Grundlagen für Empfehlungen zu schaffen. Befragt werden auch Personen, die einsam sind. In unseren Erhebungen, aber auch in denen anderer Forscher*innen taucht die Frage auf, wie viele Sozialkontakte, wie viele Telefonate haben Sie pro Woche. Zudem arbeiten wir sehr partizipativ und haben auch ein Gremium von Menschen mit Einsamkeitserfahrungen ins Leben gerufen, das unsere Forschung begleitet. Zu den Empfehlungen wird auf jeden Fall gehören: mehr Angebot an Aktivitäten und aufsuchende Sozialarbeit im weitesten Sinne. Um tatsächlich Menschen zu erreichen, die, ich sage das jetzt ein bisschen plakativ, die einsam auf ihrer Couch sitzen und tatsächlich das Haus nur noch verlassen, um einkaufen zu gehen und sich dann ganz schnell wieder in ihre Wohnung zurückziehen und dann noch in der Woche vielleicht ein, zwei Telefonkontakte haben. Aufsuchende Sozialarbeit ist hier der Schlüssel, wirklich Angebote zu schaffen für Menschen, die sich in Einsamkeit befinden. Und ein dritter großer Punkt, der sich jetzt herauskristallisiert hat, liegt darin, die Bevölkerung insgesamt zu sensibilisieren für das Thema Einsamkeit und Instrumente oder ein bisschen Rüstzeug an die Hand zu geben. Wie erkenne ich denn, dass meine Nachbarin einsam ist? Und an wen kann ich mich wenden, wenn ich das erkenne? An wen kann ich meine Nachbarin verweisen? Wo gibt es Beratungsangebote? Bisher sind es eher Pflegedienste, die feststellen, dass eine Person einsam ist und dann selber recherchieren oder Kontakte haben zu einer Initiative, die Menschen in Einsamkeit auffängt.
Gibt es multifunktionale Formen von Sozialarbeit, die man auch für die Einsamkeitsthematik einsetzen kann, Altencafés als ein Beispiel?
Die Problematik der aufsuchenden Sozialarbeit liegt immer darin, dass ich erst wissen muss, wo gibt es Menschen, die einsam sind. Sie sind ja zunächst nicht sichtbar. Ich vergleiche das gern mit der verdeckten Armut. Ich sehe auch arme Menschen häufig nicht, weil sie eben nicht aufgrund ihrer Kleidung arm wirken. Es kann ja sein, dass ein Mensch sich in einer großen Gruppe regelmäßig befindet, sich aber trotzdem einsam fühlt. Hier wäre dann, sobald der Mensch sich zurückzieht, die aufsuchende Sozialarbeit genau das richtige Angebot. Aber dafür muss die aufsuchende Sozialarbeit wissen, wo sie klingeln muss. Oder es stellt sich bei ganz anderen Angeboten im Stadtteil heraus, dass der Mensch, der dort teilnimmt, sich einsam fühlt. In den Fokusgruppen mit Fachkräften wird berichtet, dass es durch so einen indirekten Zugang am ehesten gelingt. Einen anderen Weg gehen Silbernetz e.V. oder Wege aus der Einsamkeit e.V., die unmittelbar Angebote zur Einsamkeitsbewältigung bereitstellen. Diese Einrichtungen hatten während der Corona-Zeit natürlich einen sehr hohen Zulauf. Es gibt dort Menschen, die regelmäßig einmal in der Woche anrufen und auch eine Gesprächspartnerin quasi zugeordnet bekommen, die regelmäßig mit ihnen telefoniert. Und für die Personen ist das teilweise der einzige Sozialkontakt, den sie in der Woche haben.
Bemerken Hausärzte die Einsamkeit ihrer Patient*innen?
Ja, zum Teil schon. Ganz interessant ist der Blick nach Großbritannien. Dort gibt es das System des Social Prescribing. Also das heißt, dass mir von einem Hausarzt oder der Hausärztin in dem Fall, dass Einsamkeit diagnostiziert wird, tatsächlich Gesellschaftsaktivitäten verordnet werden – auf Rezept. Wenn Einsamkeit als Krankheitsbild anerkannt ist, lassen sich auch soziale Aktivitäten verordnen im Gespräch mit der betroffenen Person. Es gibt eine Art Leistungskatalog. Um das auf Deutschland zu übertragen, bedürfte es noch erheblicher Anstrengungen.
Muss sich überhaupt Sozialpolitik um dieses Thema kümmern? Kann man nicht sagen: Solange es nur subjektive Empfindungen sind, ist der Sozialstaat gar nicht zuständig? Wo Personen in realer Isolation leben, ist es selbstverständlich ein soziales Problem, aber wenn es sich nur um ein Gefühl handelt?
Spannende Frage. Darüber haben wir an anderen Stellen auch diskutiert. Ich finde, das ist schon eine sozialpolitische Aufgabe. Das lässt sich auch begründen. Wir wissen, dass die demokratische Teilhabe bei Menschen, die sich subjektiv einsam fühlen, sinkt. Im Grunde sprechen wir nicht mehr nur von diesem individuellen, subjektiven Empfinden, was die einzelne Person in sich trägt, sondern wir gehen davon aus, dass dieses Einsamkeitsempfinden gravierende gesellschaftliche Auswirkungen hat, zum Beispiel nicht mehr an Wahlen teilnehmen, was die Demokratie auch in Frage stellen. Zudem nehmen wir an, dass die Folgekosten, wenn viele Menschen sich einsam fühlen und sich zum Beispiel nicht mehr an der Gesellschaft beteiligen oder hohe Krankheitskosten verursachen oder nicht am Arbeitsmarkt partizipieren und längere Zeiten ausfallen, weil sie krank sind, weil Einsamkeit verschiedener Krankheitsbilder nach sich zieht, dass wir dann an sozialpolitischen Kosten zu tragen haben. Die sozialen Sicherungssysteme werden diese Folgekosten dann letztendlich tragen müssen. Aber gesicherte Erkenntnisse dazu gibt es bisher noch nicht.
Tritt das Kompetenznetz als Forschungsförderer auf und welche wissenschaftlichen Disziplinen sind für das Netzwerk am wichtigsten?
Wir selber fördern Forschung nicht. Wir arbeiten sehr eng mit verschiedenen Disziplinen aus der Wissenschaft zusammen und versuchen, an der einen oder anderen Stelle auch ein Projekt gemeinsam auf die Beine zu stellen, also einen Forschungsförderantrag zu stellen. Psychologie ist die Kerndisziplin. Sie forscht zum Thema Einsamkeit schon seit sehr vielen Jahren. Allerdings sehen wir auch die Armutsforschung als wesentliches Feld, auch wenn Psychologie und Medizin dominieren. Und jetzt rückt auch die Soziale Arbeit nach. Es ist nicht so, dass dieses Phänomen auch in der Sozialen Arbeit jetzt von heute auf morgen oder durch Corona erst entstanden ist. Aber es ist häufig einfach unter einer anderen Überschrift mitbearbeitet oder beforscht worden.
Kann die Einsamkeitsforschung so auch als ein Beschäftigungsprogramm für Soziale Arbeit und bestimmte Bereiche der Medizin und der Psychologie wirken? Und würden sie das für einen Vorwurf halten oder darin nur die Konsequenz eines neuen sozialen Problems sehen?
Diese Frage wird uns tatsächlich immer mal wieder gestellt und ich finde sie auch sehr berechtigt. Das Phänomen der Einsamkeit hat ja schon immer bestanden. Es ist kein Phänomen, das die Politik jetzt künstlich erzeugt hat. Die Politik ist im Grunde erst jetzt auf dieses Boot aufgesprungen. Corona hat Einsamkeit so stark in den Vordergrund gerückt, dass viele Disziplinen, die Psychologie, die Medizin, aber auch die Soziale Arbeit, auch die Pflegewissenschaft gesagt haben, ja, das ist ein zentrales Thema für uns. Aber es wurde politisch auch schon vor Corona darauf aufmerksam gemacht. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte 2018 eine Enquêtekommission dazu eingerichtet. Das Problem liegt ja darin, ob nach der Aufmerksamkeitswelle dieses Problem mit finanziellen Mitteln ausgestattet wird, sodass die Soziale Arbeit Aktivitäten auch umsetzen kann.
Yvonne Wilke 2023, "Es geht tatsächlich darum, ein, zwei gute Freunde oder Freundinnen um sich herum zu haben.", in: sozialpolitikblog, 26.01.2023, https://difis.org/blog/es-geht-tatsaechlich-darum-ein-zwei-gute-freunde-oder-freundinnen-um-sich-herum-zu-haben--46 Zurück zur Übersicht

Yvonne Wilke ist Politikwissenschaftlerin und leitet seit 2022 den Bereich Alter, Einsamkeit sowie das Kompetenznetz Einsamkeit (KNE) am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. Seit ihrem Studium in den Niederlanden liegen ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte im Bereich Sozialpolitik, Gender, Armut, (Wohlfahrts)Verbände sowie des partizipativen Forschungsansatzes.