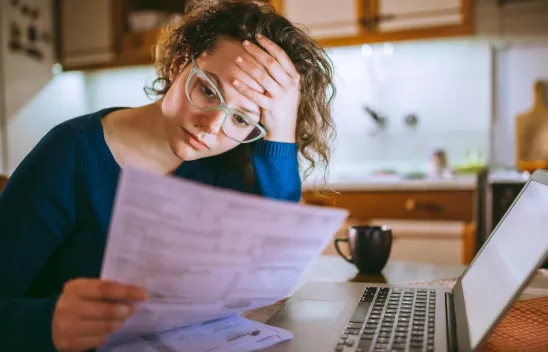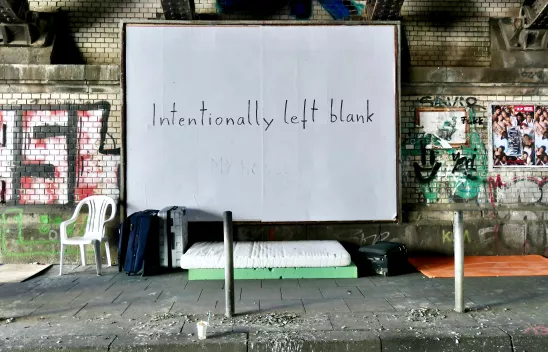Wohnungspolitik der Koalition – Bauen, bauen und sozial?
Wohnen und Wohnungspolitik ist in der letzten Dekade zu einer der zentralen sozialpolitischen Fragen der Gegenwart geworden. Die Bundesregierung hat viele wohnungs- und baupolitische Reformen vor und einen Bau-Turbo angekündigt. Stephan Köppe, Mit-Koordinator des Issue Networks Wohnen und Sozialpolitik (INWuS) des DIFIS, geht der Frage nach, wie die Reformen sozialpolitisch zu bewerten sind.
Steigende Mieten und Hauspreise haben Gentrifizierung in den Städten verstärkt (Helbrecht 2016), selbst mittlere Einkommensschichten leiden unter inadäquatem Wohnraum, unsichere Wohnverhältnisse nehmen zu (Debrunner et al. 2024). Die Anzahl von untergebrachten Wohnungslosen hat sich seit 2022 verdoppelt (BMWSB 2024).
Das erklärte Ziel der Regierung ist „Wohnen wollen wir für alle Menschen bezahlbar, verfügbar und umweltverträglich gestalten“ (CDU et al. 2025: 22) und die neue Regierung und Bauministerin Verena Hubertz arbeiteten schnell an den ersten Gesetzentwürfen. Während der Bau-Turbo zum Bürokratieabbau und zur Beschleunigung von Bauvorhaben schon nach einem Monat vom Bauministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vorgelegt wurde (BMWSB 2025b), lassen konkrete Reformvorschläge und Details zu den stärker sozialpolitisch relevanten Themen wie die Mietpreisbremse oder der Förderung von sozialem Wohnungsbau noch auf sich warten.
Trotz des gemeinsamen Ziels bezahlbaren Wohnraum auszubauen, ist der Koalitionsvertrag ausdrücklich neutral in Bezug auf die geförderten Wohnformen. Sowohl Eigentum als auch genossenschaftlicher und sozialer Wohnraum soll geschaffen werden. Deshalb betrachte ich in diesem Beitrag ausführlicher die einzelnen Reformvorschläge zur Eigentumsförderung, zum genossenschaftlichen Wohnen und zum Mieten sowie die absehbaren sozialpolitischen Umverteilungswirkungen.
Eigentum für die Mittelklasse
Während die vorherige Regierung bereits mit der ‚Jung kauft Alt‘ Initiative eine Kreditförderung für Familien mit Kindern aufgelegt hatte, deutet die geplante ‚Starthilfe Wohneigentum’ auf einen ähnlichen Förderansatz hin (CDU et al. 2025: 23). Die derzeitige Kreditförderung richtet sich vor allem an mittlere Einkommensschichten, denn Haushalte mit über 150 Prozent des Medianeinkommens fallen meinen Berechnungen zufolge aus der Bewilligung (Destatis 2025).
Unklar ist aber weiterhin, inwiefern die Kreditförderung auch für einkommensschwächere Familien – insbesondere in prekären Berufen – relevant ist, weil empirische Wirkungsanalysen der bisherigen Förderungen der Vorgängerregierung fehlen. Es stellt sich vor allem die Frage, ob einkommensschwächere Haushalte Kredite in einer Höhe bewilligt bekommen, um auf dem Wohnungs- und Häusermarkt mitbieten zu können. Aus der internationalen Forschung wissen wir, dass die steuerliche Begünstigung von Hypotheken trotz der Einkommensgrenzen vor allem von Besserverdienenden genutzt wird (Bandoni/Singh 2024). In Irland haben die geförderten Baukredite Hauspreise noch weiter erhöht und somit die Krise verschärft (McQuinn et al. 2021). Außerdem konnte im internationalen Vergleich gezeigt werden, dass einkommensschwächere Haushalte beim Hauskauf zu hohe Risiken eingehen, häufiger in Zahlungsverzug geraten und folglich stärker von Zwangsversteigerungen betroffen sind (Haffner et al. 2017). Diese sozialpolitischen Risiken wurden bisher kaum öffentlich für den deutschen Kontext diskutiert und somit bleibt unklar, welche Konsequenzen eine Ausweitung der Förderprogramme für Eigentum hätte.
Ferner wird bei der staatlichen Kreditförderung der wichtigste Mechanismus zur Zuspitzung von Wohnungleichheiten übersehen (Köppe 2018): Erbschaften oder Schenkungen bleiben bei der Einkommensprüfung schlicht unberücksichtigt, obwohl sie gerade beim Eigentumserwerb eine übergeordnete Rolle spielen. Familien mit mittleren Einkommen und reichen Eltern, erhalten ebenso die staatliche Förderung wie Familien ohne den elterlichen Rückhalt, was die Ungleichheiten zwischen den Generationen weiter verschärfen wird. Die steuerliche Entlastung bei der Übertragung von Immobilienunternehmen wird in diesem Zusammenhang auch in der öffentlichen Debatte und Forschung kaum berücksichtigt.
Wohngeld und andere Wohnformen
Die ‚WG-Garantie‘ oder die Förderung von genossenschaftlichem und sozialem Wohnen aus dem SPD-Wahlprogramm tauchen zwar auch im Koalitionsvertrag auf, jedoch ohne Details wie diese gestaltet werden sollen. Beispielsweise, sollen im Wahlprogramm der SPD Studierende für ein „WG-Zimmer möglichst nicht mehr als 400 Euro zahlen“ (SPD 2025: 21). Im Koalitionsvertrag wird dies zu einer WG-Garantie, ohne zu erklären, wie eine Mietobergrenze in WG-Mieten eingefordert werden soll. Ebenso werden im Nachtragshaushalt für 2025 rund 3,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau veranschlagt, bis 2029 sogar 23,5 Milliarden (BMWSB 2025a), ohne weiter grundlegende Reformvorhaben zu benennen. Ohne weitere Details zu den konkreten Reformenvorschlägen, bleiben die möglichen sozialpolitischen Umverteilungswirkungen vage.
Das Wohngeld ist nicht nur der größte Haushaltsposten im BMWSB (ca. 33 Prozent, Deutscher Bundestag 2025: 48), sondern auch eine im Kern sozialpolitische Transferleistung wie auch andere bedarfsgeprüften Leistungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Wohngeld ist hier eine Vorrangleistung, die vor dem Bürgergeld beantragt werden muss. Wie im Koalitionsvertrag, wird auch im Haushaltsentwurf, nur vage von einer „Vereinfachung der Antragsstellung“ für das Wohngeld gesprochen und eine Abstimmung mit der Sozialstaatskommission angestrebt (Deutscher Bundestag 2025: 49). Grundsätzlich ist eine Vereinfachung von Antragsverfahren für die Betroffenen zu begrüßen, weil dies vor allem die Nichtinanspruchnahme verringert (Wilke 2024). Außerdem müssen in der aktuellen Vorrangregelung die Betroffenen eigenständig abschätzen, ob Wohn- oder Bürgergeld in ihrer finanziellen Lage die beste Option ist. Eine Vereinfachung sollte ebenso beinhalten, dass beide Leistungen verrechnet werden und letztlich nur ein Antrag notwendig ist. Franziska Vollmer hatte Anfang diesen Monats im DIFIS Sozialpolitikblog schon ähnliche Vorschläge zur Vereinfachung und Integration einzelner bedarfsgeprüfter Leistungen plädiert (Vollmer 2025).
Mietpreisbremse
Beim Mieterschutz deutet der Koalitionsvertrag eine stärkere Regulierung von Indexmieten, möblierten Wohnungen und Kurzzeitmieten an, ebenso wie eine verbesserte nationale Mietberichterstattung. Die konkreten Maßnahmen und Verbesserungen stehen noch aus und sollen erst bis Ende 2026 von einer Expertengruppe erarbeitet werden (Drucksache 21/1446).
Hier deuten sich auch die größten Konfliktlinien zwischen den Koalitionsparteien an. Während die SPD für eine stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen und mehr Regulierung in den Koalitionsverhandlungen aussprach, positionierten sich die Unionsparteien strikt gegen weitere Verschärfungen der Mietpreisbremse (FragDenStaat.de 2025). Die geplante Kommission wird der Ministerin und der Regierung etwas Luft verschaffen, es kommt aber stark auf die Zusammensetzung der Kommission an, ob sie von Erfolg gekrönt ist. Am Beispiel der Rentenkommission der Vorgängerregierung konnte man sehr gut sehen, dass die breite Interessenvertretung eher mögliche Kompromisse verhinderte (Köppe 2021).
Lediglich der Umwandlungsschutz wurde schon in das Bau-Turbo Gesetz aufgenommen und um fünf weitere Jahre verlängert. In angespannten Wohnungsmärkten können so Mietwohnungen nicht ohne Weiteres in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Dies schützt zumindest Bestandsmieten, wird aber die Knappheit für junge und mobile Menschen erhöhen, weil der Wohnungsmarkt weniger flexibel ist.
Die Koalition sieht Wohnungspolitik als ein Kernfeld für zukünftige Wahlen, vor allem weil sich der Problemdruck von einigen wenigen urbanen Ballungsgebieten wie München, Berlin oder Hamburg bundesweit bis in den ländlichen Raum ausgebreitet hat. Die hier diskutierten Reformvorhaben bedürfen eingehender Wirkungsanalysen der Verteilungseffekte, insbesondere auch zwischen den Generationen (Köppe/Helbrecht 2026). Das Issue Network Wohnen und Sozialpolitik bietet Forschenden und Praktiker*innen der Sozial- und Wohnungspolitik ein wissenschaftliches Forum, um diese Fragen interdisziplinär zu erforschen und Vorschläge für bezahlbaren Wohnraum zu erarbeiten.
Das Issue Network Wohnen und Sozialpolitik (INWuS) diskutiert zu diesen und weiteren Themen bei der Fachtagung „Wohnen als soziale Frage – Welche antworten bietet der Sozialstaat?“ am 9. und 10. Oktober in Bremen.
Literatur
Bandoni, Emil/Singh, Anuj Pratap (2024): »Who uses the Help to Buy scheme? Stylised facts and trends«, in: Financial Stability Notes, Jg. 2024, H. 6, S.
BMWSB (2024): Gemeinsam für ein Zuhause. Nationaler Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit 2024, Berlin: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen.
BMWSB (2025a): »Deutlich mehr Geld für den Wohnungsbau«, Berlin: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen. https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/09/HH2025.html (letzter Abruf: 05.09.2025).
BMWSB (2025b): Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung. Referentenentwurf 04.06.2025, Berlin: Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.
CDU/CSU/SPD (2025): Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 21. Legislaturperiode, Berlin/München: CDU, CSU und SPD.
Debrunner, G./Hofer, K./Wicki, M./Kauer, F./Kaufmann, D. (2024): »Housing Precarity in Six European and North American Cities: Threatened by the Loss of a Safe, Stable, and Affordable Home«, in: Journal of the American Planning Association, Jg. 90, H. 4, S. 610-626.
Destatis (2025): Einkommen und Einkommensverteilung, Wiesbaden:
Deutscher Bundestag (2025): Bericht des Haushaltsausschusses, Berlin: Deutscher Bundestag, Drucksache 21/1062.
FragDenStaat.de (2025): »AG 4 Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen«: FragDenStaat.de. https://fragdenstaat.de/artikel/exklusiv/2025/03/koalitionsverhandlungen-cducsuspd/ (letzter Abruf: 25.09.2025).
Haffner, M. E. A./Ong, R./Smith, S. J./Wood, G. A. (2017): »The edges of home ownership – the borders of sustainability«, in: International Journal of Housing Policy, Jg. 17, H. 2, S. 169-176.
Helbrecht, I. (Hg.) (2016): Gentrifizierung in Berlin. Verdrängungsprozesse und Bleibestrategien, Bielefeld: transcript Verlag.
Köppe, S. (2018): »Passing it on: Inheritance, Coresidence and the Influence of Parental Support on Homeownership and Housing Pathways«, in: Housing Studies, Jg. 33, H. 2, S. 224-246.
Köppe, S. (2021): The Role of Evidence and Commissions in the Dynamics of German and Swedish Pension Markets. in: Ledoux, Clémence; van Hooren, Franka; Shire, Karen (Hg.), Dynamics of Welfare Markets: Private Pensions and Domestic/Care Services in Europe, Houndsmills: Palgrave, S. 163-188.
Köppe, S./Helbrecht, I. (2026): Wohnen als Feld der Sozialpolitik in Deutschland: Generationenverhältnisse und Wohneigentum. in: Hofäcker, Dirk; Scherger, Simone; Laschinski, Miriam (Hg.), Alter, Kohorten und Generationen in der Sozialpolitik. Zwischen Austausch und Konflikt, Frankfurt: Campus, S. (im Erscheinen).
McQuinn, K./O’Toole, C./Slaymaker, R. (2021): »Credit access, macroprudential rules and policy interventions: Lessons for potential first time buyers«, in: Journal of Policy Modeling, Jg. 43, H. 5, S. 944-963.
SPD (2025): Mehr für Dich. Besser für Deutschland. Regierungsprogramm der SPD für die Bundestagswahl 2025, Berlin: SPD.
Vollmer, F. (2025): »Sozialstaatsreform: Die Grundsicherung konsequent neu denken«, Duisburg/Bremen: sozialpolitikblog. https://difis.org/blog/?blog=177 (letzter Abruf: 11.09.2025).
Wilke, F. (2024): »Der Verzicht auf Grundsicherungsleistungen: Kalkül, Stigma und soziale Einbettung«, in: Sozialer Fortschritt, Jg. 73, H. 5, S. 347–369.
Stephan Köppe 2025, Wohnungspolitik der Koalition – Bauen, bauen und sozial?, in: sozialpolitikblog, 02.10.2025, https://difis.org/blog/wohnungspolitik-der-koalition-bauen-bauen-und-sozial-178 Zurück zur Übersicht

Dr. Stephan Köppe ist Associate Professor für Sozialpolitik am University College Dublin. Nach der Promotion an der Universität Bremen folgten Forschungsprojekte an verschiedenen schottischen Universitäten (u.a. University of Edinburgh, University of Dundee). Im Rahmen des Projekts Transformations in Housing and Intergenerational Contracts in Europe (THICE), leitet er derzeit ein Teilprojekt, dass untersucht wie Wohneigentum in Familien übertragen wird und die Folgen für soziale Ungleichheiten aufzeigt.