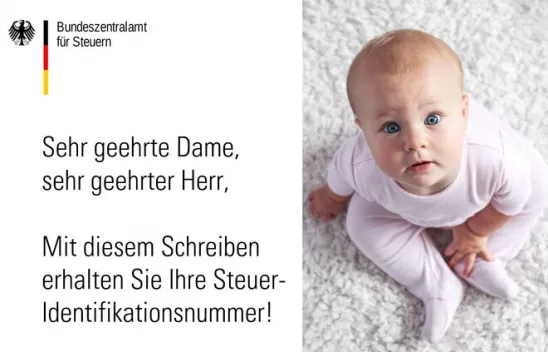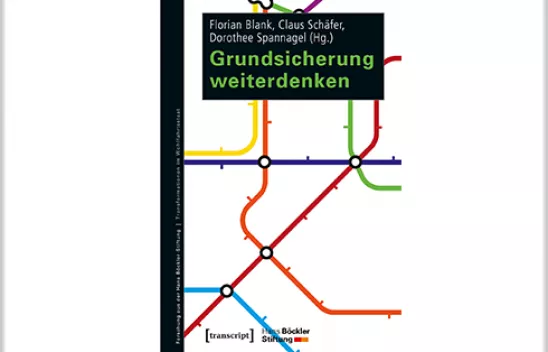Aus Gründen der Fairness: Arbeit muss sich besser lohnen
Im Oktober 2023 hatte BILD getitelt: "Bürgergeld-Schock – Putzkräfte kündigen, um Bürgergeld zu kassieren". Die Union reagierte mit der Ankündigung, das Bürgergeld „abzuschaffen“. Das sogenannte Lohnabstandsgebot war zurück auf der politischen Agenda.
Der von BILD behauptete Effekt lässt sich in der Arbeitsmarktstatistik nicht nachweisen. Dennoch ist es nicht falsch, die Debatte zu führen. Es gibt Reformbedarf. Dieser wird auch im Koalitionsvertag von Union und SPD anerkannt. Die Debatte findet in vermintem Gelände statt. Im Folgenden der Versuch, Eckpunkte für eine produktive Debatte zu skizzieren.
Die Frage nicht abwehren
Jene, die Frage zum Lohnabstand thematisieren, sind immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, sie wollten Beschäftigte im Niedriglohnsektor gegen Arme „ausspielen“ oder hätten ein problematisches Menschenbild. Jedoch steht jedes Grundsicherungssystem vor der Aufgabe, einen ausreichenden Abstand zu wahren. Dabei muss man langzeitarbeitslosen Menschen nicht Arbeitsverweigerung unterstellen. Unabhängig davon, wie stark materielle Anreize bei der Entscheidung zur Arbeitsaufnahme wirken, es stellen sich Fragen der Fairness. Es ist höchst frustrierend für Transferempfänger, die eine Arbeit aufnehmen, wenn sich dies materiell für sie kaum auszahlt.
Kombination von Erwerbseinkommen und Transfers
In einem Grundsicherungssystem mit einkommensabhängigen Leistungen ist es unvermeidlich, diese mit steigendem Erwerbseinkommen abzuschmelzen. Wenn nicht jedes Erwerbseinkommen zur Gänze bei der Berechnung des Hilfeanspruchs angerechnet wird, gibt es einen Einkommensbereich, in dem Erwerbseinkommen und ergänzende Transferleistungen kombiniert werden. Somit gibt es erwerbstätige Bürgergeldempfänger, was immer wieder so interpretiert wird, der Staat subventioniere Löhne, von denen „niemand leben“ könne. Der Zuverdienstmechanismus ist jedoch sozialpolitisch unverzichtbar. Ohne ihn würde sich für Transferempfänger eine Arbeitsaufnahme, rein materiell gesehen, nicht lohnen, solange sie nicht so viel verdienen, dass sie sich gänzlich von der Abhängigkeit von ergänzenden Hilfen befreit haben. Die allermeisten der 735.000 erwerbstätigen Bürgergeldempfänger (Jahresdurchschnitt 2023) haben einen Minijob oder arbeiteten in Teilzeit. Sie sind also nicht aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen auf Hilfe angewiesen (das mag zusätzlich gegeben sein), sondern weil sie ihr Bürgergeld mit geringfügiger Beschäftigung aufstocken oder als Teilzeitbeschäftigte nicht ausreichend in den Arbeitsmarkt integriert sind.
Keine irreführenden Vergleiche
Die Debatte zum Lohnabstand sollte sich auf Vergleichsdaten stützen, die das Leistungsrecht korrekt abbilden. Das ist oft nicht der Fall. Es kursieren Vergleichsrechnungen, bei denen das Kindergeld „vergessen“ wird, das Bürgergeldbeziehern nichts bringt, weil es voll auf den Bedarf angerechnet wird. Ab einer gewissen Einkommensgrenze greift mit Kinderzuschlag und Wohngeld ein zweites Grundsicherungssystem. Berücksichtigt man die sozialen Leistungen in Gänze, so hat jeder, der arbeitet, ein höheres verfügbares Einkommen, als wenn er nicht arbeitete.
Problem der Nichtinanspruchnahme
Damit die Rechnung aufgeht, müssen allerdings die lohnergänzenden Leistungen des Sozialstaats auch ankommen. Die hohe Nichtinanspruchnahme bei Kinderzuschlag oder dem Wohngeld bedeutet in vielen Konstellationen, dass der Abstand des verfügbaren Einkommens von Erwerbstätigen zum Transferbezug ohne Arbeit geringer ist, als er laut Gesetz sein sollte, oder es möglicherweise gar keinen Abstand gibt. Wer also für einen ausreichenden Lohnabstand eintritt, sollte zugleich dafür eintreten, dass die hohe Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen bekämpft wird.
Ein bisschen mehr reicht nicht
Auch wenn Arbeit zu einem Mehreinkommen führt, ist die Debatte damit nicht beendet. Arbeit lohnt sich, aber sie lohnt sich oft zu wenig. Besonders herausfordernd ist es, einen ausreichenden Lohnabstand für Familien mit Kindern zu sichern. Bei Paaren mit zwei Kindern beispielsweise gibt einen großen Einkommensbereich, in dem Kinderzuschlag und Wohngeld kumulierend abgeschmolzen werden. Hier ist der Transferentzug für Familien mit 85 bis fast 100 Prozent sehr, sehr hoch. Ob ein Paar mit zwei Kindern brutto 2.500 oder 5.000 Euro verdient: Beim verfügbaren Einkommen der Familie macht dies nur einen Unterschied von etwa 350 Euro, bei hohen Mieten mit entsprechend höherem Wohngeld auch nur von 250 Euro aus (Blömer et al. 2024, S. 24 f., 61).[1] Die geringe Differenz kann sehr frustrierend sein.
Mindestlohn allenfalls Teillösung
Das Problem kann auch nicht durch eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns gelöst werden. Bei Alleinverdienenden, die nur Teilzeit arbeiten können, oder bei Paaren mit zwei Kindern, die zum Mindestlohn arbeiten, ist der Einkommensgewinn gering. Sie bleiben, wenn es sonst keine Reform gibt, auch bei einem Mindestlohn von 15 Euro, den die SPD der Union in den Koalitionssondierungen abgerungen hat, im Einkommensbereich mit hohen Transferentzugsraten. Das wäre nur zu vermeiden, wenn der Mindestlohn auf völlig utopische Höhen angehoben würde. Eine Mindestlohnerhöhung kann also allenfalls eine Teilantwort sein, selbst wenn man die optimistische Annahme teilt, dass auch in der jetzigen schlechteren Arbeitsmarktlage eine starke Erhöhung des Mindestlohns nicht zu Verwerfungen führt.
Zielkonflikte unvermeidbar
Ein höherer Lohnabstand erfordert eine Senkung der Transferentzugsraten. Dabei gibt es jedoch unvermeidlichen Zielkonflikte. Ein hohes Sicherungsniveau für langzeitarbeitslose Menschen, hohe Arbeitsanreize, die Begrenzung der Zahl der Leistungsberechtigten und fiskalische Interessen lassen sich nicht gleichzeitig erfüllen. Sind die Abschmelzraten hoch, so wird der Kreis der Empfänger begrenzt, zugleich ist dann aber die Aufnahme oder Erweiterung von Erwerbstätigkeit insbesondere für Menschen mit Familienverantwortung wenig attraktiv. Sind die Abschmelzraten dagegen niedrig, entstehen zusätzliche Ansprüche bis weit in die Mitte. Dieses Dilemma wird offensichtlich, sobald ein konkreter Vorschlag durchgerechnet wird.
Moderate Reform fiskalisch beherrschbar
Radikale Senkungen des Transferentzugs sind daher nicht möglich. Die weitere Debatte kann auf den Varianten zur Reform der Abschmelzraten aufsetzen, die vom ifo Institut München und dem ZEW Mannheim simuliert wurden (Peichl et al. 2023). Ein Vorschlag ist, zwischen 520 und 2.000 Euro Bruttoeinkommen mit 70 Prozent abzuschmelzen, und dann mit 65 Prozent, bis der letzte Euro der Hilfe entfallen ist (Variante p). Das wäre gegenüber dem Status quo eine deutliche Verbesserung, auch wenn die Höhe des Transferentzugs substanziell bleibt. Etwa 2,5 Mrd. Euro wären für zusätzliche Hilfen aufzuwenden, die Reform wäre also fiskalisch beherrschbar. Sie wäre weniger teuer als eine Reihe von Wahlversprechen, die es wohl in den Koalitionsvertrag schaffen werden.
Aktive Arbeitsmarktpolitik weiterhin unverzichtbar
Die mit der Reform verbundenen höheren Arbeitsanreize haben einen moderaten positiven Beschäftigungseffekt im Umfang von 100.000 Vollzeitstellen. Das zeigt, ein deutlicher Abbau der Arbeitslosigkeit gelingt nicht allein durch stärkere Erwerbsanreize. Aktive Arbeitsmarktpolitik durch die Jobcenter, die langzeitarbeitslose Menschen durch Beratung und öffentlich geförderte Beschäftigung unterstützten können, bleibt dringend notwendig.
Kommunikative Risiken
Eine Reform der Transferentzugsraten birgt für die neue Bundesregierung hohe kommunikative Risiken. Denn die Simulation von ifo Institut und ZEW zeigt, dass, folgt man dem referierten Reformvorschlag, zusätzlich etwa 850.000 Haushalte Hilfe erhalten werden, die heute weder Bürgergeld, Kinderzuschlag noch Wohngeld erhalten. Dies kann skandalisiert werden, da in der deutschen Sozialdebatte häufig Hilfebezug mit Armut oder Prekarität gleichgesetzt wird.
Zusammenhang zwischen Transferhöhe und Abschmelzrate
Die Debatte sollte nicht den Zusammenhang aus den Augen verlieren, der zwischen der Höhe des Bürgergelds und den Regelungen besteht, mit denen die Hilfen bei steigendem Erwerbseinkommen abgeschmolzen werden. Je höher das Bürgergeld, desto beschränkter werden angesichts knapper Haushaltsmittel die Möglichkeiten ausfallen, beim Abschmelzen der Hilfen großzügiger zu sein.
Der Sozialstaat muss den Lohnabstand sichern
Auch künftig muss das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums gewahrt werden. Das schließt Sanktionen, wenn die Aufnahme einer Arbeit dauerhaft verweigert wird, nicht aus. Der Lohnabstand kann aber nicht durch eine drastische Absenkung des Bürgergelds hergestellt werden. Das Problem ist auch nicht allein durch Mindestlohnpolitik zu lösen. Es braucht also weiterhin ergänzende Einkommenshilfen für Beschäftigte im Niedriglohnsektor, die für eine Familie sorgen. In einem Sozialstaat, der die Würde von langzeitarbeitslosen Menschen wahrt, kann der Lohnabstand nur durch den Sozialstaat gesichert werden.
------------
[1] Blömer et al. kalkulieren unter der Annahme der Umsetzung des Gesetzentwurfes zur Kindergrundsicherung, der aber für den einkommensabhängigen Zusatzbetrag Werte vorsah, die denen des weiterhin gültigen Kinderzuschlags sehr ähnlich sind.
Literatur
Blömer, M./Hansen, E./Peichl, A. (2024): Die Ausgestaltung des Transferentzugs mit dem Bürgergeld, der Kindergrundsicherung und dem Wohngeld. ifo Forschungsberichte 145/2024.
Peichl, A./Bonin, H./Stichnoth, H. et al. (2023): Zur Reform der Transferentzugsraten und Verbesserung der Erwerbsanreize - Kurzversion. BMAS-Forschungsbericht 629 K.
Georg Cremer 2025, Aus Gründen der Fairness: Arbeit muss sich besser lohnen, in: sozialpolitikblog, 10.04.2025, https://difis.org/blog/aus-gruenden-der-fairness-arbeit-muss-sich-besser-lohnen-162 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Georg Cremer war von 2000 bis 2017 Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes. Davor war er in der Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe tätig. Cremer ist habilitierter Volkswirt und lehrt als apl. Professor an der Universität Freiburg. Von 1998 bis 2015 war er Lehrbeauftragter zu Fragen der Korruptionskontrolle in der Entwicklungszusammenarbeit an der ETH Zürich.