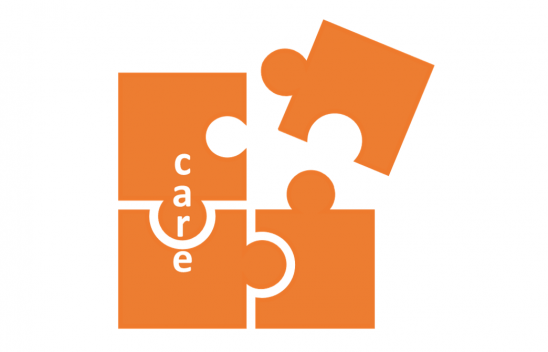Gesundheit ohne Gewinne
Warum müssen Kliniken und Pflegeheime profitabel sein? Wer die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern will, muss umdenken. Dazu braucht es eine radikale Reform: Ein Pflegesystem ohne Profit.
Als Kind habe ich eine Pflegefachkraft gefragt, was ihr Beruf für sie bedeute. "Mit dem Herzen zu sehen", sagte sie. Diese Frau war meine Mutter. Bis heute arbeitet sie in einem Seniorenheim, seit März 2020 mit Maske, Schutzanzug und Handschuhen. Ich bin Journalist. In der Pandemie habe ich mit unzähligen Pflegefachkräften, aber auch Ärztinnen und Ärzten, Klinikleitungen und Heimbetreibern gesprochen. Mit Angestellten, die den Tränen nahe sind, wenn ihre Schicht endet. Mit Intensivpflegern, die erklären, dass sie täglich das Patientenwohl gefährden müssen. Mit Altenpflegerinnen, denen keine Zeit mehr bleibt, um ihren Patienten zuzuhören.
1,7 Millionen Menschen arbeiten sozialversicherungspflichtig in Deutschland in der Pflege, davon mehr als eine Million in der Krankenpflege. Das klingt nach viel, doch weniger als die Hälfte davon arbeitet in Vollzeit. In der Bundesrepublik fehlen laut dem Deutschen Pflegeverband heute schon 200.00 Pflegefachpersonen Krankenhäusern, Seniorenheimen und ambulanten Diensten. Die Bertelsmann Stiftung spricht von 500.000 fehlenden Fachkräften bis zum Jahr 2030. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen seit Jahren stark zu, 2017 waren noch 3,41 Millionen Menschen auf Pflege angewiesen, heute sind es 4,13 Millionen. Diese Zahl wird unaufhaltsam weiter steigen, weil wir in einem Land leben, dessen Bevölkerung immer älter wird und in dem damit immer mehr Pflegefälle zu betreuen sind. Jeder fünfte Deutsche ist bereits im Rentenalter, in nur wenigen Jahren wird sich diese Zahl vervielfachen.
Gesundheit als Teil der Daseinsvorsorge
Um das zu bewältigen, braucht es ein Gesundheitswesen, dass nicht an Gewinnen orientiert ist. Doch Gesundheit in Deutschland ist ein Geschäft. Medizin ist eine Ware, der Mensch ist zu einem verwertbaren Objekt geworden. Egal, ob es sich um eine Operation in der Klinik handelt oder um jahrelange Pflege im Seniorenheim: Oft geht es nicht darum, wie man Patientinnen und Patienten am besten pflegt, sondern darum, wie mit dieser Dienstleistung der größte Profit gemacht werden kann. Dieser Gedanke muss aus dem Gesundheitssystem verschwinden und durch einen anderen ersetzt werden: Weshalb müssen Schulen, Kindergärten, die Polizei und Feuerwehr keine Gewinne erzielen, Kliniken und Pflegeheime aber schon? Wir benötigen eine Politik, die Gesundheit als Teil der Daseinsvorsorge definiert und vor Profitstreben schützt.
Erstens muss ein System der Daseinsvorsorge eingeführt werden, das nicht weiter privatisiert werden darf. Viele Krankenhäuser haben Schulden, viele Pflegeheime müssen zulasten der Angestellten und der Bewohnerinnen und Bewohner sparen. Das liegt nicht an schlechtem Management, sondern an politischen Vorgaben und ihren Auswirkungen: an der Marktöffnung für private Anbieter in der Altenpflege und dem Profitgedanken an Krankenhäusern. Beides wurde politisch erschaffen und hat tagtäglich Folgen für die Versorgung in Deutschland. In den vergangenen 20 Jahren mussten rund 1.000 Kliniken schließen, vorwiegend städtische, kommunale und gemeinnützige. Meist nicht, weil eine oft behauptete Überversorgung herrscht oder die Krankenhäuser schlecht wirtschafteten, sondern weil private Betreiber ihnen Konkurrenz machten. Hinzu kommt, dass die Bundesländer und Kommunen immer noch eigene Kliniken an börsennotierte Unternehmen verkaufen und damit ihre Staatshaushalte sanieren. Es braucht deshalb einen Rettungsschirm für alle sterbenden Kliniken und einen Beschluss in möglichst vielen Bundesländern und auf Bundesebene, der im Sinne der Erhaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge erschwert und bestenfalls verbietet, dass Kliniken verkauft werden.
Zweitens muss rückgängig gemacht werden, was mit dazu beigetragen hat, dass sich das Gesundheitssystem in Deutschland am Profit orientiert. Um ein System der Solidargemeinschaft zu ermöglichen, ist die zeitnahe Abschaffung der Fallpauschalen notwendig, damit Behandlungen wieder nach dem tatsächlichen Bedarf und nicht nach pauschal festgelegten Summen von den Kassen vergütet werden. Egal ob privater Träger oder städtisches Krankenhaus: Die Fallpauschale setzt unzählige Fehlanreize. Sie verschlechtert die Patientenversorgung und stellt einen Wettbewerb um wirtschaftliche Effizienz her, den es in einem solidarischen Gesundheitswesen nicht geben sollte.
Patientinnen sollen die Behandlung erhalten, die sie wirklich brauchen, und nicht diejenige, die gut in den Krankenhausplan passt und die noch dringend gemacht werden muss, um Effizienzziele zu erreichen. Patienten sollen dann entlassen werden, wenn es medizinisch sinnvoll ist, und nicht dann, wenn es sich für die Klinik finanziell rechnet. Pflegende, Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeutinnen und Hilfskräfte sollten nach dem tatsächlichen Bedarf eingestellt werden, den es auf den Stationen gibt, nach verbindlichen Personalschlüsseln und nicht nach finanzieller Lage der Häuser. Das sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip muss wieder eingeführt werden, sodass die bei Behandlungen und Operationen tatsächlich anfallenden Ausgaben von den Krankenkassen erstattet werden und nicht ein fiktiver Pauschalbetrag. Das würde auch die Qualität der Pflege verbessern, wie eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Die Fallpauschalen mindern nach der Studie langfristig die Qualität der Versorgung, weil sich Kostendruck und eine Unterbesetzung der Pflege auf sie auswirken. Es braucht also ein System, in dem das Personal kein reiner Kostenfaktor ist. Und wir benötigen eine Pflegefinanzierung, die genau das berücksichtigt und Seniorenheime nach ihrem tatsächlichen Bedarf ausstattet.
Solidarisches Gesundheitswesen
Mit solchen Reformen würde man Fehlentwicklungen korrigieren, die Verschlechterung der Verhältnisse verlangsamen, vielleicht sogar aufhalten und einen neuen Wettbewerbsgedanken etablieren. Allein dieser würde das Verhältnis zwischen privaten und staatlichen Betreibern verändern, und zwar zugunsten des solidarischen Gesundheitswesens. Man muss allerdings mehr tun, als getroffene Fehlentscheidungen rückgängig zu machen. Der Gesundheitsmarkt hat sich längst etabliert, da reicht es nicht aus, nur ein paar Regeln anzupassen. Der Politik wird kein anderer Weg übrigbleiben, als grundlegend in den Markt einzugreifen. Es kann dabei nicht darum gehen, von heute auf morgen alle Kliniken und Pflegeheime zu rekommunalisieren oder zu verstaatlichen.
Aber es gäbe einen Weg, der Gewinnmaximierung entgegenzuwirken. Es braucht, drittens einen bundesweiten, verbindlichen Profitdeckel für die Pflege, ein Ende des Gewinnstrebens mit unserer Gesundheit. Die Politik könnte ein Instrument schaffen, das Profite begrenzt und private Betreiber dazu zwingt, Gewinne zu investieren – und zwar in die bessere Bezahlung der Angestellten oder in angemessenere Arbeitsbedingungen. Wer darüber hinaus mehr als die festgelegte Rendite macht, könnte mit einer Strafsteuer belangt werden. Einer Steuer, deren Einnahmen wiederum in bessere Arbeitsbedingungen investiert würden. Langfristig würde der Profitgedanke verschwinden, städtische und kommunale sowie gemeinnützige Betreiber würden profitieren und könnten bestehen. Die Politik könnte handeln, ohne alle Betriebe verstaatlichen und rekommunalisieren zu müssen. Auf diesem Weg würde sie Profite zulasten von Patientinnen und Patienten sowie Pflegefachkräften unmöglich machen und ein solidarisches System erschaffen – finanziert durch eine Bürgerversicherung, in die alle einbezahlen.
David Gutensohn 2022, Gesundheit ohne Gewinne, in: sozialpolitikblog, 29.09.2022, https://difis.org/blog/?blog=26 Zurück zur Übersicht

David Gutensohn ist Journalist und hat das Buch „Pflege in der Krise – Applaus ist nicht genug“ im Atrium Verlag veröffentlicht. Für ZEIT ONLINE berichtet er über die Themen Arbeit und Sozialpolitik und wurde 2021 unter die Top 30 jungen Journalisten des Jahres gewählt.