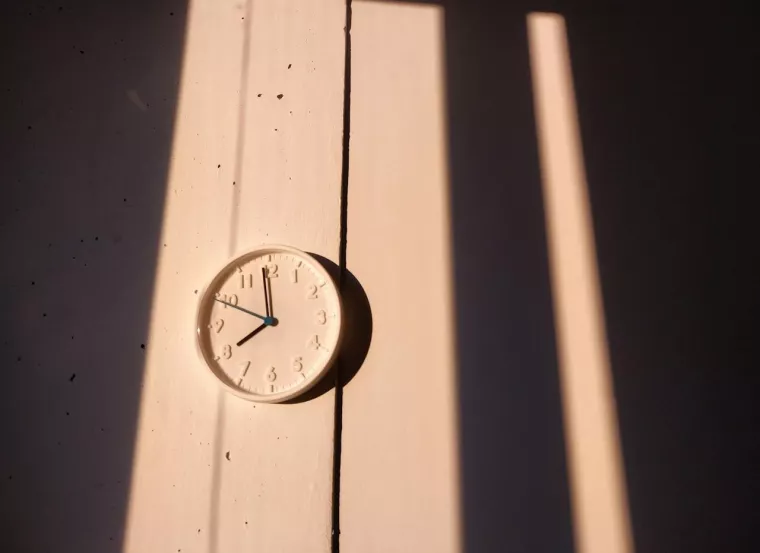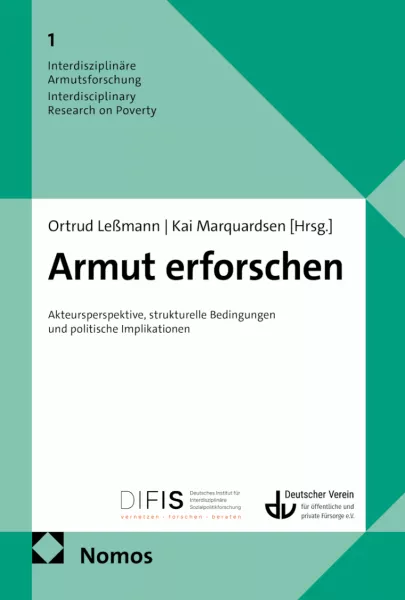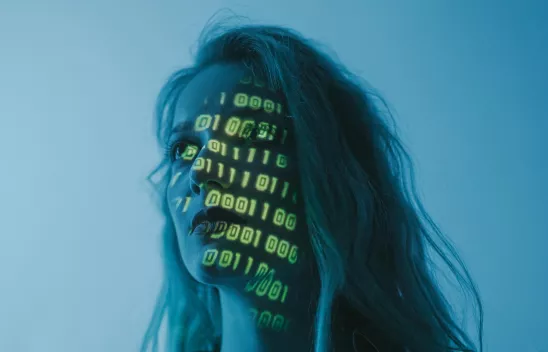Digitalisierung und Kommunalisierung in der Pflegeversorgung
In der Pflegeversorgung gibt es zahlreiche Herausforderungen. Während die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, wächst die Zahl der Pflegekräfte und familiär Pflegender nicht an. Welche Potentiale neue Technologien in Kombination mit kommunaler Versorgung bieten können, erkunden die Autoren dieses Beitrags.
Im demographischen und sozialen Wandel kommt pflegerischen Versorgungserfordernissen eine wachsende Bedeutung zu. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen dürfte durch die zunehmende Alterung bis zum Jahr 2055 um 1,8 Millionen oder 37 Prozent zunehmen. Zugleich steigt auch die Zahl der Kinderlosen je Kohorte, ebenso die Zahl der Erwerbstätigen in einer Kohorte. In der Folge wird in Zukunft für einen steigenden Anteil der wachsenden Gruppe der Hochbetagten kein gleichermaßen wachsendes familiales Netzwerk für die häusliche Pflege zur Verfügung stehen. Dem wachsenden Versorgungsbedarf steht bereits jetzt ein nur noch begrenztes Angebot an professioneller Unterstützung gegenüber. Nach der jüngsten Pflegekräftevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes werden bis zum Jahr 2049 voraussichtlich mindestens 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Auch wenn sich die Zahl der Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten in den letzten beiden Jahrzehnten bereits mehr als verdoppelt hat, bestehen offenbar schon derzeit beträchtliche Schwierigkeiten, mit Neuzugängen dem steigenden Bedarf an Kräften sowohl in der ambulanten wie stationären Pflege gerecht zu werden. Laut Bundesagentur für Arbeit weisen alle Indikatoren ihrer Engpassanalyse auf deutliche bestehende Arbeitskräfteengpässe hin.
Nicht erst seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 15. November 2023, das Ausnahmen von der Schuldenbremse enge Grenzen setzt, stellt sich zudem die Frage nach der Finanzierbarkeit zahlreicher staatlicher Leistungen. Insbesondere die demografische Entwicklung stellt die öffentlichen Spielräume für die Mitfinanzierung von Pflegleistungen vor erhebliche Herausforderungen. Verschärft wird die Lage noch dadurch, dass in der Altenhilfe- und Pflegelandschaft generell starke Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Einen Überblick liefert die ständige Berichterstattung des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) zur Sozialen Pflegversicherung. Danach sind etwa die Kosten für Unterkunft und Verpflegung vom 1.1.2023 zum 1.1.2024 im Bundesdurchschnitt von 857 auf 921 € und die für Investitionen von 472 auf 485 € je Pflegbedürftigem und Monat gestiegen. Auch Löhne und Gehälter in der Pflege steigen. Das führt auch zu mehr Druck auf die Pflegeanbieter. Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) warnt vor über 800 Angebotseinschränkungen, Insolvenzen und Schließungen in der Altenpflege. Schon heute kann die stationäre Altenhilfe nur noch durch erhebliche private Zuzahlungen der Pflegebetroffenen (und ihrer Familien) sowie – wenn diese das nicht leisten können – der Sozialhilfe aufrechterhalten werden. Trotz deutlich gestiegener Alterseinkünfte wird daher auch künftig der Anteil der Sozialhilfeempfänger*innen in den Einrichtungen weiter ansteigen (Rothgang et al. 2023).
Vor diesem krisenhaften Hintergrund bei der aktuellen Lage und den zukünftigen Perspektiven der Altenhilfe und -pflege sind dringend innovative Konzepte der Krisenbewältigung gefordert. Allerdings ist eine allein auf die Lösung der Finanzierungsengpässe fokussierte Diskussion zu eng. Es muss auch um mehr Qualität und Effizienz als eine gemeinsame und integrierte Gestaltungsaufgabe aller Beteiligten in einer veränderten Pflegeversorgungslandschaft gehen. Wenn die bestehenden und künftigen pflegerischen Dienstleistungen besser und zugleich effizienter und kostengünstiger erbracht werden sollen, wird dies auch eine gemeinschaftliche Leistung neuer Akteurskonstellationen erfordern. Gerade in der Pflege muss es daher auch um soziale Innovationen in zwei Richtungen gehen: Zum einen um die vermehrte Nutzung digitaler Werkzeuge in der pflegerischen Leistungserstellung, zum anderen um eine bessere und patientenorientierte Vernetzung aller zur Verfügung stehenden Ressourcen vor allem auf der örtlichen Ebene.
Bessere Versorgung durch neue Techniken
Auch in der Pflege machen neuere Digitalisierungsansätze Hoffnung auf Qualitäts- und Effizienzverbesserungen. Der Horizont potenzieller Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich exemplarisch wie folgt beschreiben:
- Digitale Plattformen verschaffen mehr Transparenz über vorhandene Pflegeangebote.
- Dadurch wird auch der Zugang zu haushaltsnahen Versorgungsangeboten erleichtert.
- Pflegeplanung und -dokumentation werden elektronisch erledigt und dadurch erheblich erleichtert, systematischer und weniger fehleranfällig.
- Elektronische Patientenakten erhöhen Qualität und Wirtschaftlichkeit und reduzieren bei pflegenahen Überleitungsprozessen die Schnittstellenproblematik nachhaltig.
- Pflegehilfsmittel können durch digitale ‚Aufrüstung´ ein neues Leistungsniveau erreichen.
- Telemedizinische Dienstleistungen (z. B. Videosprechstunden) fördern nicht nur die Kommunikation mit anderen professionellen Gesundheitsanbietern, sondern ermöglichen auch ein ständiges Monitoring von Vitalparametern.
- E-Learning, Adaptives und Virtual Learning eröffnen neue Wege zur Ausbildung und berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung für Pflegekräfte.
- Jenseits der Regelversorgungsbedarfe fördern digitale Techniken auch die gesundheitsbezogene Selbsthilfe sowie die Organisation von Gemeinschaftsaktivitäten.
Die fachlich angemessene und produktive Nutzung digitaler Werkzeuge in der Pflege ist bereits vielfältig dargelegt und analysiert worden (jüngst in Krick et al. 2023). Studien untersuchen, inwieweit sich für die (Versorgungs-)Qualität und Wirtschaftlichkeit Chancen ergeben. Auch ergeben sich Perspektiven für eine höhere Attraktivität der Arbeitsplätze, zum Beispiel durch einen Abbau von Überlastungen, die Entlastung von pflegefremden Tätigkeiten und eine höhere Arbeitszufriedenheit durch mehr Freiräume für die „eigentliche Pflege“ (Hilbert & Naegele 2023; Kowalski et al. 2023). Allerdings befinden sich viele digitale, vor allem robotergestützte Lösungen noch in der Pilotierung, zudem gibt es noch viel Bedarf für Verbesserungen (Immig et al. 2023). Nachhaltig motivierend für die Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten ist es deshalb, wenn sich deren Vorteile an konkreten Beispielen verdeutlichen lassen. Zwei davon seien hier exemplarisch benannt:
- Die ärztliche Versorgung von Patient*innen in Altenheimen oder auch von zuhause lebenden Pflegepatient*innen wird gegenwärtig sehr oft dadurch gelöst, dass diese in ambulante Arztpraxen oder zu Notfallambulanzen in Krankenhäusern transportiert werden. Für die Betroffenen ist dies zumeist mit großen Belastungen, für das Personal sowie für Nahestehende mit großem Aufwand und für die Kostenträger mit hohen Transportkosten verbunden. Eine Alternative dazu ist, dass Arztvisiten per Videokonferenz angeboten werden. Keineswegs alle, aber viele medizinische Fragen lassen sich so klären, ohne dass der Weg in die Arztpraxis oder das Krankenhaus nötig werden. In der Bünder Ärztenetz-Genossenschaft MuM ist dieses Vorgehen bereits Mitte der Nuller-Jahre entwickelt und erprobt worden und findet seit der Pandemie (mittlerweile angeboten von einem großen, internationalen Anbieter von E-Health Lösungen) langsam seinen Weg in die Breite.
- Bereits in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde das Konzept des „virtuellen Altenheims“ (Bandemer et al. 1994) entwickelt. Hier werden zu Hause lebende ältere Menschen mithilfe digitaler Techniken (v.a. Videokonferenzen und Monitoring von Vitalparametern) miteinander (Selbsthilfegruppen oder „virtueller Kaffeeklatsch“) und mit Serviceeinrichtungen (von Kommunikationsangeboten, etwa Gottesdiensten, über haushaltsnahe Dienste bis hin zu Pflegetipps) verbunden. Obwohl dieses Konzept halbwegs erfolgreich pilotiert (Scharfenorth, 2004) sowie mehrfach kopiert und weiterentwickelt wurde, konnte es bis heute nur als Nischenangebot in wenigen Regionen und nicht als flächendeckendes Angebot etabliert werden. Eine wissenschaftlich fundierte Analyse des Unterbleibens einer offensiven und breitflächigen Nutzung liegt allerdings bislang nicht vor. Eine Erklärung dafür könnten fehlender Wille und /oder fehlende Kraft zentraler Akteur*innen in der Branche sein, für innovative, komplexe und trägerübergreifender Angebote erforderliche Kooperationsbündnisse einzugehen (Hilbert & Naegele 2023).
Bessere Versorgung durch lokale Pflegebündnisse
„Alle Menschen in Deutschland sollen gut versorgt und gepflegt werden – in der Stadt und auf dem Land. Wir wollen einen Aufbruch in eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik“ – so heißt es im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Gemeinsam ist allen pflegerelevanten Bedarfslagen, dass sie weit überwiegend haushaltsbezogen („dritter Gesundheitsstandort“ Haushalt) und somit lokal verortet sind. Pflege ist immer auch Teil einer kommunalen Daseinsvorsorge. Hier setzt die Idee digital unterstützter lokaler Allianzen für Pflege an. Dabei geht es um lokale Bündnisse von unterschiedlichen, häufig bislang auch pflegefremden Akteuren, so zum Beispiel von etablierten Pflege- und Gesundheitsanbietern (wie Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser), örtlichen Digitalisierungsanbietern, Betrieben der Wohnungs- und Bauwirtschaft, Unternehmen mit pflegenden Mitarbeitern oder zivilbürgerschaftlichen Akteuren. Sie können zudem mit Instrumenten kommunaler Familienpolitik verknüpft werden. Damit folgen sie dem Konzept der lokalen Verantwortungsallianzen, die aus der Idee der sozialen Innovationen hervorgegangen sind. Ebenso wie bei den „sorgenden Gemeinschaften“ muss allerdings, folgt man Artikel 28 II des Grundgesetzes, die Hauptverantwortung für ihre Gründung und nachhaltige Unterstützung bei den Kommunen liegen.
Die Bereitschaft zur Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege kann durch intelligente digitale Instrumente und Tools unterstützt werden, um eine über die eigentliche Pflegetätigkeit hinausgehende kommunale Daseinsvorsorge für pflegende Familien abzusichern. Auch für das Pflegepersonal sind „alltagstaugliche Assistenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben“ (AAL) bedeutsam, weil sie seinen Arbeitsalltag erleichtern können. Lokale Allianzen für Pflege entsprechen zudem dem Trend sich ändernder Strukturen des Marktes für Dienstleistungen. Digitale Start-Ups entwickeln inzwischen Hilfestellungen, wie selbstständige Anbieter von Pflegedienstleistungen und Pflegenachfragende zusammengebracht werden können. Derartige Überlegungen werden auch in anderen Ländern angestellt: Japans Modell einer „society 5.0“ zielt explizit auf die Lösung des auch dort stark wachsenden häuslichen Pflegebedarfs durch mehr Digitalisierung. Das Konzept einer lokal organisierten „integrated community care“ erprobt dabei die digitale Vernetzung aller Anbieter einschließlich der ehrenamtlichen Helfer*innen wie auch der Nachfrage nach gesundheitlich-pflegerischen Versorgungsleistungen zwischen den Versorgungsbereichen Gesundheit, Wohnen und Pflege. Diesem Konzept kommt dabei zugute, dass in Japan die Kommunen die Träger der Pflegeversicherung und somit die zentralen Akteure vor Ort sind (Waldenberger et al., 2022).
Blick nach vorne
Die Pflegeversorgung in Deutschland ist von drei Seiten her unter Druck: steigende Bedarfe, fehlende Fachkräfte und Finanzierungsengpässe. Das am 1.7.2023 in Kraft getretene Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) stößt zwar auf viel Kritik, enthält aber auch Elemente zur Förderung innovativer Lösungswege, indem es die Nutzungsspielräume für digitale Lösungen erweitert. Dazu zählt auch die Digitalisierung des pflegebezogenen Quartiersmanagements auf kommunaler Ebene. Allerdings verlaufen sowohl die Prozesse zur Aufnahme digital gestützter Pflegehilfsmittel in den Katalog refinanzierbarer Hilfsmittel als auch die Nutzung dort anerkannter digitaler Werkzeuge in der Pflegepraxis bislang eher schleppend.
Der vorstehende Beitrag plädiert dafür, die im PUEG vorgesehenen Modellvorhaben für Unterstützungsmaßnahmen und -strukturen vor Ort und im Quartier mit der im selben Gesetz festgeschriebenen Förderung der Digitalisierung in der Pflege effizient zu verknüpfen. Neue Digitalisierungslösungen machen Hoffnungen auf Effizienz- und Wirtschaftlichkeitssteigerungen – bislang wird das Potential aber noch nicht ausgeschöpft. Wird die digital gestützte Organisation der Pflege zudem stärker lokal ausgerichtet und mit innovativen Versorgungsarrangements unterlegt, so ist bei einer fachlich angemessenen Umsetzung auch ein Beitrag zur Kostensenkung wie auch zur Linderung der Fachkräfteengpässe durch die Verlagerung der Pflegeverantwortung auf mehr Schultern denkbar. Sie kann auch dazu beitragen, dass die häusliche Pflege im „dritten Gesundheitsstandort Haushalt“ weiterhin für alle Beteiligten eine vorzugswürdige und auch kostengünstigere Alternative zur stationären Versorgung bleiben kann.
Literatur
Bandemer, S. v. / Bußmann, U. / Hilbert, J. / Scharfenorth, K.: Das "virtuelle Altenheim" - Altern der Gesellschaft als Chance, S. 73-81. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik 1994
Hilbert, J. / Naegele, G.: Zwischen Orientierungssuche und Aufbruch: Zur Lage und Zukunft digitaler Werkzeuge in der Altenpflege. Welt der Krankenversicherung, Bd. 9, 2023, S. 222-228
Immig, J. / Dittrich, T. / Preutenborbeck, J. / Klemms, M.: Wie Technologien ihren Weg in die Pflege finden – Rückkoppelungen aus der stationären Langzeitpflege“, in: Krick u.a. (Hrsg.) 2023, S. 97-116
Kowalski, C. / Gliesche, P. /Nieto Agraz, C. / Hein, A.: Potentiale entlastender Assistenzrobotik in der Pflege, in: Krick u.a. (Hrsg.) 2023, S. 55-72
Krick, T. / Zerth, J. / Rothgang, H. / Klawunn, R. / Walzer, S. / Kley, T. (Hrsg.): Pflegeinnovationen in der Praxis - Erfahrungen und Empfehlungen aus dem „Cluster Zukunft der Pflege“, Wiesbaden 2023
Rothgang, H. / Heinze, F. / Kalwitzki, T. / Wagner, C.: Hilfe zur Pflege in Pflegeheimen – Zukünftige Entwicklung unter Berücksichtigung der aktuellen Reformmaßnahmen. Aktualisierung einer Expertise im Auftrag der DAK-Gesundheit, Bremen, Februar 2023
Scharfenorth, K., Mit dem Alter in die Dienstleistungsgesellschaft? Perspektiven des demographischen Wandels für Wachstum und Gestaltung des tertiären Sektors, München, 2004
Waldenberger, F. / Naegele, G. / Kudo, H. / Masuda, T. (Hrsg.): Alterung und Pflege als kommunale Aufgabe. Deutschland und Japan im Vergleich, Wiesbaden 2022
Josef Hilbert und Gerhard Naegele und Hans-Peter Klös 2024, Digitalisierung und Kommunalisierung in der Pflegeversorgung, in: sozialpolitikblog, 27.03.2024, https://difis.org/blog/digitalisierung-und-kommunalisierung-in-der-pflegeversorgung-105 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Josef Hilbert, geb. 1954; promoviert in Soziologie, habilitiert in Berufspädagogik und Gesundheitsökonomie; bis 2020 geschäftsführender Direktor des Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule; Honorarprofessor an den Fakultäten Medizin und Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum; ehrenamtlich Vorsitzender des Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen NDGR e.V.
Bildnachweis: Privat

Prof. Dr. Gerhard Naegele ist Sozialwissenschaftler und war bis 2017 Direktor des Instituts für Gerontologie an der TU Dortmund und dort zuvor Inhaber des Lehrstuhls für Soziale Gerontologie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Sozialpolitik, demografischer Wandel mit Schwerpunkt Arbeitswelt, Pflegepolitik und soziale Dienstleistungen. Er ist Autor zahlreicher einschlägiger Veröffentlichungen und ist heute in der wissenschaftlichen Politikberatung auf EU-, Bundes- und Landesebene tätig.

Dr. Hans-Peter Klös ist Volkswirt und war bis August 2022 Leiter Wissenschaft des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Im Rahmen von Kommissionen, Beiräten und Beratungstätigkeiten war er verantwortlich für die Vernetzung der IW-Forschung mit Ministerien, Verbänden, Wissenschaft, Politik und NGOs. Zuletzt war er Mitglied der High Level Group der Europäischen Kommission „The Future of the Welfare State“ und ist aktuell stellvertretendes Mitglied im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss.