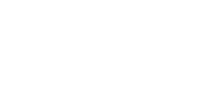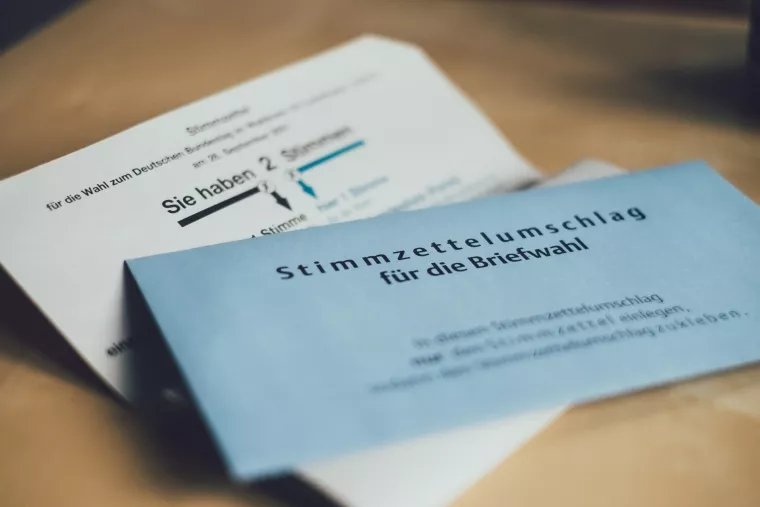Politische Ungleichheit als Problem politischer Sozialisation
In Deutschland wird viel über „politische Ungleichheit“ diskutiert. Hinter dem Begriff verbergen sich mindestens zwei Phänomene: Erstens beteiligen sich Menschen mit verschiedenen Bildungs- und Einkommensniveaus in ungleichem Maß an Politik. Zweitens finden sich die Präferenzen von ärmeren Menschen weniger in Gesetzesänderungen wieder - nicht zuletzt im Bereich der Sozialpolitik.
Häufig wird vermutet, beide Aspekte – ungleiche Beteiligung und ungleiche Repräsentation – seien in einer Art Teufelskreis miteinander verbunden. Je weniger arme Menschen wählen, desto geringer die Anreize, ihre Interessen zu berücksichtigen. Und je weniger ihre Interessen berücksichtigt werden, desto geringer die Neigung, sich an Politik zu beteiligen. Politische Ungleichheit könnte so in einer Spirale aus Fehlrepräsentation, Entfremdung und Wahlenthaltung zunehmen.
Mit ihrer unmittelbaren Relevanz für das Leben vieler Menschen sollte die Sozialpolitik eine hohe Bedeutung für das Repräsentationsempfinden gerade in unteren Schichten haben. Tatsächlich wird für dieses Politikfeld häufig argumentiert, dass in Deutschland systematisch die Interessen von bessergestellten Gruppen bevorzugt würden, die auf Grund ihrer Größe und Beteiligungsneigung wahlentscheidend sind.
Die Argumentationslinie hat eine gewisse Plausibilität. Mehrere ihrer Elemente stützen sich auf gut dokumentierte empirische Muster. Auffällig ist allerdings, dass wir in der Politikwissenschaft bescheidenere Fortschritte bei der Frage machen, warum diese Muster auftreten. Eine Liste theoretisch denkbarer Gründe für die Dominanz der Interessen Hochgebildeter oder Wohlhabender im Bundestag würde nicht nur lang werden. Sie würde wahrscheinlich auch Prozesse umfassen, die sehr unterschiedliche normative Bewertungen verdienen. Sie liegen irgendwo zwischen skandalöser Empfänglichkeit für die Wirtschaftslobby und der Einsicht, dass Abgeordnete mit akademischem Hintergrund für komplexe Gesetzgebungsprozesse unerlässliche Kompetenzen einbringen. Dies soll das Problem der politischen Ungleichheit nicht relativieren, sondern lediglich für die wichtige Frage nach der zu Grunde liegenden Kausalität sensibilisieren.
Ein ähnliches Problem tritt bei der Frage auf, warum die unteren sozio-ökonomischen Schichten sich weniger beteiligen. Die oben skizzierte Argumentation macht politische Eliten und Repräsentationsversagen dafür (mit)verantwortlich. Dafür lassen sich auch einige Belege anführen. Viele Menschen signalisieren in Umfragen ihre Unzufriedenheit mit Politik. Einige Studien zeigen auch, dass ein vielfältiges Politikangebot, mit dem verschiedene Positionen abgebildet werden, Partizipation erhöhen kann.
Ganz so einfach ist es mit der elitenzentrierten Erklärung allerdings nicht. In Deutschland lassen sich neoliberal inspirierte Vernachlässigungen unterer Schichten leicht identifizieren (die Hartz-Reformen aber auch Gesetzgebungen in der Steuerpolitik). Gleichzeitig hat das deutsche Parteiensystem insgesamt durchaus Angebote an ärmere Menschen gemacht. Wie stark politische Maßnahmen im Interesse dieser Gruppe thematisiert werden, verändert sich über Wahlkämpfe. Diese Variation sollte sich dann auch, nach der oben skizzierten Theorie, in der Wahlbeteiligung niederschlagen. Die SPD hat sich beispielsweise von der Agenda 2010 größtenteils abgewendet und warb im letzten Wahlkampf für Mindestlohn- und Steuererhöhung. Mit der Linken gibt es eine Partei, die sich für umverteilende Sozialpolitik einsetzt. Insgesamt boten die Parteien 2021 einen fast vorbildlichen sozial-, wirtschafts- und steuerpolitischem Lagerwahlkampf – ohne erkennbaren Effekt auf die Wahlbeteiligung. Auf den ersten Blick scheinen die politischen Angebote linker Parteien in den vergangenen Jahren jedenfalls stärker zu schwanken als die Wahlbeteiligung.
Lebenszyklusperspektive auf Wahlbeteiligung
Wenn politische Inhalte eine begrenzte Rolle spielen, wie lässt sich die überproportionale Enthaltung unterer Schichten dann erklären? Zahlreiche Forschung legt nah, dass man dieses Phänomen besser verstehen kann, wenn man Wahlbeteiligung in einer Lebenszyklusperspektive betrachtet. Für viele Menschen ist die Auseinandersetzung mit Politik eine Gewohnheit, die sich in einem Sozialisationsprozess herausbildet. Sie ist, um ein in der Sozialpolitikforschung beliebtes Konzept zu bemühen, pfadabhängig. Entwickelt man in jungen Jahren eine Beteiligungsgewohnheit, so ist diese ziemlich stabil im Verlauf des weiteren Lebens. Wird man in politische Apathie sozialisiert, ist diese allerdings ebenso stabil.
Daraus folgt, dass die sozioökonomische Lage (sowie Politikmaßnahmen, die auf sie einwirken) im Erwachsenenalter keinen entscheidenden Einfluss mehr auf Beteiligung haben. Mit meinem Kollegen Sebastian Jungkunz habe ich untersucht, ob sich Einkommensveränderungen über die Zeit auf verschiedene Aspekte politischer Beteiligung auswirken. Das tun sie eindeutig nicht, ganz gleich, welche Operationalisierung wir verwenden. Unsere Interpretation lautet wie folgt: Ärmere und reichere Menschen durchlaufen unterschiedliche politische Sozialisationsprozesse, die zu stabilen (Nicht-)Beteiligungsmustern im Lebensverlauf führen. Erfahrungen im Erwachsenenalter sind dann vergleichsweise irrelevant. Falls sozio-ökonomische Probleme einen direkten Einfluss auf Beteiligung haben, sollte dieser auf kritische Sozialisationsphasen begrenzt und daher häufig schon durch die Lage der Eltern vermittelt sein. Dazu passt der empirische Befund, dass Arbeitslosigkeit nur dann einen Rückgang im politischen Interesse verursacht, wenn sie in jungen Jahren stattfindet, also noch während der frühen Sozialisation.
Eine Gefahr der Sozialisationsperspektive liegt darin, die Rolle der Eltern über zu betonen und zu moralisieren. Das wäre falsch. Umfangreiche Forschung zeigt, wie schwierig es ist, Kinder unter den Bedingungen sozio-ökonomischer Knappheit und Ungleichheit aufzuziehen. Sie sind mit Ängsten, Stress und kognitiven Belastungen verbunden, die schlichtweg keinen guten Nährboden für politische Sozialisation (und viele andere wertvolle Prozesse) bilden. Wirtschaftliche Sorgen lenken Menschen verständlicherweise von Politik ab. Während das für manche eine flüchtige Episode ist, gehört es für andere dauerhaft zum Leben. Gerade in solchen Fällen muss der Staat in der politischen Sozialisation unterstützen. Das ist umso relevanter in einer individualisierten Gesellschaft, in der stabile Milieus oder Organisationen wie Kirchen und Gewerkschaften immer weniger zur Strukturierung politischer Präferenzen beitragen.
Was folgt aus diesen Befunden und Argumenten? Möglicherweise überschätzen wir tendenziell die Mobilisierungsfähigkeit vieler Menschen, die schon in ihrer Kindheit intensiven sozio-ökonomischen Problemen ausgesetzt waren. Die Gefahr besteht, dass zumindest Teile der Nichtwähler durch ihre politische Apathie nicht in dem Maße auf programmatische Aspekte reagieren, wie manchmal unterstellt (und erhofft) wird.
Förderung politischer Gleichheit
Um die politische Gleichheit nachhaltig zu fördern, ist daher ein Fokus auf die frühe Sozialisationsphase unerlässlich. Dass dafür die ökonomische Lage und die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern verbessert werden muss, liegt auf der Hand. Aus sozialpolitischer Sicht sollte zudem ein Fokus darauf liegen, in diesen Phasen die politische Sozialisation nicht aktiv zu untergraben. Das kann zum Beispiel geschehen, wenn junge Menschen den Staat über eine sanktionierende Arbeitsverwaltung kennenlernen, die – folgt man den aktuellen Forschungsergebnissen – Vertrauen und Selbstwirksamkeit schwächen kann. Gerade in dieser Lebensphase auf eine zukunfts- und humankapitalorientierte Arbeitsmarktpolitik zu setzen, wird häufig durch ihren ökonomischen Nutzen begründet. Ein (wenn auch eher indirekter) Beitrag zur politischen Sozialisation ließe sich als zusätzlicher gesellschaftlicher Nutzen hinzufügen.
Daneben sollte, wie oft zu Recht gefordert, die politische Bildung gestärkt werden. Dabei sollte auf Unterrichtsformate gesetzt werden, die Politik erlebbar machen: Durch Wahl- und Politikgestaltungssimulationen, das Verfassen von Petitionen, Gespräche mit Abgeordneten, Exkursionen oder die Teilnahme an Demonstrationen. Um zum Gegenstand von Gewohnheiten zu werden, muss Politik über konkrete Erfahrungen eine emotionale Resonanz entwickeln. Im Alltag sind solche Erfahrungen zu stark zu Gunsten einkommensstarker Gruppen verzerrt. Schulen sind für uns als Gesellschaft die beste Chance, sie über soziale Schichten hinweg zu ermöglichen. Dabei würde es ohne Zweifel helfen, wenn Kinder und Jugendliche in einem Parteiensystem heranwachsen, das die drängenden sozio-ökonomischen Konflikte unserer Zeit offen thematisiert.
FF6_Paul Marx 2022, Politische Ungleichheit als Problem politischer Sozialisation, in: sozialpolitikblog, 30.06.2022, https://difis.org/blog/politische-ungleichheit-als-problem-politischer-sozialisation-6 Zurück zur Übersicht