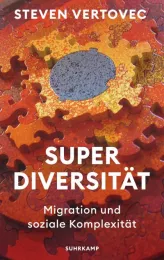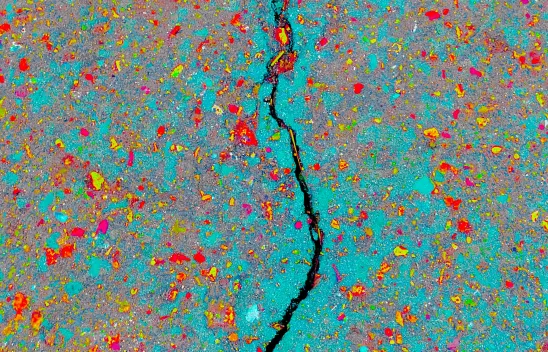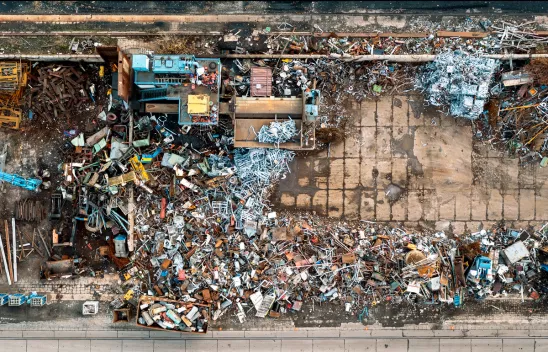Was bedeutet Superdiversität für Sozialpolitik?
Diversität ist im öffentlichen Diskurs ein vielfach und schillernd verwendeter Begriff. Einen wichtigen Beitrag zur Debatte leistet Steven Vertovec, der den Begriff „Superdiversität“ prägte. Sein Werk „Superdiversity. Migration and Social Complexity“ ist nun auf Deutsch erschienen, aus dem Amerikanischen übersetzt von Alexandra Berlina. Kirsten Hoesch hat es gelesen und für sozialpolitikblog rezensiert.
Dass das 2007 in einem Journal-Artikel in Ethnic and Racial Studies erstmals skizzierte Konzept der Superdiversität offenbar einen Nerv getroffen hat, zeigt sich in der akademischen Welt an der Zahl der Zitationen: über 8200 Mal wurde der unter dem Titel „Super-diversity and its implications“ erschienene Beitrag zitiert (S. 96). Außerdem inspirierte er zahlreiche Forschungsarbeiten anderer Wissenschaftler*innen, die eine große Breite wissenschaftlicher Disziplinen widerspiegeln und sich mit Superdiversität aus verschiedenen Perspektiven beschäftigen. Auch in der nicht-akademischen Welt findet der Begriff Verwendung, hat jedoch – wie auch in der Wissenschaft – eine gewisse Eigendynamik entwickelt.
Vertovec setzt sich in seiner Forschung als Soziologe, Sozialanthropologe, Ethnologe und Religionswissenschaftler kritisch mit verschiedenen Konzepten rund um internationale Migration, transnationale soziale Formationen, ethnische Diaspora und Formen urbaner Vielfalt auseinander. Er ist Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften an der Universität Göttingen und war zuvor Direktor des Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) an der Universität Oxford. Die große Resonanz von ,Superdiversität‘ erklärt der Autor damit , dass das „Konzept spezifisch genug war, um etwas Erkennbares zu bezeichnen, aber offen genug, um originelle Perspektiven zu ermöglichen.“ (S. 119)
Der Begriff Superdiversität – Genese und Eigendynamik
Die Rezension der – hervorragenden – deutschen Übersetzung des 2023 bei Routledge erschienenen Buchs „Superdiversity. Migration and Social Complexity“ bietet eine gute Gelegenheit sich mit der ursprünglichen, vom Autor intendierten Bedeutung des Konzepts sowie seiner Fortentwicklung und seinen zahlreichen Facetten zu beschäftigen.
Rund 17 Jahre nach der „Geburt“ der „Super-diversity“ – damals noch mit Bindestrich - knüpft Vertovec an die Ursprünge an, indem er den Artikel aus Ethnic and Racial Studies vollständig wiedergibt (Kapitel 2). Er bietet dann eine Einordnung, Orientierung und Bewertung mit Blick auf „Die vielen Bedeutungen von ,Superdiversität‘“ (so der Titel von Kapitel 3) und die in diesem Kontext erschienenen Publikationen. In den folgenden Kapiteln zeichnet Vertovec nach, was Diversifizierungsprozesse ausmacht und warum Diversität global zunimmt (Kapitel 4), welche Reaktionen auf Diversifizierung festgestellt werden können (Kapitel 5) und wie Superdiversität und sozialwissenschaftliche Ansätze zu sozialer Komplexität miteinander zusammenhängen. Im Schlusskapitel (7) gibt er Hinweise und Beispiele, welche Reaktionen und Handlungsansätze sich – basierend auf spezifischen Studien – als hilfreich im Umgang mit dem Phänomen und damit verbundenen Herausforderungen erwiesen haben.
Was also genau bedeutet Superdiversität?
Der Begriff Superdiversität hat „eine eigene Kernbedeutung und Intention“ (S. 83). Er sollte ursprünglich „neue soziale Muster beschreiben“, insbesondere bezogen auf Migrant*innen und die Migrationsgesellschaft (S. 83). Mit dem Sichtbarmachen und Benennen ebendieser Muster öffnete Vertovec den Blick auf Kategorien und Einflussfaktoren von Differenz, Teilhabe, Ungleichheit und Schichtung jenseits von Ethnie und race. Der Bezug auf letztere ist in der anglo-amerikanischen Migrationsforschung traditionell stark.
Kurz und abstrakt zusammengefasst bezieht Superdiversität sich „auf den Prozess der migrationsbedingten Diversifizierung verschiedener sozialer und rechtlicher Merkmale und auf die sozialen Konfigurationen, die aus diesem Prozess entstehen.“ (S. 267) Neu ist dabei der Fokus auf die wandelbare Verflochtenheit multidimensionaler Merkmale.
Woher diese Merkmale und Konfigurationen rühren, wird deutlicher, wenn Vertovec die Bezüge zu sozialwissenschaftlichen Ansätzen der Komplexität herstellt und Gründe für Diversifizierungen auf verschiedenen Ebenen nennt: „[…] die Zahl der Akteure nimmt zu (durch die Intensivierung und Veränderung von Migrationsströmen), zugleich verstetigen sich vielfältige Differenzierungsmerkmale (wie Ethnizität, Gender, Alter, Rechtstatus), dabei kommt es zu Interdependenzen zwischen diesen Merkmalen (die zu spezifischen Kombinationen führen) und den Eigenschaften der neuen physischen und der sozialen Räume, wo wir Migrant*innen finden (bereits diversifizierte und meist urbane Migrationskontexte).“ (S. 219)
Ins Konkrete übersetzt bedeutet dies: Während früher häufig Migrant*innen in Form von bestimmten Communities wahrgenommen wurden (in Deutschland z.B. Türkisch, Bosnisch, Russisch/Deutsch), deren überwiegende Mehrheit der Mitglieder prägende Merkmale teilten (z.B. ,Gastarbeiter*innen‘, Geflüchtete oder Aussiedler*innen), funktioniert diese Vorstellung schon länger nicht mehr. Vielmehr sind innerhalb von bestimmten Gruppen die Unterschiede in verschiedenen Dimensionen sehr groß, teils größer als zwischen ethnischen Gruppen. Innerhalb einer Herkunftsgruppe finden sich zum Beispiel Hochqualifizierte, Studierende, Geduldete, Geflüchtete, Arbeitsmigrant*innen, Familienmigrant*innen, Irreguläre etc. Verbunden mit staatlich geschaffenen Kategorien – also dem spezifischen Rechts- und Aufenthaltsstatus – öffnen oder verschließen sich für die so „sortierten“ und „gefilterten“ Personen Zugänge zu Arbeitsmarkt, sozialer Sicherung und gesellschaftlicher Teilhabe. Weitere Wechselwirkungen entstehen unter anderem durch soziale Merkmale wie Gender, race, Sprache, Religion und entsprechende Fremd- und Selbstzuschreibungen und Identitäten. Die Kombination all dieser Merkmale hat also entscheidenden Einfluss darauf, wie Menschen gesellschaftlich positioniert werden, aber auch welche eigenen Strategien sie entwickeln und auf welche Ressourcen sie dabei zugreifen können.
Bei Superdiversität geht es also nicht einfach um eine größere Vielfalt ethnischer Hintergründe – eine von Ralph Grillo (2015) als ,Superdiversity-Lite-Verständnis‘ bezeichnete Interpretation – sondern um eine Multidimensionalität und Verwobenheit verschiedenster Merkmale. Es rücken damit die Variationen und Intragruppenunterschiede in den Fokus der Aufmerksamkeit. Damit grenzt sich Superdiversität auch von Diversität ab. Die Aufmerksamkeit wird auf multiple, ineinandergreifende Kategorien gelenkt. Gleichzeitig spielt auch die insgesamt stark gewachsene Zahl an Herkunftsländern und ethnischen und sprachlichen Hintergründen eine Rolle.
Was bedeutet Superdiversität für Sozialpolitik in der Migrationsgesellschaft?
Superdiversität als Begriff und Konzept hat Studien und Debatten unterschiedlichster Disziplinen inspiriert, „Forschende haben ihr Material also durch eine ,Superdiversitätslinse‘ studiert, […].“ (S. 84) Hier soll nun – da notwendigerweise eine Auswahl aus dem reichhaltigen Überblick disziplinärer Fragestellungen und Studien in Vertovecs Buch getroffen werden muss – das Feld der Sozialpolitik und sozialen Sicherung näher betrachtet werden.
Ausgehend von der Idee der multidimensionalen Verwobenheit verschiedener Merkmale ist der Zusammenhang zur Sozialpolitik bereits im ursprünglichen Konzept angelegt: Es entstehen neue Formen von Schichtungen, In- und Exklusionen, die insbesondere durch die in vielen Ländern breite Palette an Migrationskategorien, Aufenthalts- und Rechtstatus verursacht und reproduziert werden. In der inzwischen unübersichtlichen Ausdifferenzierung dieser Kategorien, die Aufnahmeländer geschaffen haben, um Migration gemäß ihrer Interessen zu steuern, sieht der Autor einen wichtigen Grund für Diversifizierungsprozesse (S. 137). Das Einteilen in die eine oder andere Kategorie hat erheblichen Einfluss darauf, wie die Teilhabechancen, der Zugang zu Ressourcen, zum Arbeitsmarkt, Bildung und sozialer Sicherung sich gestaltet. Während Vertovec dieses Phänomen im ursprünglichen Beitrag insbesondere für den Fall Großbritanniens feststellte und nachzeichnete, verweist er aus heutiger Perspektive darauf, dass diese Prozesse prägend für Diversifizierung in zahlreichen Einwanderungsländern sind. Hintergrund ist das Bemühen zahlreicher Staaten mit diesen Instrumenten Migration in ihrem Sinne zu steuern. Allerdings haben die meist restriktiven Maßnahmen „[…] die Zahl der Migrant*innen nicht unbedingt verringert, sondern viele von ihnen stärker gefährdet. Die Auswahlkriterien und -kategorien, die Migrationspolitiken und die Zulassungsregeln bestimmen die Bedingungen, unter denen die Migrant*innen leben und arbeiten – ihre Rechte, Arbeitsperspektiven, politische Einbindung und soziale Stellung […].“ (S.135)
Bei der Kategorienbildung besteht also nicht nur die Gefahr, dass sich bestimmte Muster sozialer Schichtung verfestigen oder erst neu geschaffen werden und Diversifizierung noch verstärken, sondern dass – durch die parallele Entwicklung von kognitiven Mustern und Stereotypen – eine dauerhafte Reproduktion von Ungleichheit geschieht (S. 139).
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass staatliche Institutionen und Akteure ein Bewusstsein und Verständnis für die neuen Formen von Superdiversität und Diversifizierungsprozesse entwickeln. Anschließend an das Konzept der Superdiversität, aber auch in Verbindung mit früheren Konzepten der migrationsrechtlichen Beeinflussung von Stratifikationsmustern (wie etwa Lydia Morris 2002), nennt Vertovec eine Reihe von Studien, die die konkrete Bedeutung von Superdiversität für Sozialpolitik benennen (u.a. siehe S. 88). So stellen diese Studien unter anderem fest, dass rein ethnische Ansätze für die sozialpolitische Erörterung von Bedürfnissen ungeeignet sind; dass ältere Kategorien dem Verständnis der Leistungen und Bedürfnisse von Minderheiten im Wege stehen können oder „dass die neuen komplexen Mischungen der heutigen Migration Verhältnisse schaffen, mit denen sich politisch Verantwortliche und Fachleute aller Art – insbesondere im Bereich der Sozialdienste – auseinandersetzen müssen.“ (S. 88) Denn die Erfassung grundlegender Informationen über Diversität und neue ethnische Minderheitengruppen ist „ein Schlüsselfaktor für die Verteilung von Ressourcen“ (S. 71)
Konkret bedeutet dies, dass sich diverse Praxisfelder neu ausrichten müssen, so der Appell verschiedener Studien, wie etwa soziale Dienste, Gesundheitsweisen, Bildung, Sozialarbeit und Sozialpolitik (S. 88/89). Dies schließt auch „Rekrutierungsstrategien diverser Sozial- und Beratungsdienste, unter anderem bei der Vertretung und Fürsprache (advocacy services)“ ein (S. 88). Besonders interessant ist eine Meta-Analyse von 76 Veröffentlichungen zum Thema Superdiversität und Sozialpolitik aus dem Jahr 2022. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Einbeziehung von auf Superdiversität basierenden Maßnahmen – also Maßnahmen, die die innerhalb einer Herkunftsgruppe bestehenden unterschiedlichen Bedarfe wahrnehmen und adressieren – den Zugang zu staatlichen Sozialdiensten verbessert: „Die methodische Linse der Superdiversität kann helfen, die Umsetzung sozialpolitischer Maßnahmen für benachteiligte Gruppen zu verbessern. Neue Forschungsansätze müssen den praktischen Nutzen der Superdiversität berücksichtigen.“ (S. 88)
In der Realität besteht eine große Herausforderung darin, dass soziale Kategorien als Konstrukte fluide und in steter Entwicklung sind, sich im Laufe der Zeit verändern, „deren Bedeutungen sich jedoch für bestimmte Zeiträume, insbesondere in sozialen Institutionen, ,festsetzen‘ und spezifische Konsequenzen erzeugen“ (S. 245/246). Einfach ausgedrückt: Die dynamischen Prozesse der fortschreitenden (Super-)Diversifizierung kollidieren mit eher träge und schwerfällig reagierenden Institutionen und Strukturen in der Verwaltung und sozialen Diensten. So stellt eine Studie aus dem Jahr 2015 fest, dass trotz eines öffentlichen und politischen Interesses „staatliche Institutionen nach wie vor nicht auf die multidimensionale Fluidität vorbereitet sind, die vom Konzept der Superdiversität beschrieben wird“ (S. 78). In einer 2013 veröffentlichten und von Vertovec genannten Studie wurde konstatiert, „dass britische Kommunalbehörden zum großen Teil noch damit beschäftigt sind, die Auswirkungen der aufkommenden Superdiversität zu ergründen.“ (S.78)
Was lässt sich für die sozialpolitische Praxis lernen?
Gibt es also, bewusst polemisch gefragt, überhaupt Hoffnung für einen angemessenen Umgang mit Superdiversität? Oder ist diese Entwicklung zu komplex, zu divers für konkrete Handlungsempfehlungen, Rezepte und sozialpolitische Anpassungen?
Auch wenn es nicht Intention des ursprünglichen Konzepts von Superdiversität gewesen ist, konkrete Antworten auf diese Fragen zu geben, finden sich viele Ansatzpunkte, die eng mit sozialpolitischen Fragen und der Eröffnung von Chancen und Zugängen verbunden sind. Während Vertovec mit seinem ursprünglichen Konzept neue soziale Muster beschrieb und dabei insbesondere von Beobachtungen in Großbritannien ausging, benannte er bereits in seinem Artikel 2007 ein konkretes Problem, das mit Blick auf Superdiversität und Sozialpolitik bis heute nicht an Virulenz eingebüßt hat: „Weder die Behörden noch die Beratungsstellen noch die Migrant*innen selbst sind sich darüber im Klaren, auf welche Leistungen sie Anspruch haben könnten.“
Wie genau hier mehr Wissen produziert und Politik und Angebote angepasst werden können, zum Beispiel durch innovative und partizipative Ansätze in Kommunen, durch angepasste Formen der statistischen Erfassung und Interpretation, durch eine Einbindung und Förderung von Migrant*inennorganisationen oder die Berücksichtigung sprachlicher Diversifizierung, ist zwar nicht ursprünglicher Gegenstand des „Superdiversity“-Ansatzes. Allerdings sei das aktuelle Buch empfohlen als Einstiegspunkt und Übersicht für zahlreiche interessante, konkretere Studien, die aus ihren spezifischen Perspektiven Antworten auf diese Frage geben – nicht nur, aber eben maßgeblich auch im Bereich der Sozialpolitik. Der Begriff der „Superdiversität“ erweist sich also auch fast 18 Jahre nach seiner Begründung als hilfreiches Konzept zur Analyse jenseits fixer Kategorien. Das Konzept schärft den Blick dafür, dass mit Migration verbundene Diversifizierungsprozesse weit mehr bedeuten als ethnische Heterogenität. Damit bietet es ein interdisziplinär einsetzbares Instrumentarium, um teils als chaotisch wahrgenommene Prozesse gesellschaftlichen Wandels zu beschreiben, zu strukturieren, zu analysieren und kontextspezifische passende Reaktionen und Handlungsoptionen zu diskutieren.
Literatur
Grillo, R. (2015): „Reflections on super-diversity by an urban anthropologist, or ,Superdiversity so what?‘“, Vortrag bei Academy of Urban Super-Diversity, Berlin.
Morris, L. (2002): Managing Migration: Civic Stratification and Rights, London: Routledge (https://doi.org/10.4324/9780203447499).
Vertovec (S. 2007): „Super-diversity and ist implications“. Ethnic and Racial Studies 30(6): 1024-54 (https//doi.org/10.1080/01419870701599465).
Kirsten Hoesch 2024, Was bedeutet Superdiversität für Sozialpolitik?, in: sozialpolitikblog, 19.12.2024, https://difis.org/blog/was-bedeutet-superdiversitaet-fuer-sozialpolitik-146 Zurück zur Übersicht

Dr. Kirsten Hoesch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsfeld 3 des DIFIS, Transnationale soziale Sicherung in der Migrationsgesellschaft. Von 2017 bis 2024 war sie Bereichsleiterin beim Verbund der sozialkulturellen Migrantenvereine in Dortmund e.V. (VMDO). Davor arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sowie am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) Universität Osnabrück. Sie verfasste das Lehrbuch „Migration und Integration. Eine Einführung“ (Springer).
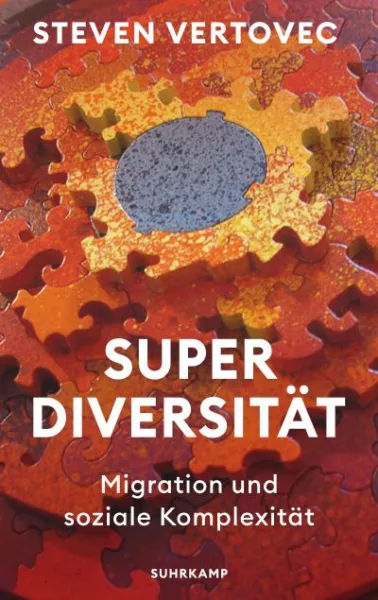
Steven Vertovec (2024): Superdiversität. Migration und soziale Komplexität. Berlin, Suhrkamp.