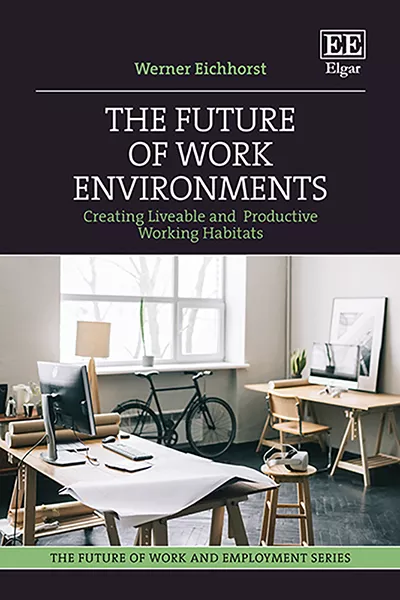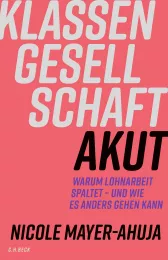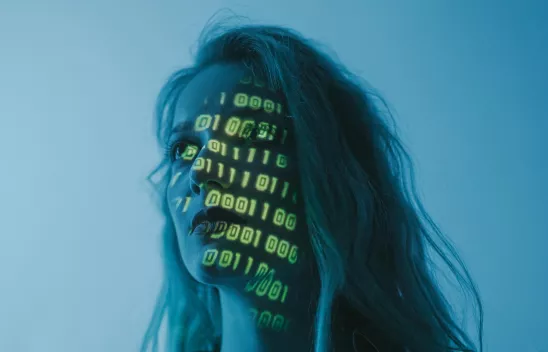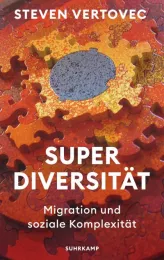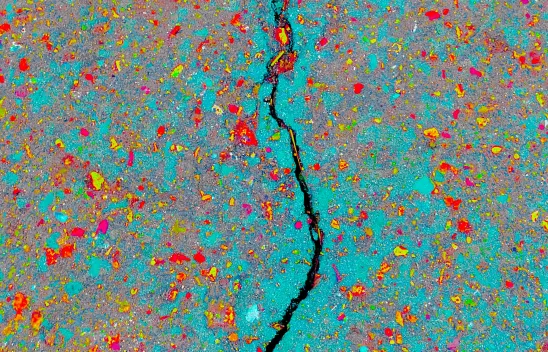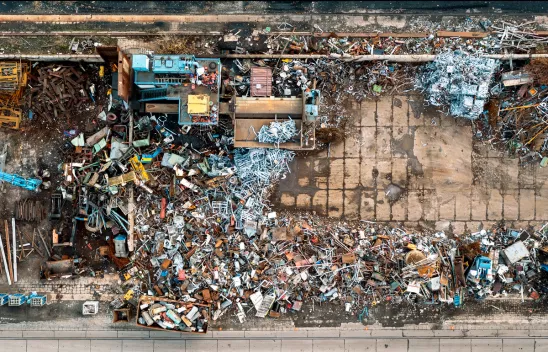Zwischen Scam und dem Versprechen fairer Migration: die Vermittlungspraxis
Mit der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte soll der Fachkräftemangel im deutschen Arbeitsmarkt bekämpft werden. Verschiedene Initiativen sollen dabei sicherstellen, dass die Vermittlungspraxis nach fairen Maßstäben erfolgt, sowohl was die Arbeitsverhältnisse in Deutschland angeht, als auch bezüglich der Folgen für die Herkunftsländer und für die Migrant*innen selbst. Felicitas Hillmann, Lisa Sophie Sommerfeld und Gökçe Şenol haben in einer Mikrostudie die internationale Vermittlungspraxis im Kontext fairer Migration untersucht und präsentieren ihre Erkenntnisse.
Seit etwa zehn Jahren setzen sich internationale Organisationen, allen voran die International Labour Organisation (ILO) und die International Organisation of Migration (IOM) für bessere Standards fairer Migration ein. Mittlerweile existiert auch eine Reihe von internationalen Instrumenten und Regulierungen, die eine faire Vermittlungspraxis erleichtern sollen (z.B. die IRIS-Standards). Im Pflegesektor schützt eine Safeguard List vor der Abwanderung von Pflegekräften aus Ländern mit einer Unterversorgung im Gesundheitsbereich. Arbeitgeber-basierte Initiativen für „Responsible Recruitment” sind entstanden, der Ruf nach ethic recruitment, d.h. einer ethisch vertretbaren Rekrutierung von internationalen Arbeitskräften, ist laut. Deutschland gehört durch sein Triple-Win-Programm zu den Vorreitern im Feld der fairen Migration.
Um was es geht
In unserer Mikrostudie „Zur Rolle und Positionierung von Vermittlungsagenturen für die faire Rekrutierung internationaler Arbeitskräfte“ beschäftigen wir uns mit dem oben skizzierten sehr unübersichtlichen Themenfeld. Bislang findet sich in der wissenschaftlichen Literatur weder eine solche Aufarbeitung des Konzeptes der „fairen Migration“, noch existiert eine Übersicht über die Maßnahmen, die zu einer Realisierung fairer Migration international angewendet werden. Obwohl bekannt ist, dass auch die Anwerbung internationaler Arbeitskräfte nach Deutschland teilweise unter problematischen Bedingungen verläuft und auf unerlaubte Beschäftigungsbedingungen vor Ort durch Beratungsangebote wie „Faire Integration“ und „Faire Mobilität“, gefördert durch das BMAS und die Gewerkschaften, reagiert wird, liegen zur Dynamik der Vermittlungspraxis in Deutschland keine Forschungsergebnisse vor. Auch unterstreicht der „nationale Aktionsplan gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit“ (NAP A/Z) der Bundesregierung vom Februar 2025 die Bedeutsamkeit einer „Vermittlung in seriöse Beschäftigungsverhältnisse“ als ein Teil von Fachkräftegewinnung und betont den Zugang zum Arbeitsmarkt als Teil der Förderung zur fairen Anwerbung (Bundesdrucksache 2025: 2).
Doch: Deutschland befindet sich in diesem international unübersichtlichen Feld in einer besonderen Position. Erstens engagieren sich die deutschen Institutionen seit etwa einem Jahrzehnt für „faire Migration“ und nehmen durch Programme wie Triple Win eine internationale Vorreiterposition ein. Zweitens bekleidet in Deutschland die Bundesagentur für Arbeit (BA) durch ihre langjährige Monopolsituation (bis 2002) auch heute noch eine entscheidende Position im Vermittlungsgewerbe, lange war sie das Zünglein an der Waage für den Arbeitsmarktzugang und hat sich nur teilweise internationalisiert. Drittens hat Deutschland seit 2021 ein eigenes RAL-Zertifikat für den Pflegesektor entwickelt, welches als Blaupause für weitere Vorstöße in Richtung einer Zertifizierung von Vermittlungsdienstleistungen dienlich sein könnte.
Es liegt nahe, dass eine langfristig gedachte bundesdeutsche Fachkräftesicherungsstrategie sich vermutlich intensiver als bisher mit den im internationalen Vermittlungsgewerbe üblichen Praktiken wird auseinandersetzen müssen. Hier setzt nun unsere Mikrostudie an: wir beleuchten die internationale Debatte über Zwangsarbeit, Zeitarbeit und faire Migration, wie sie von internationalen Organisationen geführt wird und gehen auf die Umsetzung der ILO-Konventionen ein (Kuptsch und Mieres 2025), wir präsentieren eine Übersicht über die IRIS-Standards als Ergebnis dieser Debatte über ethische Rekrutierung. Wir konzentrieren uns dann auf die Ergebnisse unserer empirischen Studie, die sich der bundesdeutschen Situation widmet. Aktuell ist weder bekannt, in welchen Branchen wie viele Agenturen unterwegs sind, noch wie viele Menschen im fluiden Feld der „Beschäftigungsindustrie“ tätig sind (Pongratz 2023).
Was wir wissen wollten
Unsere Mikrostudie widmet sich damit einem lückenhaften Wissensfeld, das zudem durch mangelnde Reflexion über bestehende Praktiken und anekdotisches Wissen, etwa in Form von Beraterwissen, geprägt ist. Sie liefert Antworten auf die folgenden Fragen:
- Was ist die Definition „fairer Migration“ und welche Rolle spielen die Vermittlungspraxis bzw. die Vermittlungsagenturen zu ihrer Herstellung?
- Welche problematischen Vermittlungspraktiken lassen sich identifizieren und an welchen Stellen des Rekrutierungsprozesses finden sie statt?
- Welche supra-nationalen und nationalen Antworten existieren im Bereich der Rekrutierungspraxis und sind diese internationalen Ansätze auf Deutschland übertragbar?
Herzstück unserer Mikrostudie sind die Ergebnisse unserer Empirie. Sie umfasste die Auswertung von existierender Literatur, eine Sichtung und Systematisierung der bestehenden Vermittlungsagenturen in Deutschland sowie Interviews mit neun Expert*innen, u.a. Vermittlungsagenturen in Deutschland und mit drei Vermittlungsagenturen in einem Sendeland. Wir haben eine soziale Plattform gecrawlt und die dort versammelten Äußerungen zur Vermittlungspraxis internationaler Arbeitskräfte kategorisiert, um besser zu verstehen, wie Scam, d.h. Betrug, eigentlich funktioniert.
Wir betten die Ergebnisse unserer Empirie historisch und zeitgenössisch ein: die Rolle der Bundesagentur für Arbeit mit ihrem bis 1994 bestehenden Vermittlungsmonopol wie auch die Sonderform der Arbeitnehmerüberlassung wird detailliert aufbereitet, weil sie parallel von „Staffern“ genutzt wird, d.h. von internationalen Personalvermittlungsagenturen, die sich auf „Lückenfüllerei“ in ihrer Vermittlungspraxis spezialisiert haben. Allein schon, die sprachliche Verwirrung darüber, was temporäre Arbeit eigentlich ist (Leiharbeit? Zeitarbeit?) zeigt, wie stark die Grenzen in der Arbeitsvermittlungspraxis faktisch verschwimmen. Wir beleuchten die Dynamiken, die der Expansion der Vermittlungsagenturen als Treiber in der Beschäftigungsindustrie auch in Deutschland zugrunde liegen. Wir fragten uns, ob die zunehmend aggressiven Praktiken in diesem Sektor ein Einzelfall sind und ob sie eventuell in Zusammenhang mit der Erprobung neuer digitaler Tools stehen könnten.
Was wir jetzt wissen
Grundsätzlich bedeuteten faire Arbeitsmigration und faire Rekrutierung für unsere Interviewpartner*innen, dass Migrant*innen vor allem nicht in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse geraten und sich nicht verschulden dürfen.
Wir wissen jetzt, dass in Deutschland 181 Personalvermittlungsagenturen mit insgesamt 683 Filialen ansässig sind und ihre internationalen Dienste im Internet anbieten. Die Komplexität in der Vermittlungspraxis lässt sich auf die unterschiedlichen Beschäftigungstraditionen in den verschiedenen Branchen zurückführen und wird durch die intransparenten Kostenstrukturen, durch die verschiedenen Beratungsmodelle verstärkt. Beklagt wurde in Internetforen immer wieder, dass der Vermittlungsprozess lange dauere und dass „Missbrauch und Scam“ üblich seien. Wir erfuhren in unserer Untersuchung aus Sicht der Betroffenen von verschiedenen Formen des Missbrauchs: Unerwartete Kosten, irreführende Informationen, Ausbeutung in Form unbezahlter Vor- und Zuarbeit während des Bewerbungsprozesses, unethisches Verhalten und Voreingenommenheit, d.h. Diskriminierung, vor allem auch Missmatches und Fake Arbeitsangebote (bis hin zu illegalen Tätigkeiten). Expert*innen beklagen eine zunehmende Aggressivität in der Vermittlungspraxis: immer stärker würde versucht, internationales Personal proaktiv an Unternehmen in Deutschland zu vermitteln.
Wir wissen auch, dass sich für Deutschland die Komplexität des Themas „Personalvermittlung internationaler Arbeitskräfte“ aus dem Zusammenwirken von internationalen Konventionen und national unterschiedlichen Rechtsprechungen auf die Vertragsgestaltung und die Arbeitsbedingungen vor Ort ergibt. Diese internationalen Grauzonen bringen Unübersichtlichkeit mit sich, die von unseriösen Anbietern ausgenutzt wird. Arbeitsvermittlungsmodelle richteten sich lange auf das nationale Klientel, sie „internationalisierten“ sich erst nach und nach. Einen Spezialfall bildet heute das Leihmodell der Arbeitnehmerüberlassung. Die Zahlen zeigen hier einen klaren Trend der Erhöhung des Anteils der sich bereits in Deutschland befindenden ausländischen Arbeitnehmer*innen an der Gesamtzahl der Arbeitnehmerüberlassungen. Viele der von uns untersuchten Vermittlungsagenturen boten sowohl Zeitarbeit (Arbeitnehmerüberlassung) als auch Direktvermittlung (Rekrutierung aus dem Ausland) an. Pointiert kann man sagen, dass die Berufe mit geringeren Gehältern (insb. Helferbeschäftigungen), für die Personalvermittler kaum interessant waren und sie sozusagen „nebenher liefen“. Branchen wie die Logistik und die metallverarbeitende Industrie hingegen setzen so auch gleich auf das Verleihmodell der Arbeitnehmerüberlassung. Hochqualifizierte wurden über executive search handverlesen vermittelt und die Pflegebranche bildete einen Sonderfall im Vermittlungsgewerbe: hier existierten international vergleichbare Standards, ein Gütesiegel zur Qualitätssicherung diente als Orientierungspunkt bei den Vermittlungsstandards.
Was getan werden könnte
Die meisten der von uns interviewten Unternehmen und Expert*innen wünschten sich eine Form der Zertifizierung, die passgenau genug sein sollte, um wirksam zu sein und zugleich nicht neue bürokratische Anforderungen produzieren würde. Es gibt Beispiele für solche Zertifizierungen, etwa das oben genannte Gütesiegel, außerdem internationale Beispiele zu kollektiven Beschwerdeplattformen. Ein weiteres Regulierungspotential, das an bestehendes Gewerberecht anknüpft, könnte in einer Blacklist bei den Arbeitsagenturen vor Ort bestehen, die darüber informiert, welche Vermittlungsagenturen wiederholt irreführende Angaben machen, in prekäre Beschäftigungsverhältnisse vermitteln oder versteckte Kosten erheben.
Unsere Interviews zeigen, dass eine Balance zwischen Integrität, wirtschaftlicher Machbarkeit und nachhaltiger Integration notwendig ist, um ein faires und funktionierendes System der internationalen Arbeitsmigration zu etablieren. Die folgenden Instrumente könnten sich dazu eignen:
- Verbindliche nationale Standards in Anlehnung an ILO 181 zu privaten Arbeitsvermittlern etablieren (z.B. Verbot von Vermittlungsgebühren für Arbeitnehmer*innen – unter Berücksichtigung der ebenfalls existierenden Schwierigkeiten durch unethisches Verhalten der Arbeitnehmer*innen),
- Zertifizierungs- und Akkreditierungssysteme ausbauen: (transparentes, verpflichtendes Zertifizierungsverfahren für private Vermittlungsagenturen – sektorübergreifend),
- Digitalisierung nutzen: (Plattformen zur Beschwerdeeinreichung, Bewertungssysteme oder transparente Rekrutierungstracking-Systeme öffentlich zugänglich machen, z.B. als Teil von „Make-it-in-Germany“ oder im Rahmen einer „Work and Stay“ -Agentur),
- Staatlich-private Kooperationsstrukturen stärken: (Kooperation der Bundesagentur für Arbeit bevorzugt mit zertifizierten privaten Anbietern),
- Monitoring und Forschung: (zentrales Register für aktive Vermittlungsagenturen mit Angaben zu Branche, Zielregionen und Praktiken; international vergleichende Forschung),
- Transnationale Verantwortungsketten sichtbar machen: (menschenrechtliche Perspektive auch in Rekrutierungsprozessen von Subunternehmern offenlegen);
- Bewusstseinsbildung und Schulung fördern: (Aufklärung über Rechte und Risiken im Rekrutierungsprozess präventiv im Herkunftsland).
Wir konnten mit unserer Mikrostudie das extrem wichtige Wissensfeld der Arbeitsvermittlung für eine faire Fachkräftesicherung lediglich anreißen. Unsere Mikrostudie zeigt jedoch, dass weiterer Forschungsbedarf in diesem internationalen und fluiden Feld der Beschäftigungsindustrie besteht. So erhöht sich durch die Digitalisierung die Unübersichtlichkeit, weil neue Formen wie z.B. social recruiting eine hohe Dynamik aufweisen und dringend einer Einordnung bedürfen, die über anekdotisches Wissen hinausgeht.
Felicitas Hillmann und Lisa Sommerfeld und Gökçe Şenol 2025, Zwischen Scam und dem Versprechen fairer Migration: die Vermittlungspraxis, in: sozialpolitikblog, 26.06.2025, https://difis.org/blog/zwischen-scam-und-dem-versprechen-fairer-migration-die-vermittlungspraxis-170 Zurück zur Übersicht

Felicitas Hillmann, Professorin, leitet zur Zeit an der Technischen Universität Berlin das Projekt "Paradigmenwechsel_weiterdenken", das aus dem FIS-Vernetzungsprojekt "Paradigmenwechsel" im Kontext von IMCB22 hervorgegangen ist und aktuell durch das BMAS gefördert wird. Das Projekt beheimatet ein internationales Expert*innennetzwerk (= nups), es publiziert und forscht durch Mikrostudien und Webinare zu Themen der internationalen Migration, insbesondere zur Fachkräftesicherung. Hillmann hat international umfassend publiziert, im März 2025 gab sie ein Special Issue der Fachzeitschrift Cosmopolitan Civil Societies – an Interdisciplinary Journal zum Thema Migrationsgovernance heraus.

Lisa Sophie Sommerfeld ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im nups-Team an der TU Berlin. Am 12.06.2025 verteidigte sie erfolgreich ihre Dissertation mit dem Titel „On the edge of the city – not the edge of society. Refugees’ New Life in Berlin’s Marzahn District: Integration and Urban Transformation through the Promotion of Human Capabilities“. Aktuell arbeitet Frau Sommerfeld an Mikrostudien zu den Themen „Vermittlungsagenturen und Fair Recruitment“ sowie „Internationale Studierende an der TU Berlin“ mit. Zudem ist sie Ansprechpartnerin für die nups-PhD-Nachwuchsgruppe.

Gökçe Şenol ist Architektin und absolviert derzeit das englischsprachige Masterstudium Architecture Typology an der TU Berlin. Sie arbeitet als studentische Mitarbeiterin im Projekt „Paradigmenwechsel_weiterdenken“ und unterstützt dort die akademische Forschung, Mikrostudien, Newsletter und Webinare. Sie interessiert sich sehr für interdisziplinäre Forschung mit den Schwerpunkten Migration und Integration sowie klimasensitives und inklusives Design in urbanen und bebauten Räumen.

Felicitas Hillmann, Lisa Sophie Sommerfeld, Gökçe Şenol
Zur Rolle und Positionierung von Vermittlungsagenturen für die faire Rekrutierung internationaler Arbeitskräfte
NUPS Netzwerk TU Berlin
Hier geht es zur Studie