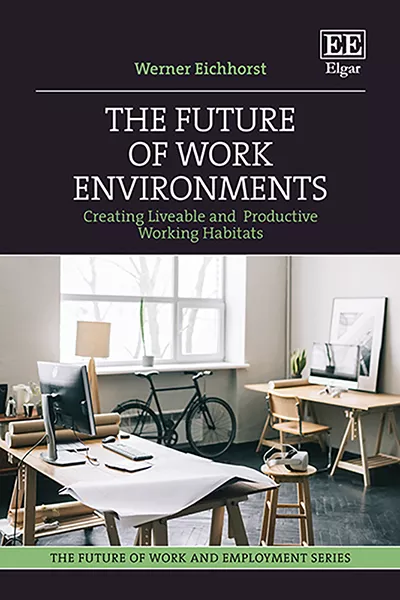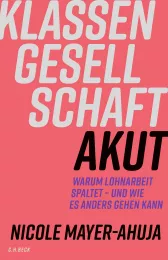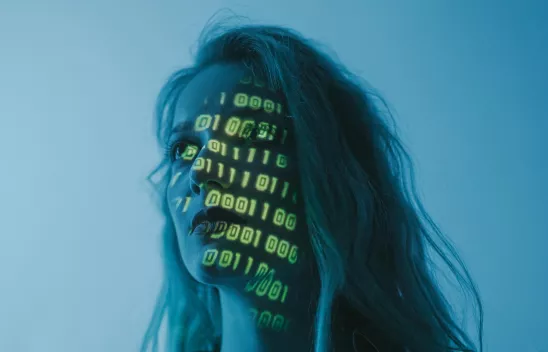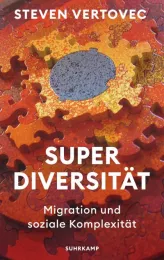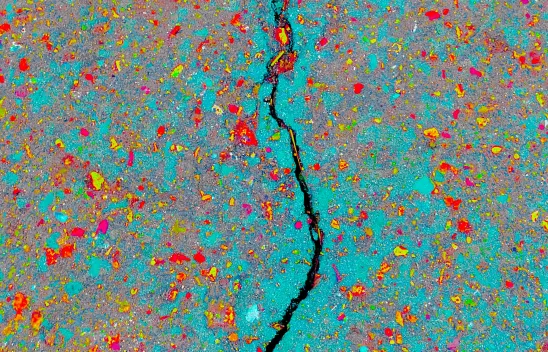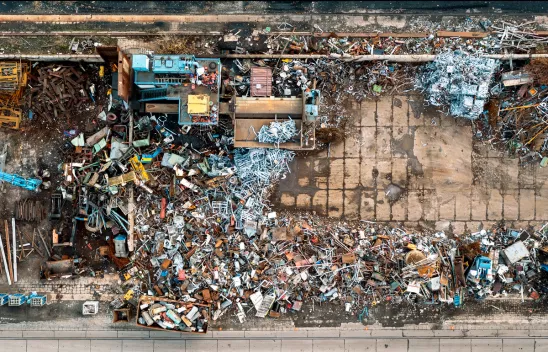Die externalisierten Kosten des Schrumpfens
Während die älteren Generationen im globalen Norden zunehmend Unterstützung benötigen, sinkt die Zahl der jüngeren Menschen, die diese Aufgaben übernehmen können. In der Altenpflege etablieren sich deswegen transnationale Versorgungsketten. Ewa Palenga-Möllenbeck hat diesen neuen Sorgemarkt, die Folgen für Pflegekräfte und die Rolle des Staates untersucht.
Seit Beginn der industriellen Revolution schien ausgemacht, dass die Menschheit exponentiell wächst. 1798 warnte Robert Malthus vor einer weltweiten Verelendung durch die Bevölkerungsexplosion. Sein dystopisches Szenario trat zumindest im globalen Maßstab nicht ein und das Wirtschaftswachstum in westlichen Industriestaaten schuf zudem Spielraum für ungleichheitsdämpfende, staatlich organisierte Umverteilung.
Vor allem aber schien eines nie zum Problem zu werden: Die Versorgung der Älteren durch die Jüngeren. Noch Ende der 1950er Jahre soll Konrad Adenauer Bedenken gegen das neu eingeführte, umlagefinanzierte Rentensystem mit der lapidaren Bemerkung „Kinder kriegen die Leute immer“ abgetan haben. Heute sehen sich die Gesellschaften des globalen Nordens mit den Kosten des Schrumpfens konfrontiert – euphemistisch als „demografischer Wandel“ apostrophiert – bei denen sich die Frage der Verteilungsgerechtigkeit ebenso stellt wie bei jenen des Wachstums.
Nichts macht diese Frage deutlicher als die „Pflegekrise“, die inzwischen den gesamten globalen Norden erfasst hat: Immer mehr alte müssen von immer weniger jungen Menschen nicht nur kollektiv finanziell unterhalten, sondern immer häufiger auch individuell in ihrer Lebensführung unterstützt werden, weil sie ihren Alltag nicht mehr allein bewältigen können. Dabei geht es keineswegs nur um Pflegebedürftige im engen medizinischen Sinn; die Grenzen zwischen Behandlungspflege, Grund- und Körperpflege sowie praktischer Betreuung oder schlichtem „Dasein“ im Alltag sind fließend. Im Englischen werden die verschiedenen Aspekte dieser Sorge- und Betreuungstätigkeiten knapp als care work zusammengefasst.
Transnationale Versorgungsketten in Europa
Auf diese Krise reagieren die – von Stephan Lessenich (2016) in anderen Kontexten als „Externalisierungsgesellschaften“ charakterisierten – Staaten Westeuropas ähnlich wie auf den Arbeitskräftemangel während des Wirtschaftswunders: Sie greifen auf Arbeitskräfte aus anderen, weniger wohlhabenden Staaten zurück, für die care work im Ausland oft eine attraktive Alternative, nicht selten sogar einen Ausweg aus prekären Lebensverhältnissen darstellt. Dabei hinterlassen sie sie in ihren eigenen Familien eine „Versorgungslücke“ – ein weltweit verbreitetes Phänomen, für das Arlie R. Hochschild den Begriff global care chains geprägt hat (für einen Überblick siehe Lutz 2015).
Anders als bei der Anwerbung sogenannter Gastarbeiter*innen ist die Rolle des Staats bei der Etablierung solcher care chains in Europa jedoch ambivalenter. So gab es zunächst keine zwischen den Regierungen von Ziel- und Entsendestaaten ausgehandelten Abkommen. Vielmehr zieht zum Beispiel der deutsche Staat sich aus der Verantwortung zurück, überlässt es weitgehend den Angehörigen der alten Menschen, deren Betreuung selbst zu organisieren – und toleriert dabei offensichtlich bewusst eine rechtliche Grauzone, deren Existenz nicht nur ein offenes Geheimnis ist (Lutz/Palenga-Möllenbeck 2010), sondern die neben der Pflege durch Angehörige, Pflegedienste und in Heimen sogar schon als inoffizielle „vierte Säule“ des deutschen Pflegesystems bezeichnet wird.
Für diese Entwicklung spielen wirtschaftliche und kulturelle Faktoren eine Rolle: Einerseits ist eine Unterbringung in Heimen oder betreuten Wohnungen selbst für gut situierte Senioren und deren Familien oft nicht bezahlbar. Andererseits entspricht es auch einer kulturell tief verankerten Idealvorstellung, den Lebensabend im eigenen Zuhause zu verbringen. Hinzu kommt, dass die Generationen oft zu weit voneinander entfernt leben. Berufstätige Kinder können die Betreuung ihrer alten Eltern selbst nicht leisten. Eine durchgehende Betreuung in den eigenen vier Wänden, zumal unter Einhaltung der in Deutschland geltenden arbeitsrechtlichen Standards, wäre erst recht nur für die wenigsten erschwinglich – von der Knappheit der erforderlichen Arbeitskräfte auf dem heimischen Markt ganz zu schweigen.
„Live-ins“ – Leben und Arbeiten im fremden Zuhause
Hier tritt nun ein Phänomen auf den Plan, das als live-in care bezeichnet wird: Migrantinnen – in Deutschland sind es mit ca. 90 Prozent weit überwiegend Frauen aus Osteuropa, die Mehrheit davon aus Polen – leben im Haushalt der Menschen und leisten dort die Betreuungsarbeit, wobei sie sich oft in Intervallen abwechseln. Sie kosten die deutschen Familien erheblich weniger als eine Betreuung durch inländische Beschäftigte; umgekehrt ist dieser Deal wegen des nach wie vor starken Lohngefälles zwischen Ost- und Westeuropa für die Frauen finanziell attraktiv, zumal keine formalen Qualifikationen verlangt werden.
Wie viele solcher Live-ins es gibt, lässt sich kaum beziffern. Offizielle Zahlen gibt es schon deshalb nicht, weil das Feld bislang weitgehend unreguliert und keine strukturierte Datenerhebung möglich ist. Häufig sind Live-ins nicht offiziell gemeldet. Es kursieren Schätzungen, dass zwischen 150.000 und 700.000 Live-ins in deutschen Haushalten arbeiten, wobei die Definitionen und Erfassungsmethoden variieren – so werden zum Teil die wechselnden Betreuerinnen auf einer Live-in-Stelle einzeln gezählt, zum Teil die Stellen als solche. Bei 41,3 Mio. Privathaushalten in Deutschland würde somit in bis zu 8 Prozent aller Haushalte mit Betreuungsbedürftigen (und in 1,7 Prozent aller Haushalte insgesamt) eine Live-in-Kraft arbeiten.
Vermittlungsagenturen – Schlüsselakteure in der transnationalen Care Economy
Dafür, dass Betreuerinnen und Haushalte über Staatsgrenzen und Sprachbarrieren hinweg zueinanderfinden, sorgen zahlreiche private Agenturen, die vor allem nach der EU-Osterweiterung 2004 entstanden sind und als entscheidende Knoten in einem dichten transnationalen Netzwerk fungieren (Aulenbacher et al. 2024). Auch ihre Zahl ist nicht sicher bezifferbar; bei einer Momentaufnahme im Jahr 2017 boten 337 Agenturen in Deutschland und 190 Unternehmen in Polen an, Betreuerinnen nach Deutschland zu vermitteln (Palenga-Möllenbeck 2021).
Sie sind Teilnehmer und Mitgestalter eines neu entstandenen „Sorgemarkts“, auf dem eine „Grundvoraussetzung gesellschaftlichen Lebens“ (Aulenbacher 2018) – nämlich die bisher überwiegend privat geleistete Care-Arbeit – als Ware nachgefragt und angeboten (kommodifiziert) wird. Im deutschsprachigen Raum hat sich für live-in care als eine solche „fiktive Ware“ im Sinne Karl Polanyis der Begriff „24-Stunden-Pflege“ eingebürgert, der die Erwartungshaltung von Betreuungsbedürftigen und Angehörigen widerspiegelt: Als Kund*innen erwarten sie eine Leistung, die annähernd dem entspricht, was von Angehörigen in einem Mehrgenerationenhaushalt erbracht wird – dementsprechend sollen die Live-ins an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zumindest anwesend und im Bedarfsfall jederzeit verfügbar sein.
Pseudo-familiäre Care-Arbeit als fiktive Ware
Tatsächlich wäre eine solche 24-Stunden-Bereitschaft mit deutschem Arbeitsrecht nicht vereinbar. „Geltende Gesetze werden oft nicht eingehalten, besonders die Regelungen zu Arbeitszeit und Mindestlohn“, konstatiert der Sachverständigenrat Migration und Integration (SVR 2022: 13). Der Charakter von „pseudo-familiärer“ Care-Arbeit lässt eine zeitliche und räumliche Abgrenzung von eigentlicher Erwerbsarbeit und Freizeit kaum zu und der Privathaushalt ist für arbeitsrechtliche Kontrollen ohnehin unzugänglich. Dies wiederum verleitet dazu, bürokratische Hürden gleich ganz zu umgehen und Live-ins noch billiger informell zu beschäftigen.
Selbstregulierung und Normalisierung
Angesichts der Laissez-faire-Haltung des Staats gehen Interessenverbände der Vermittlungsagenturen daran, das Regulierungsvakuum selbst zu füllen – schon weil es ihr Angebot für Arbeitskräfte wie Endkunden seriöser erscheinen lässt. Ein Beispiel ist die DIN-Spezifikation 33454, die mit Pflegewissenschaftler*innen, Jurist*innen und Verbraucherschützer*innen erarbeitet wurde und Vorgaben für die Zertifizierung von Anbietern enthält (DIN 2021). Außerdem lobbyieren Vertreter der Agenturbranche dafür, die Live-in-Pflege auch in Deutschland von einer inoffiziellen zu einer offiziellen vierten Säule des hiesigen Pflegesystems zu machen. In Österreich ist dies bereits 2007 geschehen: Die Beschäftigung von Live-ins wird dort aus dem staatlichen Pflegesystem finanziert. Dabei handelt es sich dort überwiegend um formal Selbstständige, die aufgrund der EU-Dienstleistungsfreiheit arbeiten – allerdings sind diese (anders als in Deutschland) sowohl in Österreich als auch in Polen sozialversicherungspflichtig.
In Deutschland hingegen, wo dies auf eine Umgehung der Sozialversicherungspflicht hinauslaufen würde, sind die meisten Live-ins als Angestellte osteuropäischer Unternehmen entsendet. Die Live-in-Agenturen bemühen sich, für dieses Modell eine Finanzierung aus der deutschen Pflegeversicherung durchzusetzen. Wie erfolgversprechend diese Bemühungen letztlich sein werden, bleibt angesichts der ohnehin angespannten Finanzlage skeptisch abzuwarten. Sollte es dazu kommen, ist auch mit einer stärkeren staatlichen Regulierung zu rechnen – wobei fraglich ist, wie diese effektiv durchgesetzt werden kann.
Dass es auch anders geht, zeigt das Engagement der Bundesregierung bei der Anwerbung von festangestellten qualifizierten Pflegekräften für stationäre Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser (Kordes et al. 2021) – etwa im Rahmen der seit 2013 geschlossenen „Triple-Win“-Abkommen mit Staaten in Asien, Afrika und Amerika, für das die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit Verwaltungen vor Ort zusammenarbeitet. Ein weiteres Beispiel in diese Richtung ist das vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Gütezeichen „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ (GAPA o.J.), das sich an einem Verhaltenskodex der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2010) orientiert, mit dem eine Ausbeutung der Entsendeländer verhindert und die Einhaltung der ILO-Standards für „gute Arbeit“ (Zu 2013) gewährleistet werden soll. Doch auch wenn suggeriert wird, dass Deutschland, Entsendeländer und Pflegekräfte gleichermaßen profitieren und Mindeststandards eingehalten werden, bleiben auch hier die Gewinne ungleich verteilt – handelt es sich letztlich um den Versuch eines „spatial fix“ (Jandik 2023), mit dem die Kosten der Schrumpfung räumlich externalisiert werden.
Paradoxerweise ist es in Europa und insbesondere innerhalb der EU eher noch schwieriger, Standards effektiv durchzusetzen, da nationale Regierungen aufgrund der bestehenden Freizügigkeiten nicht als Gatekeeper fungieren können und Arbeitsplätze in Privathaushalten noch schwieriger zu regulieren sind. Der Frage, wie europäische Staaten die Kommodifizierung und Vermarktlichung von Care-Arbeit durch Vermittlungsagenturen bewältigen bzw. diese gestalten und für sich zu nutzen zu versuchen, widmet sich erstmals systematisch der vor Kurzem erschienene Sammelband „Home Care for Sale“ (Aulenbacher et al. 2024). Doch selbst wenn es gelingen sollte, die damit verbundenen Verwerfungen einzuhegen, steht eines außer Frage: Durch die fortschreitende Alterung und dem Ausscheiden der „Boomer“ aus dem Erwerbsleben wird sich deren Ursache nicht grundlegend beheben lassen. Für die alternden Industriegesellschaften scheint es auf absehbare Zeit keine Alternative zu geben, als weiterhin nicht nur die Kosten ihres wirtschaftlichen Wachstums, sondern auch die Kosten ihres demografischen Schrumpfens zu externalisieren.
Literatur
Aulenbacher, B. (2018): Sorgemärkte: Vom sorglosen zum sorgenden Kapitalismus? Falter, 24. Oktober. https://www.falter.at/zeitung/20181024/sorgemaerkte-vom-sorglosen-zum-sorgenden-kapitalismus. Zugegriffen: 11. November 2024.
Aulenbacher, B./Lutz, H./Palenga-Möllenbeck, E./Schwiter, K. (Hrsg.) (2024): Home Care for Sale: The Transnational Brokering of Senior Care in Europe. London: SAGE.
Jandik, M. (2023): Ungleich verteilte Gewinne - Anwerbeabkommen gegen Pflegenotstand. Nachrichtenpool Lateinamerika. https://www.npla.de/thema/arbeit-gesundheit/ungleich-verteilte-gewinne-anwerbeabkommen-gegen-pflegenotstand/. Zugegriffen: 15. Dezember 2024.
Kordes, J./Pütz, R./Rand. S (2021): Migrationsmanagement als migrationspolitisches Paradigma: das Beispiel der Anwerbung von Pflegefachkräften. Europa Regional 26.2018: 2–16.
Lessenich, S. (2016): Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. München: Carl Hanser.
Lutz, H. (2015): Globale Care Chains. In Handbuch Entwicklungsforschung, Hrsg. Manuela Boatca, Karin Fischer und Gerhard Hauck, 1–4. Wiesbaden: Springer VS.
Lutz, H./Palenga-Möllenbeck, E. (2010): Care Work Migration in Germany: Semi-Compliance and Complicity. Social Policy and Society 9: 419–430.
Palenga-Möllenbeck, E. (2021): „Lade Deine Superkräfte wieder auf“: Vermittlungs- und Entsendeagenturen und das Konzept der guten Arbeit in der Live-in-Betreuung. In Gute Sorge ohne gute Arbeit? Live-in-Care in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Arbeitsgesellschaft im Wandel, Hrsg. Brigitte Aulenbacher, Helma Lutz und Karin Schwiter, 106–126. Weinheim: Beltz Juventa.
WHO [World Health Organization] (2010): The WHO Global CODE of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-workforce/migration-code/code_en.pdf.
Ewa Palenga-Möllenbeck 2025, Die externalisierten Kosten des Schrumpfens, in: sozialpolitikblog, 30.01.2025, https://difis.org/blog/die-externalisierten-kosten-des-schrumpfens-147 Zurück zur Übersicht

Dr. Ewa Palenga-Möllenbeck ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Migration, Transnationalismus, Geschlechterforschung sowie Domestic und Care Work, mit einem regionalen Fokus auf Deutschland und Osteuropa. Seit 2023 leitet sie das internationale Projekt „CareOrg – Researching the transnational organization of senior care, labor and mobility in Central and Eastern Europe“ (VW-Stiftung).