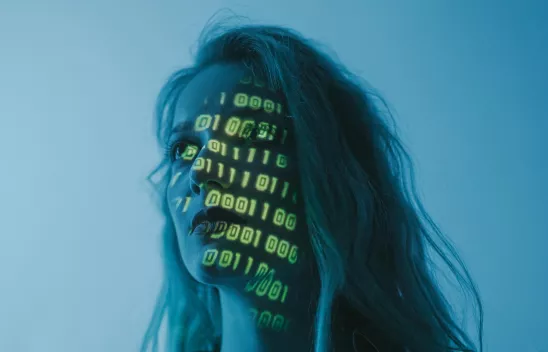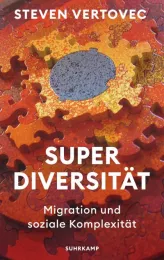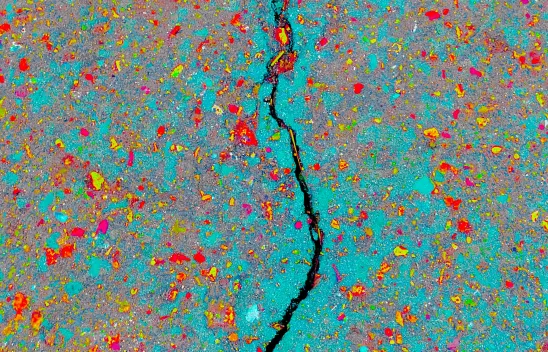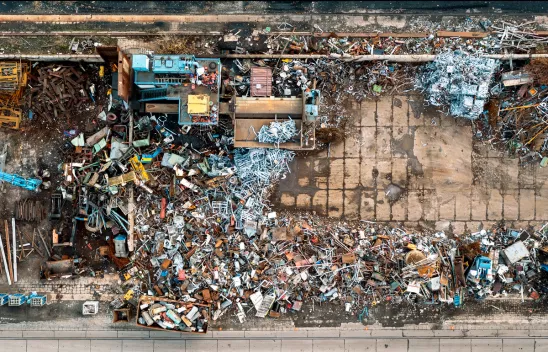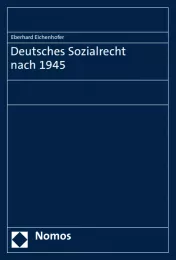Ruhestandsmigration: Pensioners welcome?
Interview: Kirsten Hoesch
An English version of this interview is available at socialpolicyworldwide.org.
Wir möchten heute über ein Thema sprechen, das einem vielleicht nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn man über Migration nachdenkt: die so genannte Ruhestandsmigration oder retirement migration. Wenn ich aus der deutschen Perspektive darauf blicke, dann erscheint das Bild von glücklichen Ruheständlern in spanischen Ferienorten, in sogenannten „Rentnerkolonien“, vor meinem geistigen Auge. Was unterscheidet diese Migration von anderen und warum forschst Du dazu?
Ruhestandsmigrant*innen werden tatsächlich immer als glückliche Sonnensuchende betrachtet und so wurden sie auch in der Forschung lange beschrieben. Bei dieser Migrationsart ist – anders als sonst in der Migrationsforschung – die Beziehung zwischen Migranten*innen und Wohlfahrtsstaat lange Zeit im Hintergrund geblieben. Dabei vergisst man aber, dass auch Ruhestandsmigrant*innen Sozialleistungen in Anspruch nehmen, mit zunehmendem Alter vor allem Gesundheitsleistungen.
Mit Blick auf andere Migrantengruppen sind sie schwer zu fassen. Sie befinden sich außerhalb der klassischen Gruppen der humanitären Migration und Familienzusammenführung. Als Nicht-Erwerbstätige unterscheiden sie sich aber gleichzeitig auch von Arbeitsmigrant*innen, die Inklusionschancen in den Wohlfahrtsstaat suchen. Deswegen werden sie in der Regel nicht als politisches Problem aufgefasst. Lange wurden sie als bevorzugte, willkommene Migrantengruppe betrachtet. Das hat sicherlich das Interesse für diese Gruppe gemindert und mein Interesse für sie gesteigert, weil Dinge oft nicht so sind, wie sie erscheinen. Und deswegen habe ich mich dafür interessiert, wie sich diese Migrant*innen in eine unwillkommene Migrantengruppe verwandeln konnten.
Bevor wir zu den Ursachen für diesen Wandel kommen, würde mich interessieren, welche Forschung es zu Ruhestandsmigrant*innen bereits gab, als Du begonnen hast dazu zu forschen. Wo sind die Schwerpunkte und wo Verbindungen zu Deinem Fokus?
Die Literatur hat sich lange mit dieser Migrantengruppe aus der Perspektive des Tourismus und des Lifestyles beschäftigt. Das Thema wurde eigentlich nur aus einer einzigen Perspektive betrachtet. Es gab zwar eine Menge Literatur über diese Migrant*innen, was sie machen, wie sie leben, wo sie leben, wie sie sich von anderen Migrantengruppen unterscheiden. Weniger relevant waren Fragen nach ihrer Vulnerabilität, ihrer Abhängigkeit von Sozialleistungen, insbesondere im ‚vierten‘ Alter, also im hohen Alter, wenn man stärker auf andere angewiesen ist.
Erst in letzter Zeit ist ein Interesse entstanden, inwiefern Ruheständler wohlfahrtsstaatliche Leistungen in den Zielländern in Anspruch nehmen und mit welchen Konsequenzen. Es ist über ihre transnationalen Praktiken geschrieben worden, über ihre Abhängigkeit von anderen Migrant*innen, wie zum Beispiel im Haushaltssektor. Mich interessiert vor allem die Beziehung zwischen Wohlfahrtsstaat und Ruheständlern, und zwar nicht nur, wie sie den Wohlfahrtsstaat nutzen, sondern auch wie sie den Wohlfahrtsstaat im Zielland verändern können.
In welcher Form nehmen denn Ruhestandsmigrant*innen wohlfahrtsstaatliche Leistungen in Spanien als wichtigem Zielland in Anspruch?
Ruhestandsmigrant*innen nehmen insbesondere Gesundheitsleistungen in Anspruch. Mit zunehmendem Alter werden sie abhängiger von medizinischer Versorgung und Pflege. Dabei vergisst man häufig, dass bei den älteren Ruhestandsmigrant*innen die Möglichkeiten und auch der Wille abnehmen, für Behandlungen ins Herkunftsland zurückzukehren. Sie brauchen Ärzte, Pflegepersonal und eine Praxis in der Nähe.
In Spanien kamen zwei Faktoren zusammen, die eine besondere Dynamik ausgelöst haben: Das staatliche spanische Gesundheitssystem und die Europäische Krankenversicherungskarte. Das staatliche spanische Gesundheitssystem steht grundsätzlich jeder Person offen, die nicht privat versichert ist. Für EU-Bürger*innen bedeutet das, dass sie recht einfach die Gesundheitsdienstleitungen in Anspruch nehmen können. Allerdings ist diese Nutzung mit der Europäischen Krankenversicherungskarte nur für kurze Aufenthalte und in dringenden Fällen vorgesehen, also im Rahmen von Reisen, nicht bei einem Daueraufenthalt mit einem andauerndem Behandlungsbedarf. Aber genau das passierte in Spanien: Die Karte wurde von EU-Migrant*innen benutzt, die die meiste Zeit dauerhaft in Spanien leben, ohne offiziell angemeldet zu sein, gleichzeitig aber ihre Rente aus ihrem Herkunftsland beziehen.
Also haben diese Migrant*innen eine Kombination aus Möglichkeiten des EU-Rechts und der spezifischen Gelegenheiten und Angebote des spanischen Wohlfahrtsstaats für sich genutzt?
Ja, genau. In Spanien spitzte sich die Situation im Jahr 2012 zu. Es waren immer mehr EU-Bürger*innen, insbesondere aus Großbritannien, nach Spanien gezogen, und zwar – das ist wichtig – ohne sich anzumelden. Und dann benötigten sie immer häufiger eine medizinische Behandlung. Damals meldete der spanische Rechnungshof in einem Bericht, dass es einen kontinuierlichen Missbrauch der Europäischen Krankenversicherungskarte seitens älterer, vorwiegend britischer Migrant*innen gab, weil sich diese Migrant*innen praktisch immer in Spanien behandeln ließen. Die meisten von ihnen lebten in Spanien, aber waren dort nicht offiziell gemeldet. Sie waren de facto da, aber nicht de jure. In diesem Zusammenhang meldete der Rechnungshof ein Ungleichgewicht zwischen den zu hohen Gesundheitsausgaben für EU-Patient*innen und der nicht kostendeckenden Erstattung durch andere EU-Herkunftsländer.
Welche Auswirkungen hatte dieser Bericht in der öffentlichen Debatte und in der Politik?
Das Medienecho war sehr stark. Es gab zahllose negative Presseberichte über die Anwesenheit dieser Migrant*innen und ihrer Nutzung des Gesundheitssystems. Spanien wurde als ein unvergleichliches Chirurgie-Paradies für europäische Ruheständler beschrieben – und als Europas Altenheim.
Dieser Wandel von den willkommenen zu den unwillkommenen Migrant*innen ist sehr interessant. Denn das ist ein Phänomen, das wir im Umgang mit anderen Migrantengruppen kennen, etwa unter den Stichworten Pull-Faktoren, welfare magnet, welfare chauvinism oder deservingness, d.h. es wird öffentlich diskutiert, ob Migrant*innen von Sozialleistungen angezogen werden und ob ihnen diese Leistungen überhaupt zustehen. Und dieser Diskurs, der eigentlich andere Gruppen betraf, wurde nun auf die zuvor gern gesehenen Ruhestandsmigrant*innen übertragen.
Die spanische Regierung hat darauf reagiert, indem sie ein Gesetz durch das Parlament brachte, das zum ersten Mal das Verfahren zum Nachweis der Versicherungsvoraussetzungen für nicht erwerbstätige EU-Bürger definierte sowie damit verbundene Rechte und Pflichten. Mit der Änderung sollte eine Sozialversicherungskarte dann nur noch für EU-Rentner*innen ausgestellt werden, die offiziell als Einwohner Spaniens registriert waren und eine Ausländernummer hatten.
Und hat das etwas verändert? Hatte diese Politik einen messbaren Effekt?
Das ist nicht eindeutig messbar, weil sich die Informationen zu den Kontrollen der Behörden auf alle EU-Bürger*innen beziehen, nicht nur die Ruheständler.
Die Prozedur ist auf jeden Fall viel, viel bürokratischer geworden. Das Wichtige hier ist aber auch, dass diese Norm eigentlich – auch wenn es nicht so ausgesprochen wurde – vor allem mit Blick auf die rund 300.000 in Spanien lebenden Brit*innen geschaffen wurde, weil sie das Gesundheitssystem am stärksten nutzten. Das Gesetz betrifft sie aber nun nicht mehr – denn durch den Brexit sind sie keine EU-Bürger*innen mehr und müssen sich ohnehin anders registrieren.
Aber natürlich hat das Gesetz in einer anderen Hinsicht Wirkung gezeigt, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung von Gesundheitsleistungen: Es hat die negative öffentliche Debatte und die negativen Presseberichte abrupt beendet.
Die britischen Ruhestandsmigranten*innen in Spanien sind eine wichtige Gruppe. Wie sieht es denn mit anderen retirement migrants aus? Gibt es andere interessante Beispiele?
Wenn man nun auf andere Zielländer von Ruhestandsmigration schaut, gibt es ganz andere interessante Entwicklungen. Man kann zum Beispiel Spanien als Zielland für Ruhestandsmigration nicht mit Italien vergleichen. In Italien gab es eine solche Debatte nicht. Aber dort gibt es eine gewissermaßen umgekehrte, sehr interessante Situation: Viele Italiener*innen sind mit ihrer Rente, die in Italien sehr stark besteuert wird, nach Portugal gezogen, weil Portugal lange Zeit die Niederlassung von europäischen Rentner*innen erlaubt hat, ohne ihre Rente zu besteuern. Das hat in Italien eine Riesen-Debatte ausgelöst, weil der damalige Präsident der italienischen Sozialversicherungsanstalt es für absolut inakzeptabel hielt, dass italienische Rentner*innen den italienischen Staat betrogen, indem sie mit ihrem ganzen Geld nach Portugal auswanderten. In diesem Fall war es nicht die Debatte über die Sozialleistungen, die EU-Rentner*innen in Italien beanspruchen könnten, sondern diese „Kapitalflucht“, die Rentenflucht von italienischen Rentner*innen nach Portugal.
Das scheint dann ja eine Kombination, eine Wechselwirkung im Dreieck EU-rechtlicher Rahmenbedingungen, spezifischer nationaler wohlfahrtsstaatlicher Merkmale und individueller Strategien zu sein. Ich finde das ist ein sehr interessantes Phänomen, weil man sieht, dass hinter dieser Lifestyle-Migration auch ganz klare finanzielle oder ökonomische Interessen stecken können und dabei die Möglichkeiten genutzt werden, die diese verschiedenen miteinander verwobenen Rechtsräume bieten.
Ja, das ist wirklich ein faszinierendes Thema. Portugal hat mittlerweile mit einer Gesetzesänderung reagiert. Seit Anfang des Jahres 2025 ist die Niederlassung ohne Besteuerung nicht mehr möglich. Schweden versucht auch diese Abwanderung schwedischer Rentner*innen nach Portugal zu stoppen.
Was man aber allgemein sieht, sind Versuche auf der nationalstaatlichen Ebene strenger zu regulieren. Man könnte es so sagen: Innerhalb dieses Raums der Freizügigkeit versuchen die EU-Staaten irgendwie – wie das Maurizio Ferrera bezeichnet hat – ein Mindestmaß an staatlicher Autonomie einzuführen. Da gibt es diese Spannung zwischen einerseits der Freizügigkeit und der Möglichkeit, dass man sich nach drei Monaten überall niederlassen kann, wenn man über ausreichende Mittel verfügt, und andererseits der Tatsache, dass EU-Länder versuchen, über eigene Gesetze ein Mindestmaß an Autonomie wieder einzuführen, um bestimmte Spill-over-Effekte zu vermeiden.
Welche Fragen würdest Du selber in Deiner Forschung gerne weiterverfolgen im Kontext von Ruhestandsmigration und Wohlfahrtstaat? Und welche international vergleichenden Perspektiven wären vielleicht noch aufschlussreich?
Ich würde sicherlich die Frage der Verbindungen zwischen den Wohlfahrtssystemen in den Zielländern und in den Herkunftsländern tiefer analysieren.
Und es wäre sehr interessant, dieselbe Migrantengruppe in zwei oder drei europäischen Ländern zu vergleichen, um zu untersuchen, wie sich dieses Zusammenspiel zwischen dem Gesundheitssystem im Herkunfts- und im Zielland abspielt, zum Beispiel bei Deutschen, die sich in Italien, Spanien oder Portugal niedergelassen haben.
Aber ich würde auch Vergleiche zwischen verschiedenen Migrantengruppen ziehen, um gewisse Kontextvariablen zu testen. Eine Kontextvariable ist Vertrauen. So hatten z.B. die Brit*innen immer die Tendenz, sich in Spanien behandeln zu lassen, während die deutschen Rentner*innen in der Regel versuchen, sich in Deutschland behandeln zu lassen. Hier sieht man, dass die Inanspruchnahme von Sozial- und Gesundheitsleistungen von weiteren Variablen abhängt, die auf der individuellen Ebene gemessen werden müssten: Dinge wie Vertrauen (in das Gesundheitssystem), aber auch Sprachkenntnisse. Im Falle britischer Migrant*innen haben auch die langen Wartelisten in Großbritannien, insbesondere für orthopädische oder Herz-OPs, eine Rolle gespielt.
Außerdem finde ich eine Erweiterung des Blickwinkels sehr interessant. Es sollte nicht nur untersucht werden, wie die Leistungen in Anspruch genommen werden, sondern auch, was die Migrant*innen für das Wohlfahrtssystem der Zielländer tun können, wie sich ihre Anwesenheit, ihr Verhalten auf den Wohlfahrtsstaat im Zielland auswirkt. Ein sehr interessantes Beispiel ist die Einführung der Hospizkultur in Spanien dank der britischen Ruheständler. Sterbebetreuung oder Palliativpflege fanden üblicherweise zu Hause oder im Krankenhaus statt. Aber die britischen Ruhestandsmigrant*innen haben diese Hospizkultur eingeführt. Sie gründeten ihre eigenen Hospizhäuser und haben es dann in einigen Fällen geschafft, dass diese in das spanische Gesundheitssystem eingegliedert wurden. In der Nähe von Malaga gibt es ein Hospiz, dessen Patient*innen jetzt zu 80 Prozent spanisch sind.
Das ist also eine sehr interessante, bisher wenig erforschte Frage: Wie kann die Anwesenheit älterer Migrant*innen die Wohlfahrtskultur, die Gesundheitsleistungskultur, die Betreuungskultur des Ziellandes verändern?
Vielen Dank für das Gespräch!
Weiterführende Literatur
Ferrera, M. (2016). The Contentious Politics of Hospitality: Intra-EU Mobility and Social Rights. European Law Journal. 22(6): 791-805.
Finotelli, C. 2021. Cross-border Healthcare in the EU: Welfare Burden or Market Opportunity? Evidence from the Spanish Experience. Journal of Common Market Studies, 59(3): 608-624, https://hdl.handle.net/20.500.14352/113192.
Finotelli, C. (2023). Turning the Welfare-Migration Nexus Upside-Down: The Case of European Retirees in Spain. In C. Finotelli, I. Ponzo (eds.) Migration Control Logics and Strategies in Europe. IMISCOE Research Series, Springer: 247-263. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26002-5
Claudia Finotelli 2025, Ruhestandsmigration: Pensioners welcome?, in: sozialpolitikblog, 13.02.2025, https://difis.org/blog/ruhestandsmigration-pensioners-welcome-152 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Claudia Finotelli ist Associate Professor am Department of Applied Sociology der Universidad Complutense de Madrid. Sie promovierte in Politikwissenschaft an der Universität Münster. Ihre Forschungsinteressen umfassen die Bereiche Migrationskontrolle, Integrationspolitik, Arbeitsmigrationspolitik, irreguläre Migration sowie Staatsbürgerschaft in vergleichender Perspektive mit einem besonderen Schwerpunkt auf Südeuropa.