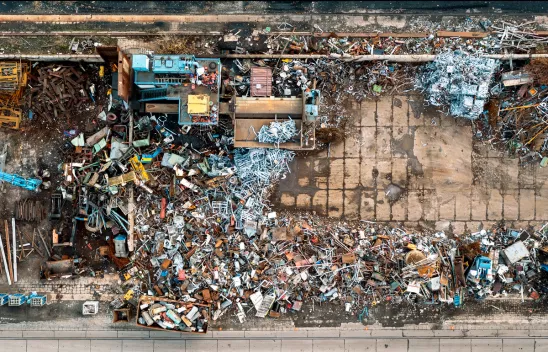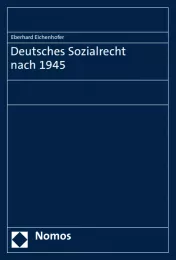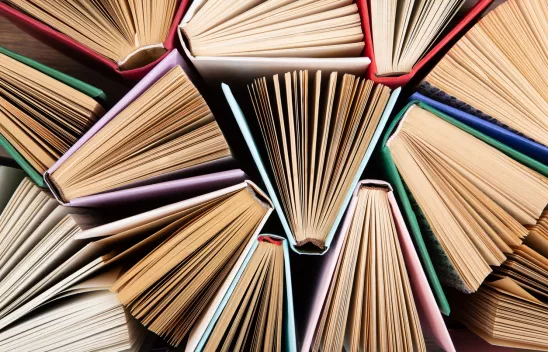Das Streikrecht auf der Suche nach einer neuen Wirklichkeit
Deutschland ist ein streikarmes Land. Und trotzdem wird das deutsche Arbeits- und Wirtschaftssystem ganz wesentlich durch die Potenzialität des Streiks und damit durch das Arbeitskampfrecht mitkonstituiert. Das Streikrecht bestimmt nicht nur wesentliche Funktionsbedingungen eines funktionierenden Tarifvertragssystems. Der Streik selbst ist auch ein zentrales Ausdrucksmittel der Beschäftigten in kollektiven Konflikten. Er bietet Möglichkeiten kollektiver Erfahrung von Widerstand, Emanzipation und Autonomie, wie sie die demokratische Ordnung nur zu ganz wenigen Gelegenheiten eröffnet.
Alle diese Funktionen und Chancen sind eng mit den „Störungen“ des normalen Verlaufs der Dinge verbunden, mit denen ein Arbeitskampf notwendig einhergeht; er bringt Nachteile und Gefahren nicht nur für die unmittelbar bestreikten Unternehmen hervor. Auch das deutsche Recht hatte deshalb lange Zeit große Mühe, die Legitimität und demokratische Produktivkraft des Arbeitskampfs anzuerkennen. Obwohl das Recht auf Streik mittlerweile verfassungsrechtlich anerkannt und arbeitsrechtlich geschützt wird, zeigen sich in der Rechtsprechung immer wieder Ambivalenzen vor allem in der Frage, wie viel Autonomie den gesellschaftlichen Akteuren zugestanden werden soll. Diese Ambivalenzen seien im Folgenden an den beiden Grundsatzurteilen des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aufgezeigt, die das deutsche Arbeitskampfrecht bis heute prägen:
Richterrechtliche Grundlagen
Das BAG-Urteil vom 10. Juni 1980 stellte entscheidende Weichen für das Arbeitskampfrecht in Deutschland. Mit dieser Entscheidung zur Auslegung des Art. 9 Abs. 3 GG (Grundgesetz) ließ das BAG die Nipperdey-Ära mit ihrer Vorverurteilung von Arbeitskämpfen als „unerwünscht“ klar hinter sich. Mit dem berühmten Satz, Tarifverhandlungen wären „ohne das Recht zum Streik im allgemeinen nicht mehr als ‚kollektives Betteln‘ (Blanpain)“, wurde die Asymmetrie zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerpositionen zur Grundlage rechtlicher Betrachtung des Arbeitskampfs. Arbeitgebermaßnahmen im Arbeitskampf sollten danach nur noch als Abwehr gegen besondere Streikstrategien, also nur unter besonderen Bedingungen der Erforderlichkeit rechtlich zulässig sein:
„Das Streikrecht wäre wirkungslos und das mit diesem Instrument angestrebte Verhandlungsgleichgewicht würde gestört, wenn die Arbeitgeber über wirksame Abwehrkampfmittel verfügten, die die Ausübung des Streikrechts mit einem untragbaren Risiko belasteten und dessen kompensatorische Kraft damit zunichte machen könnten.“
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) knüpfte am 19. Juni 2020 deutlich und teils wortwörtlich an die BAG-Entscheidung von 1980 an, indem es deren Grundannahmen der Asymmetrie zustimmte. In der BVerfG-Entscheidung von 2020 ging es um den neuen § 11 Abs. 5 AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), der es Gewerkschaften ermöglicht, den Einsatz von Leiharbeitnehmer*innen in Arbeitskämpfen gerichtlich untersagen zu lassen. Das BVerfG urteilte, die Norm sei verfassungsgemäß, denn der Gesetzgeber müsse nicht sehenden Auges hinnehmen, dass Streiks an Dauer zunehmen und dennoch kaum spürbare Auswirkungen zeigen, weil Arbeitgeber*innen „die Folgen eines Arbeitskampfes nahezu folgenlos abfangen“ könnten.
Dieser Fokus auf die Asymmetrie und damit indirekt auf die Parität in Tarifverhandlungen führt die Rechtsprechung aber auch oft weg vom Verständnis des Streikrechts als einem Freiheitsrecht und hin zu einem instrumentellen Verständnis. Dies zeigt sich vor allem in der großen Verantwortung für die Ordnung von Tarifverhandlungen und Arbeitskämpfen, die den Gewerkschaften übertragen wird. Schon das BVerfG-Urteil von 1995 mutete Gewerkschaften in vernetzten Industrien mit dem „jedenfalls derzeit“ für verfassungsgemäß erklärten § 160 Abs. 3 SGB III (früher § 116 Abs. 3 AFG) einiges zu. Mit der „Rührei-Theorie“ wertet das BAG zudem Arbeitskampfmaßnahmen schon dann als rechtswidrig, wenn sich auch nur eine der womöglich implizit aufgestellten (Tarif-)Forderungen als nicht tariflich normierbar herausstellt. Von Gewerkschaften wird so höchste Professionalität, präzises juristisches Arbeiten und geringe Risikobereitschaft eingefordert. Mit dem Tarifeinheitsgesetz (§ 4a Abs. 1 TVG) ist ihnen auch noch per Gesetz die Aufgabe übertragen worden, im Tarifvertrag jedenfalls bei Tarifpluralität einen für alle Arbeitnehmer*innen-Gruppen passenden „Gesamtkompromiss“ zu finden – eine dysfunktionale Verschiebung tarifpolitischer Aufgaben ins Tarifrecht.
Neue Arbeitskampfpraxen?
Diese Übersteigerung der Ordnungsverantwortung, die den Gewerkschaften zugewiesen wird, ist deshalb so irritierend, weil die Rechtsprechung an anderen Stellen durchaus gezeigt hat, dass sie die Krise verstanden hat, in der sich die Arbeitsbeziehungen in vielen Branchen befinden. Einen echten Wendepunkt stellte insofern das Grundsatzurteil des BAG vom 22. September 2009 dar („Flashmob“-Entscheidung). Hier lockerte das BAG festgefügte Vorstellungen davon, was einen Streik bzw. eine gewerkschaftliche Arbeitskampfmaßnahme ausmacht, in eine offene Zukunft hinein:
„Dem Schutz des Art. 9 Abs. 3 GG unterfällt nicht nur ein historisch gewachsener, abschließender numerus clausus von Arbeitskampfmitteln. Vielmehr gehört es zur verfassungsrechtlich geschützten Freiheit der Koalitionen, ihre Kampfmittel an die sich wandelnden Umstände anzupassen, um dem Gegner gewachsen zu bleiben und ausgewogene Tarifabschlüsse zu erzielen.“
Auch das BVerfG zeigt entsprechendes Problembewusstsein, z.B. in der Entscheidung vom 9. Juli 2020, in der es die Nutzung des Betriebsparkplatzes des Arbeitgebers (Amazon) für den Arbeitskampf erlaubte. Es sprach nicht mehr nur vom Streik, sondern bezog „gleich effektive Eskalationsstufen zur Herstellung von Kompromissfähigkeit“ in den Schutz mit ein.
Tatsächlich war die Aktionsform des „Flashmob“, die Anlass zu dem BAG-Urteil von 2009 gegeben hatte, Ergebnis einer schon lang andauernden und keineswegs abgeschlossenen gewerkschaftlichen Suche nach Kampfmitteln, mit denen noch wirksamer Druck ausgeübt werden kann. Hintergrund war eine Aktion der Gewerkschaft Verdi aus dem Jahr 2007, als diese große Schwierigkeiten hatte, im Einzelhandel so zu mobilisieren, dass die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch gebracht werden konnten. Verdi rief deshalb 40 bis 50 Kreuzberger und Friedrichshainer Anwohner*innen per SMS zur Teilnahme an einer Aktion auf, die einen Berliner Supermarkt durch abgebrochene Einkaufsversuche faktisch blockierte. In dem Urteil, das die BAG-Entscheidung zum Flashmob verfassungsrechtlich bestätigte, brachte das BVerfG dann gut auf den Punkt, welche Aspekte aus rechtlicher Sicht das „Atypische“ dieser Arbeitskampfform ausmachten: Der typische Arbeitskampf (= Streik) wird durch die betroffenen Arbeitnehmer*innen selbst durchgeführt; diese enthalten dem Arbeitgeber ihre Arbeitskraft vor und erhalten für diese Zeit kein Entgelt (sondern allenfalls Streikgeld von der Gewerkschaft). Der Streik enthalte so ein „Element unmittelbarer Selbstschädigung der Teilnehmenden in Form des Verlustes des Arbeitsentgelts“, das „einen (eigen-)verantwortlichen Umgang mit dem Arbeitskampfmittel fördern“ könne. Atypisch ist also vor allem die Beteiligung von Dritten, von nicht unmittelbar Betroffenen. Dadurch könne das Geschehen auch leichter „außer Kontrolle geraten, weil das Verhalten Dritter weniger beeinflussbar ist“. Das BVerfG kommuniziert hier relativ deutlich, weshalb Arbeitskämpfe der Autonomie und Experimentierphantasie der Koalitionen überlassen bleiben können, unter welchen Bedingungen also die richterliche Kontrolle zurücktreten kann.
Diese Begründung zeigt gleichzeitig auf, wo die Herausforderungen für das Arbeitskampfrecht in den kommenden Jahren liegen dürften. Denn gerade in Bereichen, die durch prekäre Arbeitsbedingungen geprägt sind, kann die Einbeziehung von Öffentlichkeit neue Arbeitskampfformen prägen. Dies gilt umso mehr, wenn das deutsche Arbeitskampfrecht seine enge Verklammerung mit der Tarifautonomie langsam lockern sollte. Aus Sicht des europäischen Rechts ist dies seit langem erforderlich, und das BAG stellte deshalb schon 2002 die ausschließliche Beschränkung des Streikrechts auf Kämpfe für tarifliche Ziele in Frage. Dennoch hält sich bis heute ein noch von Nipperdey überliefertes Verständnis des „Politischen“ als einem Gegensatz zum Kampf für bessere Arbeitsbedingungen. Gerade in Dienstleistungsbereichen und stark gesetzlich regulierten Branchen wie der Pflegebranche kann aber eine Öffnung des Arbeitskampfrechts für Proteststreiks und ähnliche Aktionen ein wichtiger Schritt zur (Wieder-)Erlangung kollektiver Handlungsfähigkeit sein. Gerade in (nicht zufällig) weiblich geprägten Bereichen der Sorgearbeit oder in migrantisch geprägten Protestmilieus der Plattformarbeit muss das Recht Barrieren abbauen, damit die Tariflandschaft fähig wird, die ganze gesellschaftliche Diversität der Arbeit abzubilden.
Nimmt man die Erkenntnis der Gerichte ernst, dass das Recht unter geänderten gesellschaftlichen Umständen die Entwicklung neuer Kampfformen anerkennen muss, bedarf es auch aus rechtlicher Sicht einer Reflektion der Rolle der Öffentlichkeit in Arbeitskämpfen. Je stärker die Öffentlichkeit in Auseinandersetzungen einbezogen wird, desto mehr bedarf es der Akteure, die in diesen Prozessen Verantwortung übernehmen, insbesondere dafür, dass Ziele klar kommuniziert werden, die Rechte aller Betroffenen respektiert werden und die Verhältnismäßigkeit gewährleistet bleibt. Dann kann und muss die rechtliche Kontrolle sich zurücknehmen und auf Prozesse gesellschaftlicher Autonomie vertrauen. Um auf diese Herausforderungen vorbereitet zu sein, müssen Gewerkschaften aber in der Lage sein, die Öffentlichkeit in all ihrer Diversität wirksam anzusprechen.
Anmerkung:
zur (vermuteten) Herkunft des Ausdrucks bei Blanpain siehe Gregor Thüsing, ZIP 2003, 693 (701 [dort in Fn. 69]).
Eva Kocher 2022, Das Streikrecht auf der Suche nach einer neuen Wirklichkeit, in: sozialpolitikblog, 02.06.2022, https://difis.org/blog/das-streikrecht-auf-der-suche-nach-einer-neuen-wirklichkeit-3 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Eva Kocher ist seit 2009 Professorin für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) sowie Gründungsmitglied des Deutschen Instituts für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (DIFIS). Sie ist Leiterin des Center for Interdisciplinary Labour Law Studies (C*LLaS). Sie war Vorsitzende der Zweiten Gleichstellungskommission der Bundesregierung. 2024 erschien Ihre Open-Access-Veröffentlichung „Das Andere des Arbeitsrechts“, deren Gedanken dieser Blog weiterführt.