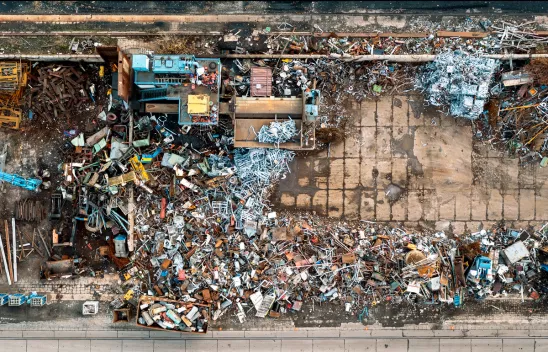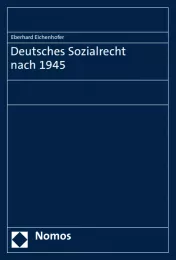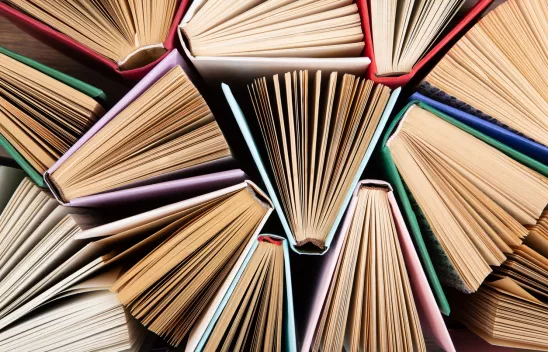Und ewig grüßt das Murmeltier? Die Reform der Altersabsicherung von Selbstständigen
„Ich hoffe, dass ich noch ziemlich lange nähen kann.“, erklärte eine solo-selbstständige Modedesignerin, die ich während eines Interviews zu ihrer sozialen Absicherung befragte, darunter auch zu ihrer Altersvorsorge (Manske, 2016). Mit ihrer Antwort gab sie der Hoffnung Ausdruck, bis zu ihrem Lebensende arbeiten zu können.
Die Modedesignerin ist kein Einzelfall. Sie ist ein Beispiel für jenes Drittel aller Soloselbstständigen, die keinerlei Altersvorsorge betreiben, die nicht in Besitz von Aktienvermögen sind, und auch kein Erbe erwarten, mit dem sie einen sorglosen Ruhestand bestreiten könnten. Bei gering qualifizierten oder ungelernten Soloselbstständigen liegt diese Quote sogar bei über 40 Prozent (Brenke, 2016, S. 1072).
Es sind vor allem Soloselbstständige, das heißt Selbstständige, die alleine arbeiten, die mit der Ungewissheit leben, wie sie ihr Alter finanzieren sollen und ob sie das aus eigener Kraft schaffen. Dabei soll die Altersrente im Sozialversicherungsstaat eigentlich nicht nur Altersarmut verhindern. Sie hat eine Einkommensersatzfunktion und soll den Lebensstandard sichern. Ob der Lebensstandard im Alter aufrechterhalten werden kann, hängt von der Höhe und der Dauer der Beitragszahlung ab. Doch für viele Soloselbstständige ist ein Sturz in die Altersarmut erwartbar. Was steckt sozialpolitisch dahinter?
Das komplizierte Dickicht der Alterssicherung
Seit der Installierung der Invaliditäts- und Alterssicherung, die unter Kanzler Bismarck im Deutschen Reichstag im Jahr 1889 verabschiedet wurde, ist die Alterssicherung im deutschen Sozialversicherungssystem von Partikularinteressen durchzogen. Und sein kompliziertes Regeldickicht sucht im internationalen Vergleich seinesgleichen.
Die Scheidelinie der Altersrente verlief von jeher zwischen abhängig Beschäftigten und Selbstständigen. Schon bei abhängig Beschäftigten nicht unkompliziert, ist die alterspolitische Gesetzeslage bei Selbstständigen ein historisch wild gewachsener Flickenteppich. Alterspolitische Sonderregeln gelten beispielsweise für Hebammen, Seelotsen, Küstenfischer, Lehrer*innen und Journalist*innen, die alle nach berufsspezifischen Kriterien zu ihrer Altersvorsorge gesetzlich verpflichtet sind. Weitere Sonderregeln existieren für die alten Professionen, die ihren hohen gesellschaftlichen Status in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts in eine privilegierte Standesversicherung mit eigenen Versorgungssystemen ummünzen konnten, zum Beispiel Medizin, Jura, Pharmazie.
Das Statistische Bundesamt drückt den Sachverhalt so aus: „Versicherungspflichtig sind alle Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind. Zu den Pflichtversicherten gehören auch bestimmte Gruppen von Selbstständigen (z. B. selbstständig tätige Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher, Handwerkerinnen und Handwerker, Hebammen und Entbindungspfleger).“ (Statist. Bundesamt, 2019, S. 259). Ein knappes Drittel aller Selbstständigen ist pflichtversichert (Bonin et al., 2022, S. 56). Die überwiegende Mehrheit der Selbstständigen ist also nicht obligatorisch gegen das Alter versichert. Sie ist auf alterspolitische Eigenverantwortung angewiesen. Während dies zu Bismarcks Zeiten als gesellschaftspolitisches Privileg galt, liegt heute auf der Hand, dass sich hier ein gesellschaftliches Problempotenzial aufgebaut hat – immerhin sind etwa zehn Prozent aller Erwerbstätigen selbstständig, in absoluten Zahlen sind das etwa 4 Millionen Menschen, davon ca. 2,2 Millionen Soloselbstständige und 1,8 Millionen Selbstständige mit Beschäftigten (Bonin et al., 2022, S. 9).
Soloselbstständige – (fast) ohne Altersvorsorge
Lange wurde angenommen, dass Selbstständige keinen sozialpolitischen Schutzbedarf haben, da sie – so die ins 19. Jahrhundert zurückreichende Idee – Teil der (groß-)bürgerlichen (Unternehmer-)Klasse seien. Das ist heute anders. Während die Gesamtanzahl der Selbstständigen seit den 1990er Jahren um wenige Prozentpunkte schwankt, hat sich ihre soziodemografische Zusammensetzung drastisch gewandelt. Mehr als jede*r zweite Selbstständige ist heute solo-selbstständig (Bonin et al., 2022). Ein weiterer Aspekt des Wandels der Arbeitswelt besteht darin, dass Soloselbstständige nur selten in traditionellen Berufen arbeiten, sondern eher in neueren Berufen (zum Beispiel Plattformökonomie), neu entstandenen oder expandierenden Erwerbsfeldern mit traditionell unsteten Erwerbsformen (zum Beispiel Kultur- und Kreativsektor) und/ oder in Bereichen der Arbeitswelt, die stark von Rationalisierung und Outsourcing infolge ökonomischer Umstrukturierungen betroffen sind (zum Beispiel im Gesundheitsbereich) (Graf et al., 2019; Manske, 2007).
Ferner sind Soloselbstständige in ökonomischer Hinsicht sehr heterogen aufgestellt: Es gibt sehr Gutverdienende, der Löwenanteil jedoch arbeitet und lebt oft prekär und hat kaum bis keine finanzielle Reserven. Dabei können sich Selbstständige freiwillig bei der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV Bund) versichern. Die freiwillige Versicherung nutzen derzeit rund 210.000 Personen, ein Teil davon sind Selbstständige. Die Gründe, weshalb die freiwillige Versicherung von so wenigen der rund zwei Millionen Soloselbstständigen genutzt wird, liegen bislang eher im Dunkeln. Angenommen wird, dass dies an unsteten und vielfach unterdurchschnittlichen Einkommen sowie niedriger Sparfähigkeit liegt. Zu berücksichtigen ist hierbei auch eine große Leidenschaft für die eigene Arbeit, die ihre sozialpolitischen Folgen bisweilen in den Hintergrund treten lässt. Die Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie etwa spricht von „passionate work“, die die Betroffenen dazu verleitet, in eigentlich prekären Arbeitsverhältnissen zu verharren (McRobbie, 2016). Dem steht ein phlegmatischer Sozialstaat mit weitgehend überlebten Normalitätsannahmen gegenüber. So ist es für viele Soloselbstständige – aber nicht nur für sie – nahezu aussichtslos, dem sozialpolitischen ‚Normallebenslauf‘ mit seinen angenommenen 35 bzw. 45 Beitragsjahren bis zur Durchschnittsrente Genüge zu tun.
Insbesondere die Soziallage von nicht versicherungspflichtigen Soloselbstständigen gilt als zugespitzte erwerbsbiografische Risikokonstellation. Wie sie damit umgehen und wie sie, wenn überhaupt, für ihr Alter vorsorgen, ist kaum bekannt. Es fehlt schlichtweg an empirischen Studien.
Selbstständige in die Rentenversicherung – aber nicht alle
Doch es tut sich was: Der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition aus dem Jahr 2021 plant die Einführung einer verpflichtenden Altersvorsorge für Selbstständige. Damit knüpft die Ampel an den Vorschlag der Vorgängerregierung, der großen Koalition unter Kanzlerin Merkel an (Große Koalition, 2018, S. 92). Die GroKo schrieb in Bezug auf eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige noch recht locker von „wir wollen“, die Ampel dagegen verspricht: „wir werden“. Die Frage ist jedoch, inwieweit dieser politische Plan das große Bild verändert, also die Alterssicherung auf neue Füße stellt, oder ob sie der Bismarck’schen Logik verhaftet bleibt.
Die Antwort überrascht vielleicht: Etwas soll sich ändern, das meiste nicht. Auffällig ist unter anderem, dass Selbstständige als eine staatsbedürftige, sozial vulnerable Gruppe betrachtet werden. Geplant ist die Einführung einer verpflichtenden Altersvorsorge mit Wahlfreiheit. Wie diese verpflichtende Altersvorsorge konkret aussehen wird, ist noch nicht klar. Der Koalitionsvertrag äußerst sich hierzu nicht. Dokumentiert ist bislang folgende politische Absicht.
„Wir werden für alle neuen Selbstständigen, die keinem obligatorischen Alterssicherungssystem unterliegen, eine Pflicht zur Altersvorsorge mit Wahlfreiheit einführen. Selbstständige sind in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, sofern sie nicht im Rahmen eines einfachen und unbürokratischen Opt-Outs ein privates Vorsorgeprodukt wählen. Dieses muss insolvenz- und pfändungssicher sein und zu einer Absicherung oberhalb des Grundsicherungsniveaus führen. Bei jeder Gründung gilt jeweils eine Karenzzeit von zwei Jahren. Die geförderte zusätzliche private Altersvorsorge steht allen Erwerbstätigen offen.“ (Ampel-Koalitionsvertrag, 2021, S. 75).
Was können wir festhalten? Geplant ist eine Pflichtversicherung mit Wahlfreiheit für „neue“ Selbstständige, wobei die Passage aus dem Koalitionsvertrag nahelegt, dass damit Gründer*innen gemeint sind. Gründer*innen also sollen nach einer zweijährigen Karenzfrist pflichtversichert werden. Es sei denn, sie versichern sich solide privat, oder sie gründen sich alle zwei Jahre neu und profitieren von der zweijährigen, versicherungspflichtfreien Karenzfrist. Der Vorschlag bezieht sich also nur auf eine kleine Auswahl an Selbstständigen. Zudem folgt er der traditionellen Struktur des deutschen Sozialversicherungssystems, das zwischen Pflichtversicherten und freiwillig Versicherten unterteilt.
Alle weiteren Bestimmungen und Regeln sind der Öffentlichkeit noch nicht weiter bekannt. Dies betrifft auch die sensible Frage nach der Höhe der Beiträge, da pflichtversicherte Selbstständige bislang mindestens 305,97 Euro pro Monat für ihre gesetzliche Altersversicherung entrichten müssen (ermäßigter Beitrag für Gründer*innen, der aktuell nach zwei Jahren auf gute 600 Euro steigt). Wohlweislich hält sich der Koalitionsvertrag zum Thema Beiträge bedeckt.
Hubertus Heil, bitte kommen
Zwischenzeitlich ist zu konstatieren, dass sich die angestrebte Pflichtversicherung im Kern als allgemeine Versicherungspflicht für einen Teil der Selbstständigen entpuppt. Damit wäre ein Schritt in Richtung einer allgemeinen Sozialversicherung getan. Doch nur ein kleiner. Das Prinzip von Pflichtversicherung versus freiwilliger Absicherung bliebe erhalten, die vielen verschiedenen Sonderregeln und Versorgungssysteme auch. Der historisch gewachsene Flickenteppich der Alterssicherung würde weiter anwachsen. Die Reformidee der Ampelkoalition würde die alterspolitische Gesamtsituation nicht transparenter gestalten, sondern verkomplizieren.
Doch möglicherweise erübrigt es sich ohnehin, an einer potenziellen Alterssicherung der Selbstständigen weiter zu tüfteln. Denn wie die FDP verlautbaren ließ, soll die Kindergrundsicherung die letzte, große sozialpolitische Reform in dieser Legislaturperiode gewesen sein. Das lässt nichts Gutes hoffen für eine zeitnahe Umsetzung der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. Was sagt eigentlich der Arbeits- und Sozialminister dazu?
Literatur
Ampel-Koalitionsvertrag. (2021). Ampel-Koalitionsvertrag 2021-2025: Bd. MEHR FORTSCHRITT WAGEN BÜNDNIS FÜR FREIHEIT, GERECHTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT (1. Aufl.). SPD.de Gründe.de FDP.de.
Bonin, H., Krause-Pilatus, A., & Rinne, U. (2022). Selbstständige Erwerbstätigkeit in Deutschland (Aktualisierung 2022) (Expertise Forschungsbericht 601). Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Brenke, K. (2016). Die allermeisten Selbständigen betreiben Altersvorsorge oder haben Vermögen (45; DIW Wochenbericht, S. 1071–1076). Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).
Graf, S., Höhne, J., Mauß, A., & Schulze Buschoff, K. (2019). Mehrfachbeschäftigungen in Deutschland: Struktur, Arbeitsbedingungen und Motive (Research Report 48). WSI Report. https://www.econstor.eu/handle/10419/225411
Große Koalition, C., CSU, SPD. (2018). Koalitionsvertrag „Große Koalition“: Bd. Ein neuer Aufbruch für Europa Eine neue Dynamik für Deutschland Ein neuer Zusammenhalt für unser Land (1. Aufl.). CDU/CSU, SPD.
Manske, A. (2007). Prekarisierung auf hohem Niveau: Eine Feldstudie über Alleinunternehmer in der IT-Branche (1. Auflage). Rainer Hampp Verlag. https://doi.org/10.1688/9783866181724
Manske, A. (2016). Kapitalistische Geister in der Kultur- und Kreativwirtschaft: Kreative zwischen wirtschaftlichem Zwang und künstlerischem Drang. In Kapitalistische Geister in der Kultur- und Kreativwirtschaft. transcript. https://doi.org/10.1515/9783839420881
McRobbie, A. (2016). Be creative: Making a living in the new culture industries. Polity Press.
Statist. Bundesamt (Hrsg.). (2019). Statistisches Jahrbuch. Deutschland und Internationales 2019 (Redaktionsschluss 1. August 2019). Statistisches Bundesamt.
Alexandra Manske 2023, Und ewig grüßt das Murmeltier? Die Reform der Altersabsicherung von Selbstständigen, in: sozialpolitikblog, 21.09.2023, https://difis.org/blog/und-ewig-gruesst-das-murmeltier-die-reform-der-altersabsicherung-von-selbststaendigen-77 Zurück zur Übersicht

Dr. phil. habil. Alexandra Manske ist Soziologin an der Universität Hamburg. Forschungsschwerpunkt: Wandel von Arbeit und Gesellschaft. Mit einer Reihe von Publikationen und Projekten rückt sie das Thema Kultur- und Kreativökonomie als Drehscheibe des arbeitsgesellschaftlichen Wandels in den Fokus. Wissenschaftliche Sachverständige, z. B. Deutscher Gewerkschaftsbund, Kommission für Basishonorare, Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Aktuelle Schriften: Neue Solidaritäten (transcript); Theorien der Arbeit (mit Wolfgang Menz, Junius). Kontakt: dr.a.manske@gmail.com
Bildnachweis: Privat