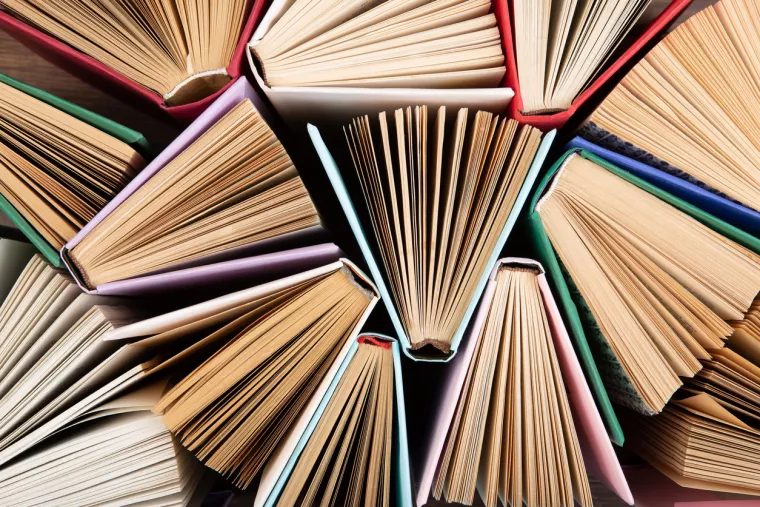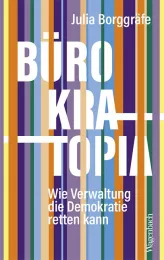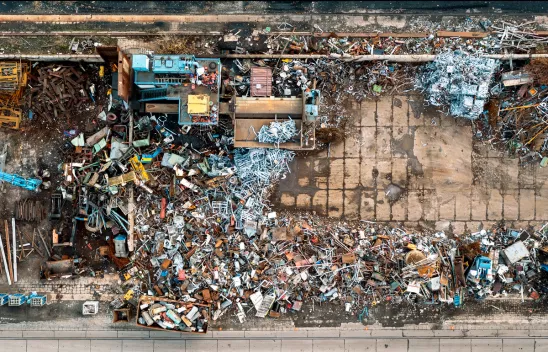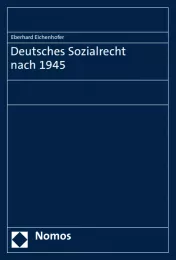Weiter so für die Weiterbildung?
Der Bundestag hat ein Gesetz für die Reform der Weiterbildung beschlossen. Was sich dadurch für Betriebe und Beschäftigte verändert, was Interessenverbände an dem Gesetz kritisieren und ob die Reform Weiterbildung nachhaltig stärkt, diskutiert Prof. Dr. Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel.
Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation verändern Strukturen ganzer Regionen und Branchen. Parallel dazu, dass viele neue Arbeitsplätze entstehen und viele Jobs wegfallen, ändern sich auch Tätigkeitsprofile und Qualifikationsanforderungen. Hinzu kommt, dass in zahlreichen Branchen schon heute viele Fachkräfte fehlen. Ein Schlüssel, um diese parallel stattfindenden Prozesse positiv zu beeinflussen wird in einem guten System der Aus- und Weiterbildung gesehen. Deswegen wird seit längerem gefordert, die Weiterbildung als vierte Säule des Bildungssystems zu etablieren (Pothmer et. al. 2019: 16).
Die Ausgaben für Weiterbildung sind in den zurückliegenden Jahren stets gestiegen, ebenso die Anzahl derjenigen, die an Weiterbildung partizipieren. Trotzdem bestehen in Deutschlands unübersichtlichem und fragmentiertem Weiterbildungswesen viele Defizite. So nehmen Beschäftigte aus kleinen und mittleren Unternehmen weniger häufig an Weiterbildungen teil. Ebenso werden die Fördervoraussetzungen von vielen Beteiligten immer noch als sehr kompliziert wahrgenommen. Hinzu kommt, dass trotz Fachkräftemangels viele Bewerber*innen keinen Ausbildungsplatz finden. Vielen jungen Menschen misslingt der Übergang von der Schule in eine Ausbildung. Die Bundesregierung legte daher einen Entwurf für ein neues „Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung“ (Weiterbildungsgesetz) vor, der am 23. Juni 2023 vom Bundestag in leicht geänderter Fassung beschlossen wurde.
Das Bildungszeitgeld hat es nicht ins Gesetz geschafft
Insgesamt lassen sich im Gesetz vier Reformschwerpunkte ausmachen: Erstens wird ein Qualifizierungsgeld eingeführt. Dieses erhalten Beschäftigte in Betrieben, die besonders stark vom Strukturwandel betroffen sind und für die eine Weiterbildung erforderlich ist, um weiter beschäftigt zu werden. Der Entgeltersatz entspricht der Höhe des Kurzarbeitergeldes, also 60 (bzw. 67) Prozent des Nettoentgeltes.
Zweitens wird die sogenannte Ausbildungsgarantie eingeführt, um „allen Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung“ zu ermöglichen (SPD et al.: 52). Es handelt sich dabei aber nicht um einen Rechtsanspruch, sondern um verbesserte Unterstützungsangebote, die von allen Akteuren des Ausbildungsmarktes getragen werden. Unterstützend wird zusätzlich ein Mobilitätszuschuss eingeführt, der angehenden Auszubildenden dabei helfen soll, mobil zu sein, um gegebenenfalls auch in einer anderen Region eine Ausbildung zu starten. Darüber hinaus sind kurze, geförderte, ausbildungsvorbereitende Praktika zur Orientierung von Jugendlichen nach Vollendung der Vollzeitschulpflicht, Neuregelungen bei der Einstiegsqualifizierung und eine Stärkung der außerbetrieblichen Ausbildungsangebote vorgesehen.
Drittens wird die bestehende Weiterbildungsförderung (§ 82 SGB II) für Beschäftige vereinfacht, transparenter und für Arbeitgeber planungssicherer gemacht.
Das vierte Reformfeld bezieht sich auf die Kurzarbeit. Bei der beruflichen Weiterbildung, die während der Kurzarbeit stattfindet, ist nun eine verlängerte Erstattung der Kurzarbeit möglich. Damit wird die Erweiterung des Beschäftigungssicherungsgesetz (§ 106a SGB III), welches 2020 mit dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz eingeführt wurde, bis zum 31. Juli 2024 verlängert.
Die im Referentenentwurf ursprünglich vorgesehene Einführung einer Bildungs(teil)zeit und eines Bildungszeitgeldes – nach österreichischem Vorbild – wird vorerst nicht umgesetzt. Durch diese sollten Beschäftigte nach Absprache mit dem Arbeitgeber für eine arbeitsbezogene Weiterbildung (für einen Teil der Arbeitszeit) freigestellt werden und eine entsprechende Entgeltersatzleistung erhalten.
Wissenschaft und Interessenverbände bewerten die Reform
Die Vorhaben des Weiterbildungsgesetzes werden im Detail sehr unterschiedlich bewertet. Das Qualifizierungsgeld wird als Chance gesehen, Beschäftigten, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, Sicherheit zu geben, indem ein teilweiser Entgeltersatz während der Weiterbildung geleistet wird. Hervorgehoben wird auch, dass das Qualifizierungsgeld unabhängig vom Alter, Qualifikation oder Betriebsgröße gezahlt wird (HBS 2023). Das Qualifizierungsgeld kann anders als die Förderung von Weiterbildung (§ 82 SGB III) insbesondere für größere Betriebe attraktiv sein, weil die Förderhöhe nicht mit der Unternehmensgröße sinkt. Lehrgangskosten (§ 82 SGB III) werden allerdings nicht übernommen. Sie sind vom Arbeitgeber zu tragen (Dietrich et al. 2023: 8). Dass keine Maßnahmenzertifizierung beim Qualifizierungsgeld stattfindet, erleichtere Unternehmen passgenauere Weiterbildungsangebote zu finden und die Weiterbildungsbedarfe schneller umzusetzen (Biedermeier et al. 2023; Dietrich et al. 2023). Demgegenüber kritisieren vor allem kleine und mittelständische Betriebe die Mindestdauer von 120 Stunden für Weiterbildungsangebote, bei denen sie ihre Beschäftigten freistellen müssen, als zu lang (Biermeier et al. 2023; Dietrich et al. 2023: 8).
Die Ausbildungsgarantie kann dabei helfen, Jugendliche mit schlechtem oder ohne Schulabschluss zu aktivieren, zu stärken und ihnen dadurch eine bessere Möglichkeit für einen Ausbildungsplatz zu verschaffen. Die Betriebsnähe der Ausbildungsgarantie wird von vielen Beobachter*innen positiv bewertet, so auch von Wissenschaftler*innen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Herausforderungen ergeben sich in der genauen Bestimmung und Messung von berufsfachlichen, regionalen und qualifikatorischen Disparitäten. Ebenso bleibt die Umsetzung des Mitteleinsatzes für die jeweiligen Regionen, die mit Ausbildungsplätzen unterversorgt sind, derzeit unklar, weil die Betriebe nicht so viele Plätze anbieten. Des Weiteren ist die inhaltliche Ausrichtung der Ausbildungsgarantie in den Betrieben im Gesetz nur vage beschrieben. Eine mittelfristige Orientierung an Engpassberufen wird dabei empfohlen, birgt aber die Gefahr von vermehrten Abbrüchen, wenn die Interessen und Fähigkeiten der jungen Erwachsenen nicht mit diesen Berufen übereinstimmen (Dietrich et al. 2023: 12f.). Der Mobilitätszuschuss kann dafür sorgen, dass junge Menschen Ausbildungsangebote in entfernt liegenden Regionen annehmen. Jedoch haben junge Menschen mit niedrigeren Schulabschlüssen eine geringere Mobilitätsbereitschaft (Bundesinstitut für Berufsbildung 2019: 236) und realisieren regionale Mobilität seltener (Bosch et al. 2022), weshalb diese Personengruppe voraussichtlich den Zuschuss nur selten in Anspruch nehmen wird.
Die Praktikumsinitiative soll die Vermittlungsbemühungen flankieren. Durch die geförderten ausbildungsvorbereitenden Praktika könne – laut Bundesregierung – die Abbruchquote bei der Ausbildung reduziert werden. Die Ergänzung der Ausbildungsförderung durch die Einstiegsqualifizierung erscheint plausibel. Offen bleibt jedoch, wie Betriebe für die Idee gewonnen werden, Jugendlichen, denen sie keinen Ausbildungsplatz anbieten wollen, weil diese zum Beispiel nicht gut qualifiziert sind, stattdessen eine Einstiegsqualifizierung anzubieten (Dietrich et al. 2023: 14). Die Erweiterung außerbetrieblicher Ausbildungsangebote stellt laut IAB eine sinnvolle Maßnahme dar, aber nur wenn alle anderen Bemühungen keinen Erfolg zeigen. Auch in der Begründung des Gesetzes wird die außerbetriebliche Weiterbildung von der Bundesregierung als „Ultima Ratio“ beschrieben (Deutscher Bundestag 2023: 4).
Die Möglichkeit des Arbeit-von-Morgen-Gesetzes, die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge erstatten zu lassen, die während der Kurzarbeit alleine durch den Arbeitgeber zu tragen waren, wurde bisher wenig genutzt. Die Verlängerung der Erstattungen könnte dazu führen, dass mehr Betriebe die Sonderregelung in Anspruch nehmen (Dietrich et al. 2023: 11).
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) sehen im Detail aber auch Änderungsbedarf an dem neuen Gesetz. Beispielsweise in der Ausbildungsgarantie sehen die beiden größere Anpassungen. Der DGB möchte eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie mit einem tatsächlichen Rechtsanspruch und die BAGFW eine inklusive Ausgestaltung.
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) sieht die nicht umgesetzte Bildungs(teil)zeit als großes Defizit der Reform. Diese hätte dafür sorgen können, dass die Beschäftigten die nötige Zeit für Qualifizierungsmaßnahmen bekommen, um ihre berufliche Entwicklung unabhängiger von den konkreten Bedarfslagen des eigenen Unternehmens in die Hand nehmen zu können (HBS 2023). Allerdings zeigen die Erfahrungen aus Österreich, dass insbesondere höherqualifizierte Beschäftigte die dortige Bildungszeit und Bildungskarenz wahrnehmen, also eine Gruppe, die ohnehin eine höhere Weiterbildungsbeteiligung hat (Leber et al.: 2022). Zudem ist strittig, ob die Höhe des Bildungszeitgeldes in Höhe von 60/67 Prozent der durchschnittlichen Nettoentgeltdifferenz ausreicht, um Weiterbildungsanreize gerade bei niedrigen Einkommensgruppen zu setzen. Ein Vorschlag, hier nachzubessern, sind monatliche Prämien (Osiander/Dietz 2016). Auch die Arbeitnehmerorganisationen bemängeln, dass sich die Bildungs(teil)zeit nicht mehr im neuen Gesetz wiederfindet. Während der DGB die Streichung der Bildungs(teil)zeit im Regierungsentwurf kritisiert, befürchtet die BAGFW, dass dieses Instrument in der vorgeschlagenen Form bestehende Benachteiligungen kaum abmildere und zudem kaum in Anspruch genommen werden würde, obwohl sie diese grundsätzlich befürwortet (BAGFW 2023; Räder et al. 2023).
Die Arbeitgeberverbände befürworten hingegen, dass diese Maßnahme gestrichen wurde. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert, dass die Bildungs(teil)zeit steuerfinanziert sein sollte, das Qualifizierungsgeld lehnen sie ab. Der Handelsverband Deutschland (HDE) spricht gar davon, dass das neue Gesetz die Weiterbildung weiter verkompliziere. Ebenso wird auch das Qualifizierungsgeld als überflüssiges und verkomplizierendes Instrument bewertet (BDA 2023; HDE 2023).
Die Reform ist ein Fortschritt, aber nicht der große Wurf
Die beschlossene Gesetzesnovelle kann als Fortschritt begriffen werden. Mehr Menschen können zu günstigeren Bedingungen an Weiterbildung und Ausbildung partizipieren, auch wenn vor allem Beschäftigte größerer Unternehmen profitieren dürften. Mit der neuen Ausbildungsgarantie könnte zudem die Zahl der jungen Menschen ohne Ausbildung reduziert werden. Insofern haben wir es mit einem neuen Baustein gegen den Fachkräftemangel und für eine passgenauere Arbeitsgesellschaft zu tun. Die Rezeption des Gesetzes ist eher positiv, wenngleich zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern die üblichen Differenzen sichtbar sind. Die Gesetzesänderung ist zwar noch nicht der große Wurf, der den Weg hin zur Weiterbildung als vierte Säule des deutschen Bildungssystems darstellt. Es ist auch unklar, ob dieses Gesetz dazu beitragen kann, einen Weg hin zu einem systematischeren und transparenteren System der Weiterbildung zu beschreiten. Wichtig ist aber, dass die Weiterbildung zunehmend eine höhere Wertschätzung erfährt und der Gesetzgeber die Weichen für ein besseres Weiterbildungswesen stellt, indem er die Bedingungen der Teilnahme sukzessive verbessert.
Literatur
Biermeier, Sandra/ Dony, Elke/ Greger, Sabine/ Leber, Ute/ Schreyer, Franziska/ Strien,
Karsten (2023). Warum Betriebe die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte bislang
eher wenig nutzen. IAB-Forum, Online unter: https://www.iab-forum.de/warum-betriebe-die-weiterbildungsfoerderung-fuer-beschaeftigte-bislang-eher-wenig-nutzen/, letzter Zugriff: 10.05.2023.
Bosch, Gerhard/ Dietrich, Hans/ Nagel, Bernhard/ Wedemeier, Jan/ Werner, Dirk/ Wieland,
Clemens (2022). Abschlussbericht der Expertenkommission zur Einführung eines
umlagefinanzierten Landesausbildungsfonds in der Freien Hansestadt Bremen. Bremen.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) (2023). Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung und Einführung einer Bildungszeit, Online unter: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Stellungnahmen/weiterbildungsgesetz-bagfw.pdf?__blob=publicationFile&v=3, letzter Zugriff: 17.05.2023.
Bundesinstitut für Berufsbildung (2019). Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2019. Informationen und Analysen zur beruflichen Bildung. Bonn.
Bundesregierung (2023). Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung, Online unter: https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/weiterbildungsgesetz.html, letzter Zugriff: 11.05.2023.
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) (2023). Weiterbildungsförderung einfacher und nicht komplizierter machen – Bildungs(teil)zeit aus Steuermitteln finanzieren: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung und Einführung einer Bildungszeit (Weiterbildungsgesetz), Online unter: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Stellungnahmen/weiterbildungsgesetz-bda.pdf?__blob=publicationFile&v=3, letzter Zugriff: 11.05.2023.
Deutscher Bundestag (2023). Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung. Drucksache 20/6518.
Dietrich, Hans/ Fitzenberger, Bernd/ Janssen, Simon/ Kruppe, Thomas/ Lang, Julia/ Leber, Ute/
Osiander, Christopher/ Seibert, Holger/ Stephan, Gesine (2023). Reform der Weiterbildungsförderung Beschäftigter nach § 82 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) – Weiterbildungsgesetz. IAB-Stellungnahme 1/2023. Online unter: https://doku.iab.de/stellungnahme/2023/sn0123.pdf, letzter Zugriff: 10.05.2023.
Handelsverband Deutschland (HDE) (2023). Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung und Einführung einer Bildungszeit, Online unter: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Stellungnahmen/weiterbildungsgesetz-hde.pdf?__blob=publicationFile&v=3, letzter Zugriff: 11.05.2023.
Hans-Böckler-Stiftung (HBS) (2023). Weiterbildung: Nicht einmal die Hälfte der Betriebe tut genug. Online unter: https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-weiterbildung-nicht-einmal-die-halfte-der-betriebe-tut-genug-48904.htm, letzter Zugriff: 10.05.2023.
Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft (iwd) (2020). Firmen investieren mehr denn je in Qualifizierung. Online unter: https://www.iwd.de/artikel/firmen-investieren-mehr-denn-je-in-qualifizierung-495833/, letzter Zugriff: 21.08.2023.
Leber, Ute/ Kruppe, Thomas/ Schreyer, Franziska/ Grabert, Tim-Felix (2022). Vorbild
Österreich: Impulse für die Weiterbildungspolitik in Deutschland? IAB-Forum, Online unter: https://www.iab-forum.de/vorbild-oesterreich-impulse-fuer-die-weiterbildungspolitik-in-deutschland/, letzter Zugriff: 11.02.2023.
Osiander, Christoper/ Dietz, Martin (2016). Determinanten der Weiterbildungsbereitschaft:
Ergebnisse eines faktoriellen Surveys unter Arbeitslosen, in: Journal for Labour Market
Research, 49 (1), S. 59–76.
Pothmer, Brigitte/ Antony, Philipp/ Bayer, Mechthild/ Brümmer, Ute/ Heister, Michael/ Kruppe, Thomas/ Schroeder, Wolfgang (2019). Weiterbildung 4.0. Solidarische Lösungen für das lebenslange Lernen im digitalen Zeitalter. böll.brief, Teilhabegesellschaft #8, Heinrich-Böll-Stiftung: Berlin.
Räder, Evelyn/ Krüger, Jan/ Becker, Kristof (2023). Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung und Einführung einer Bildungszeit. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Online unter: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Stellungnahmen/weiterbildungsgesetz-dgb.pdf?__blob=publicationFile&v=3, letzter Zugriff: 17.05.2023.
SPD/ Bündnis 90/Die Grünen/ FDP (2021). Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), Online unter: https://www.spd.de/file
admin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf, letzter Zugriff: 09.05.2023.
Statistisches Bundesamt (2022). Pressemitteilung Nr. 505 vom 1. Dezember 2022. Online unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/12/PD22_505_215.html, letzter Zugriff: 21.08.2023.
Wolfgang Schroeder 2023, Weiter so für die Weiterbildung?, in: sozialpolitikblog, 16.11.2023, https://difis.org/blog/weiter-so-fuer-die-weiterbildung-86 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder hat den Lehrstuhl „Politisches System der BRD – Staatlichkeit im Wandel“ an der Universität Kassel inne. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Verbände und Gewerkschaften. Er ist Research Fellow am Wissen;schafts;zentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Abteilung „Demokratie und Demokratisierung“, gehört der Grundwerte;kom;mission der SPD an und wurde in das unabhängige Experten;gremium „Rat der Arbeitswelt“ berufen.
Bildnachweis: David Ausserhofer (WZB)