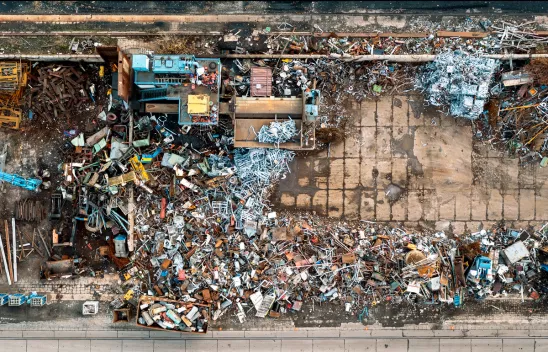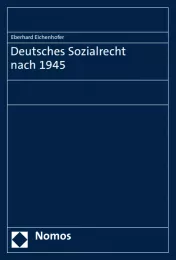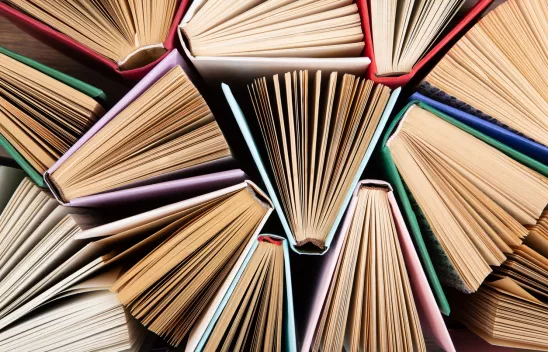Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen
Wer das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht, kann seit dem 1. Januar 2023 ein Erwerbseinkommen in unbegrenzter Höhe beziehen. Welchen Beitrag kann der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen auch bei frühzeitigem Rentenbezug zur Fachkräftesicherung leisten? Dieser zentralen Frage geht der Blogbeitrag nach.
Wer das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht, kann ein Erwerbseinkommen in unbegrenzter Höhe beziehen. Eine Anrechnung auf die Rente erfolgt nicht. Bei vorzeitigem Altersrentenbezug gab es hingegen bis Anfang des Jahres eine Hinzuverdienstgrenze. Sie wurde zunächst im Zuge der Corona-Pakete deutlich angehoben und ist seit dem 1. Januar 2023 nun komplett weggefallen. Welchen Beitrag kann der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen auch bei frühzeitigem Rentenbezug zur Fachkräftesicherung leisten? Dies ist die zentrale Frage angesichts der gegenwärtigen Situation.
Schließlich wird der demografische Wandel zunehmend zum Stresstest für den Arbeitsmarkt, wenn in den kommenden Jahren die Baby-Boomer-Generation in den Ruhestand geht. Die Anzahl derer, die als Nachwuchskräfte nachrücken, reicht nicht aus, um die Jahrgänge zu ersetzen, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden. Es gibt daher zahlreiche Vorschläge, wie einem drohenden Arbeitskräftemangel in der Zukunft begegnet werden könnte. Einer der vielen Ansatzpunkte bleibt die Steigerung der Erwerbsbeteiligung unter den älteren rentennahen Jahrgängen, auch wenn sie zum Beispiel unter den 60- bis 64-Jährigen in den letzten Dekaden bereits massiv gestiegen ist. So waren 61 Prozent der Personen dieser Altersklasse im Jahr 2021 erwerbstätig, 17 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2011 (Statistisches Bundesamt: Erwerbstätigkeit älterer Menschen). Die Erwerbstätigenquote liegt damit aber noch 15 Prozentpunkte unterhalb jener der 15- bis 64-jährigen Bevölkerung insgesamt (Statistisches Bundesamt: Erwerbstätigenquoten 1991 bis 2021).
Es ist daher zu begrüßen, wenn die Bundesregierung in ihrer Fachkräftestrategie das Ziel betont, ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben zu verhindern und ältere Erwerbstätige so lange wie möglich und individuell gewünscht im Erwerbsleben zu halten. Aus ihrer Sicht stellt der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen auch bei vorgezogenen Altersrenten ein adäquates Instrument dar, um durch mehr Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand dem bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken (BT-Drs. 20/3900).
Vor der COVID-19-Krise lag die Hinzuverdienstgrenze bei vorzeitigem Altersrentenbezug noch bei 6.300 Euro im Jahr. Sie begrenzte damit den monetären Arbeitsanreiz im Grunde auf die Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung. Die Idee dahinter: Die gesetzliche Rente soll das Lohneinkommen ersetzen, nicht ergänzen. Im Zuge der Corona-Pakete hatte sie jedoch, wenn auch befristet bis zum 31.12.2022, die Hinzuverdienstgrenze deutlich angehoben auf 46.060 Euro im Jahr. Seit dem 1. Januar 2023 ist sie nun komplett weggefallen.
Vermutete Wirkungen
Die Bundesregierung geht offensichtlich von folgenden zwei Annahmen zur Wirkungsweise dieser Maßnahme aus:- 1. Personen, die derzeitig eine vorgezogene Altersrente beziehen, gehen zukünftig verstärkt einer Erwerbstätigkeit nach, die den Umfang eines Minijobs übersteigt. In der Folge steigt das Arbeitsangebot.
- 2. Personen, die über einen vorzeitigen Rentenbezug nachdenken, erhalten einen zusätzlichen Anreiz, den endgültigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben mindestens bis zum regulären Renteneintrittsalter zu verzögern. Durch die lukrative Dopplung von fortgeführter Erwerbstätigkeit und Rentenbezug wird das Arbeitsangebot stabilisiert.
In beiden Fällen wäre damit ein positiver Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet. Um die Aussichten zu überprüfen, ob sich die erste Annahme erfüllen wird, bietet sich ein Blick auf die Erwerbstätigkeit jenseits des gesetzlichen Renteneintrittsalters an. Denn bei dieser existierte auch bislang keine Hinzuverdienstgrenze. Verschiedene Studien auf Personenebene signalisieren, dass ein Minijob die dominierende Beschäftigungsvariante unter den Rentenbeziehern im Alter jenseits der 65 Jahre ist (z.B. Romeu Gordo et al. 2022 oder Westermeier 2019). Dass sich das Arbeitsangebotsverhalten von Beziehern einer vorzeitigen und denen einer Regelaltersrente so unterscheidet, dass die Aufhebung der Hinzuverdienstgrenze für Erstere eine größere Ausweitung des Erwerbsumfangs nach sich zieht, ist grundsätzlich denkbar. Allerdings ist ein damit verbundener Wechsel zum Beispiel aus einem Minijob in eine große Teilzeit- oder sogar in eine Vollzeitbeschäftigung bzw. die Wiederaufnahme einer Arbeit aus Inaktivität doch eher unwahrscheinlich. Denn dieser Personenkreis hatte sich ja bereits zuvor, z.B. aus Gründen von Krankheit, Überlastung, Pflege oder aufgrund individueller Präferenzen, für den vorzeitigen Renteneintritt und das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben entschieden.
Die zweite Wirkungsannahme rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie sich der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen auf die Entscheidung einer Person für oder gegen einen vorzeitigen Renteneintritt unter Inkaufnahme von Abschlägen in der Zukunft auswirken wird. Hilfreich ist es, sich eine fiktive Person anzuschauen, die zunächst einmal indifferent ist zwischen dem Bezug einer vorgezogenen Rente mit entsprechenden Abschlägen und einem regulären Renteneintritt zu einem späteren Zeitpunkt. Der vorzeitige Bezug einer Altersrente bei Fortsetzung des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses im gleichen Umfang wird durch die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenzen attraktiver, denn dem Erwerbseinkommen steht ohne Abzüge ein zusätzliches Renteneinkommen bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze an der Seite. Für einen begrenzten Zeitraum ersetzt die gesetzliche Rente nicht länger das Erwerbseinkommen, sie tritt hinzu. Zudem erhöhen die von Versicherten und Arbeitgebern im fortlaufenden Beschäftigungsverhältnis gezahlten Beiträge die Rentenauszahlungen in den jeweiligen Folgejahren.
Im Vergleich zur Situation vor dem Wegfall der Hinzuverdienstschwelle bedeutet das:
- Der Umfang des individuellen Arbeitsangebots bleibt gleich hoch. Für die Fachkräftesicherung ist damit entsprechend nichts gewonnen.
- In der Rentenversicherung entsteht ein finanzieller Mehraufwand. Dieser muss von allen Beitragszahlern getragen werden.
- Einzig der oder die sozialversicherungspflichtig Beschäftigte freut sich über einen unverhofften Einkommenszuwachs.
Negative Arbeitsangebotsanreize werden gestärkt
Es ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass dieser Einkommenszuwachs keinen zusätzlichen Effekt auf die Arbeitsangebotsentscheidung dieser Person bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze ausübt. Die Bereitschaft, trotz Abschlägen in Rente zu gehen und Einkommenseinbußen gegenüber der Fortsetzung des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses in Kauf zu nehmen, ist bereits heute relativ groß – im Jahr 2021 traf dies auf ein Viertel der Altersrentenzugänge zu . Mit der neuen Regelung ist es grundsätzlich möglich, die mit einer Reduzierung der Arbeitszeit einhergehende proportionale Entgeltkürzung in den Jahren vor dem Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters durch die vorzeitige Altersrentenzahlungen auszugleichen. Daran ändern auch Abschläge von 0,3 Prozent pro Monat nichts, genauso wenig wie der Verzicht auf die Zahlung weiterer die Anwartschaft erhöhender Arbeitnehmerbeiträge.Welche Folgen diese Kompensationsmöglichkeit auf das Arbeitsangebot rentennaher Jahrgänge haben wird, lässt sich zwar ohne Weiteres nicht quantitativ abschätzen, weil die konkreten Wirkungen auf die Nettoeinkommen von der jeweiligen Haushaltskonstellation abhängen und zusätzlich nicht-monetäre Faktoren die Arbeitsangebotsentscheidungen beeinflussen (Anger et al. 2018, Romeu Gordo et al. 2022). Doch das Risiko ist groß, dass diese besondere Form der Altersteilzeit die Fachkräftebasis eher verknappen wird, als zur deren Sicherung beizutragen. Da kann das Interesse der Unternehmen an der Aufrechterhaltung der Beschäftigungsverhältnisse rentennaher Jahrgänge im bisherigen Erwerbsumfang so groß sein, wie es will. Die im Gesetz geplante Evaluation wird Ende 2027 erste Aufschlüsse darüber geben, ob sich der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen für die Fachkräftesicherung als kontraproduktiv bewahrheiten wird. Befürchtet werden muss dies allemal.
Literatur
Anger, Silke; Trahms, Annette und Christian Westermeier (2018). Soziale Motive überwiegen, aber auch Geld ist wichtig. IAB-Kurzbericht 24/2018. https://doku.iab.de/kurzber/2018/kb2418.pdfRomeu Gordo, Laura; Gundert, Stefanie; Engstler, Heribert; Vogel, Claudia und Julia Simonson (2022). Rentnerinnen und Rentner am Arbeitsmarkt: Erwerbsarbeit im Ruhestand hat vielfältige Gründe – nicht nur finanzielle. IAB-Kurzbericht, 8/2022, S.3. https://doku.iab.de/kurzber/2022/kb2022-08.pdf
Westermeier, Christian (2019). Ältere am Arbeitsmarkt: Eine stabile Beschäftigung vor dem Rentenalter begünstigt die Weiterarbeit. IAB-Kurzbericht 15/2019, S.3. https://doku.iab.de/kurzber/2019/kb1519.pdf
Oliver Stettes 2023, Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen, in: sozialpolitikblog, 13.04.2023, https://difis.org/blog/wegfall-der-hinzuverdienst-grenzen-58 Zurück zur Übersicht

Oliver Stettes
Dr. Oliver Stettes leitet beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) das Themencluster Arbeitswelt und Tarifpolitik.