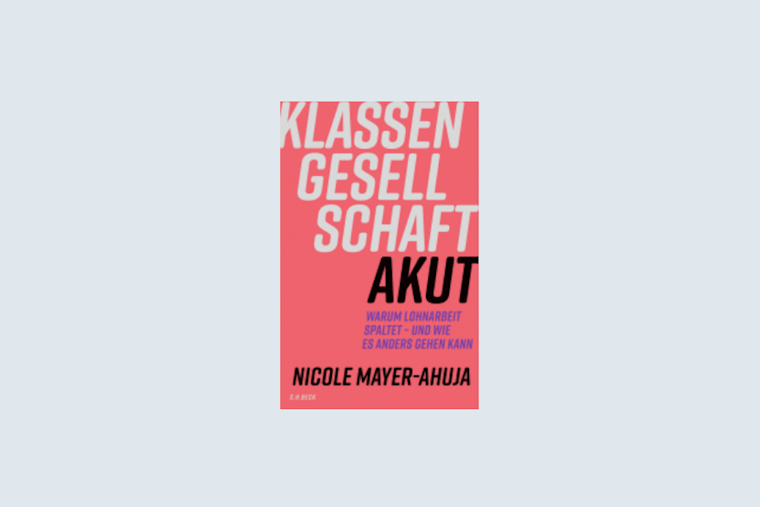Klassengesellschaft: Alte Spaltungslinien und neue Solidarität
Nicole Mayer-Ahuja zeigt in ihrem Buch „Klassengesellschaft akut“, wie eine aktualisierte Klassenanalyse die heutigen gesellschaftlichen Konflikte erklärt – und fordert eine solidarische Arbeitspolitik, die das Gemeinsame von Beschäftigten betont. Im Interview spricht sie darüber, was ihre Analyse für Sozialpolitik heißt und warum Forschende ihre theoretische Perspektive schärfen sollten.
Interview: Johanna Ritter
Frau Mayer-Ahuja, Sie sprechen in Ihrem neuen Buch „Klassengesellschaft akut“ von der Wiederentdeckung der Klasse. Was verstehen Sie darunter und warum arbeiten Sie zentral mit der Kategorie der Klasse?
Ich arbeite zentral mit der Kategorie Klasse, weil die Gesellschaft, in der wir leben, nach wie vor durch die alte Spaltungslinie Kapital/Arbeit geprägt ist. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die fremde Arbeitskraft einkaufen können, um Waren zu produzieren oder Dienstleistungen anzubieten, und auf der anderen Seite diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Diese Spaltungslinie verläuft zumindest teilweise parallel zu der Spaltungslinie zwischen Arm und Reich. Die Wiederkehr einer Diskussion über die Klassengesellschaft hängt mit der Zuspitzung der sozioökonomischen Ungleichheit zusammen, aber auch damit, dass sich die Lohnarbeitserfahrung verallgemeinert hat. Heute arbeiten 92 Prozent der Erwerbstätigen lohnabhängig. Seit in den 1980er Jahren die Arbeitslosigkeit anstieg, ist etwa der Zwang, einen Job zu haben, um zu überleben, wieder sehr viel deutlicher spürbar.
Die Debatte um Vermögensungleichheiten wird oft getrennt von der um Abhängigkeit von Lohnarbeit geführt.
Klasse wird in Deutschland als Erklärung für die Spaltungstendenzen in der Gesellschaft eher nicht herangezogen. Stattdessen hat sich schon in den 1950er Jahren die Rede von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ etabliert. Wenn es beispielsweise um eine Erhöhung der Erbschaftssteuer geht, dann halten Menschen, die für ein Einfamilienhaus gespart haben, ihr Vermögen für genauso gefährdet wie die Erb*innen großer Unternehmen. Hier hilft eine Klassenperspektive weiter. Außerdem macht sie auch insofern einen Unterschied, als man nicht nur zunehmende Armut und zunehmenden Reichtum erfasst, sondern den Zusammenhang dazwischen.
Sie heben in Ihrem Buch immer wieder das Nebeneinander von Spaltung und Solidarität innerhalb der arbeitenden Klasse hervor. Kommt es auf die empirische Arbeit und die Analyse an, ob man die verbindenden Elemente innerhalb der Klasse heute erkennen kann?
Diese Frage muss man auf verschiedenen Ebenen diskutieren. In der Soziologie gibt es seit den Nachkriegsjahrzehnten einen empirischen Fokus auf Individualisierung, verblassende Standards und verschwindende Kollektive. Darüber wissen wir sehr viel, und das ist gut so. Aber wenn wir da stehen bleiben, sehen wir nicht, wie viel verbindende Potenziale es zum Beispiel zwischen verschiedenen Gruppen von abhängig Beschäftigten gibt. Sie finden sich etwa im Arbeitsprozess, wenn Stamm- und Randbelegschaften eng zusammenarbeiten, in der übergreifenden Erfahrung, seine Arbeit aus Zeit- und Personalmangel nicht nach professionellen Standards machen zu können, oder in dem weit verbreiteten Problem, Arbeitszeiten zu haben, die nicht zum Leben passen.
Aus einer theoretischen Perspektive ist es wichtig, dass wir Klasse als dynamisches soziales Verhältnis verstehen. Wenn Klassenanalyse sich darauf beschränkt, unterschiedliche Gruppen in Kategoriensysteme einzusortieren, dann erfassen wir nicht, wie sich Arbeitserfahrungen und Arbeitsbeziehungen, Lebensrealitäten und Hoffnungen verändern.
Die Frage hat aber auch eine politische Seite. Ob Klassenerfahrungen als solche wahrgenommen und kollektiv verarbeitet werden, hängt auch davon ab, inwiefern Gewerkschaften und Betriebsräte das Verbindende betonen. Deshalb plädiere ich dafür, über Ansatzpunkte für eine Politik der Solidarisierung nachzudenken.
Welche Zusammenhänge zeigt die Klassenanalyse mit Blick auf den aktuellen Rechtsruck auf?
Die Vorstellung, dass Lohnabhängigkeit automatisch zu einem Bewusstsein für gemeinsame Interessen führt, ist falsch. In jedem Kopf ist Platz für verschiedene Identitäten. Wenn Lohnabhängige zunehmend das Gefühl haben, keinen Einfluss auf ihre Arbeitsrealität nehmen zu können, kann es passieren, dass sie Selbstbestätigung als Teil des „deutschen Volkes“ suchen. Umfragen zeigen, dass diejenigen, die sich besonders machtlos und wenig anerkannt fühlen, häufig die AfD wählen. Hinzu kommt, dass seit Jahrzehnten auch in Bezug auf Arbeitsorganisation die Losung „Es gibt keine Alternativen“ gilt. Rechte Parteien bieten zwar gerade in Bezug auf Wirtschaft, Arbeit und soziale Sicherung überhaupt nichts an, was Beschäftigten nutzen würde, aber sie stänkern gegen den Status Quo. Didier Eribon hat beobachtet, dass die Rechte davon profitiert, wenn frühere Arbeiter*innenparteien sich kaum noch für Arbeit interessieren und die Arbeiterschaft eher als Opfer der Verhältnisse ansprechen denn als wehrhafte Gruppe, die ihre eigene Lage oder sogar die Gesellschaft verbessern kann.
Sie blicken in Ihrem Buch auf die Perspektive jener, die massiv negativ von rechtsextremen Spaltungsversuchen betroffen sind. Warum ist das jetzt wichtig?
Wenn man über Klassenformierung redet, kommt man an den Spaltungslinien innerhalb der arbeitenden Klasse, also vor allem an Migrationsstatus und Geschlecht, nicht vorbei. Diese Ungleichheiten sind älter als der Kapitalismus, erhalten durch diese Logik des Wirtschaftens aber eine besondere Prägung. Unternehmen nutzen beispielsweise migrantische und weibliche Arbeitskräfte, um Löhne und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, und verschärfen so bestehende gesellschaftliche Differenzen.
Interessant ist hier der Befund von Werner Schmidt, dass die Erfahrung kollektiver Rechte in der Lohnarbeit großen Einfluss darauf hat, wie die Auseinandersetzungen innerhalb der arbeitenden Klasse verlaufen. In großen Industrieunternehmen mit Betriebsrat und Tarifvertrag betonen Beschäftigte oft, dass sie pragmatisch zusammenarbeiten. Sie sehen einander in erster Linie als Kollege oder Kollegin. Wo die verbindenden Erfahrungen mit Lohnarbeit prägend sind und kollektive Rechte für alle Beschäftigten gelten, ist in vielen Köpfen offenbar der Kapital/Arbeit-Gegensatz präsenter als Spaltungslinien entlang Geschlecht oder Herkunft. Der AfD beziehungsweise ihrem Ableger „Zentrum“ gelingt es da schwerer, Fuß zu fassen. Wenn man aber Politik „externalisiert“, kann es durchaus sein, dass Beschäftigte nach Feierabend auf der AfD-Demo „Remigration“ fordern. Auch ist die Frage, wie man dafür sorgen kann, dass sich die Kollegialität über die Grenzen des Betriebs erweitert – und inwiefern sich betrieblicher Universalismus halten kann, wenn rechte Mobilisierung im politischen Raum weiter so stark an Bedeutung gewinnt. Außerdem gibt es auch andere betriebliche Kontexte, in denen das Management gezielt Beschäftigte verschiedener Herkunft mit unterschiedlichen Aufgaben betraut, um die Belegschaft zu spalten. Doch teilweise gelingt es sogar dort, Beschäftigte innerhalb der Herkunftsgruppen zu organisieren, um etwa einen Betriebsrat zu gründen.
Wie können in einem Betrieb die Identitäten und Lebensrealitäten unterschiedlicher Gruppen berücksichtigt werden, ohne dabei die gleichen Rechte aller Arbeitenden aufzuweichen?
Betrieblicher Universalismus und die Akzeptanz verschiedener Identitäten stehen in einem Spannungsverhältnis. Es ist entscheidend, die Beschäftigten auf Basis ihres Status als Lohnabhängige als Gleiche anzusprechen. Zugleich muss man Diskriminierungen, wie die hohe Zahl migrantischer Beschäftigter in niedrigen Lohngruppen oder den Gender Pay Gap, gezielt überwinden. Betriebsräte kommen nicht umhin, gleichermaßen für alle Beschäftigten der Belegschaft einzutreten. Gewerkschaften können sehr viel klarer politische Grenzen ziehen – indem sie trotz Rechtswende entschieden für Gleichheit, Emanzipation und Solidarität eintreten.
Mit Blick auf soziale Leistungen, insbesondere die Grundsicherung, erleben wir heute eine öffentliche Debatte, in der von „Totalverweigerern“ die Rede ist und Sozialausgaben hauptsächlich als Kostenfaktor gesehen werden. Wie passt das in Ihre Analyse?
Auch die Entwicklung der Sozialpolitik hat mit Prozessen von Klassenformierung zu tun. Die Verbindung von Arbeit und sozialer Sicherung war immer zentral für die Arbeiter*innenbewegung, da ein soziales Sicherungssystem entscheidend dafür ist, die Konkurrenz zwischen Arbeitenden und das Machtgefälle zwischen Kapital und Arbeit zu reduzieren. In den Nachkriegsjahrzehnten half Sozialpolitik, hier Unterschiede auszugleichen. Seit den 1980er Jahren beobachten wir jedoch eine Umkehrung dieser Tendenz. So wird etwa individuelle Verantwortung betont, Arbeitslosigkeit oft als persönliches Versagen dargestellt. Das vertieft Spaltungslinien innerhalb der arbeitenden Klasse und wird genutzt, um finanzielle Einschnitte in soziale Programme zu rechtfertigen.
Auf dem diesjährigen FIS-Forum beschäftigen wir uns mit Solidarität im Sozialstaat. Wie kann aus Ihrer Sicht eine solidarische Sozialpolitik aussehen?
Eine solidarische Sozialpolitik muss die Verknüpfung von Lohnarbeit und sozialer Sicherung erweitern. Beschäftigte in prekarisierten Arbeitsverhältnissen, Scheinselbstständige oder „Minijobber*innen“ sind oft unzureichend abgesichert. Essenziell wären eine Bürger*innenversicherung für alle, inklusive Beamt*innen. Die Beitragsbemessungsgrenzen müssten wegfallen, um die Finanzierungsgrundlagen der Sozialversicherung zu erweitern. Außerdem braucht es eine gerechtere Lastenverteilung zwischen Kapital und Arbeit, etwa indem Kapitaleinkünfte zur Finanzierung der Sozialversicherung herangezogen werden. So könnte man nicht nur ein krisensicheres System schaffen, sondern auch die Solidarität zwischen Arbeitenden stärken, statt verschiedene Gruppen gegeneinander in Stellung zu bringen, weil sie um viel zu knappe Ressourcen konkurrieren.
Was geben Sie Forschenden mit Ihrem Buch mit auf den Weg?
Wir dürfen den Blick vor der Brutalität der Klassengesellschaft nicht verschließen. In der Arbeitssoziologie und Sozialpolitikforschung tragen wir eine große Verantwortung, da gerade in unseren Forschungsbereichen gravierende Veränderungen stattfinden. Wir brauchen unbedingt die vielen detaillierten Studien zu einzelnen Betrieben, Politikfeldern und so weiter. Aber wir müssen auch den Mut haben, diese Detailstudien in ihrem größeren ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Kontext zu verorten. Es ist eine wichtige Frage, inwiefern unsere Befunde dazu beitragen können, eine andere, solidarische Politik der Arbeit zu entwickeln.
Nicole Mayer-Ahuja 2025, Klassengesellschaft: Alte Spaltungslinien und neue Solidarität, in: sozialpolitikblog, 30.10.2025, https://difis.org/blog/gespraeche?blog=180 Zurück zur Übersicht

Nicole Mayer-Ahuja ist Professorin für die Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie beschäftigt sich seit langem mit Veränderungen im Bereich von Arbeit und sozialer Sicherung. Zu ihren aktuellen Publikationen zählt etwa der Sammelband „Verkannte Leistungsträger*innen. Berichte aus der Klassengesellschaft“, den sie 2021 mit Oliver Nachtwey bei Suhrkamp herausgegeben hat. Weitere Informationen finden sich auf ihrer Webseite.
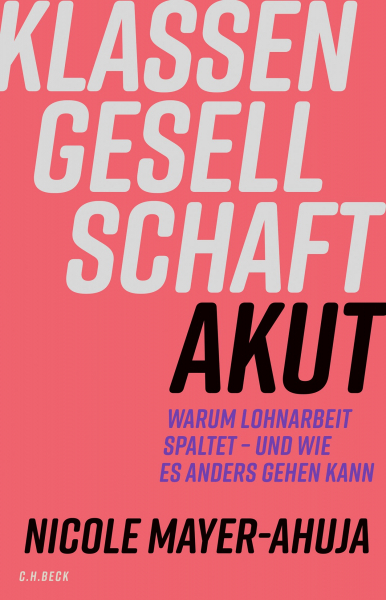
Nicole Mayer-Ahuja
Klassengesellschaft Akut. Warum Lohnarbeit spaltet – und wie es anders gehen kann
C.H. Beck
Zum Buch