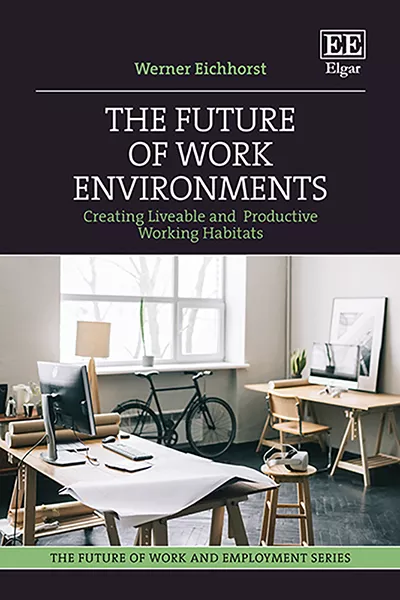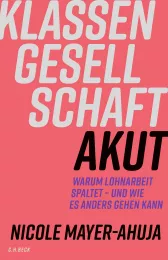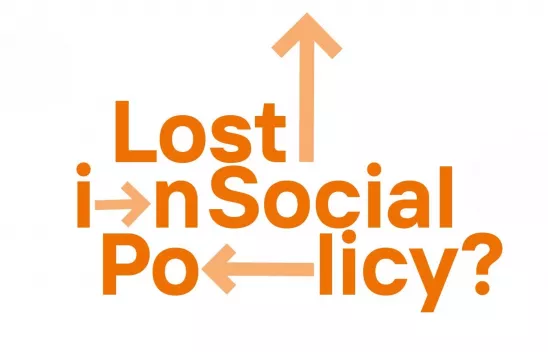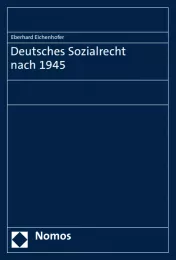Solidarität – zwischen kollektiven und individuellen Rechten
Tarifautonomie und betriebliche Mitbestimmung können in Spannung zu Diskriminierungsschutz und Gleichbehandlung stehen. Wie sieht es aus, wenn kollektive Vereinbarungen und individuelle Rechte in Konflikt geraten und welche Lösungen für inklusive Solidarität gibt es? Diese drängenden Fragen beleuchtet Eva Kocher in ihrer Keynote für das FIS-Forum und auf sozialpolitikblog.
Es lässt sich kaum überschätzen, welche Bedeutung das kollektive Handeln und das Kollektivvertragsrecht für eine demokratische Gesellschaft haben. Sie bieten einen Rahmen für die Gestaltung einer Arbeitswelt, in der Bürger*innen nicht tagtäglich die Erfahrung eigener Ohnmacht machen müssen.
Im deutschen Recht gibt es vor allem zwei Wege, auf denen eine solche Mitwirkung stattfinden kann: Die Tarifautonomie und die betriebliche Mitbestimmung. Beide sind in gewisser Weise von sozialen Voraussetzungen der Solidarität abhängig, die brüchiger zu werden scheinen. Auf die Gründe hierfür werde ich hier nicht eingehen, denn mir geht es hier um etwas anderes, nämlich um die Frage, wie Kollektivität eigentlich verfasst ist. Dabei geht es mir nicht vorrangig um das Verhältnis der Arbeitnehmer*innen- zur Arbeitgeber*innenseite, sondern um die Verhältnisse und Konflikte zwischen einzelnen Arbeitnehmer*innen.
Zwei Beispiele veranschaulichen die Frage: Analysen zum Thema „equal pay“ zeigen, dass Arbeitstätigkeiten, die typischerweise weiblich konnotiert sind, systematisch schlechter bewertet werden als Arbeitstätigkeiten auf typischerweise von Männern besetzten Arbeitsplätzen. Rechtlich gesehen wird daraus eine Problematik der mittelbaren Diskriminierung, und diese lässt sich auch in Tarifverträgen identifizieren.
Das zweite Beispiel kommt aus dem Bereich der betrieblichen Mitbestimmung. Ich entnehme es dem Sachverhalt eines älteren Urteils des Bundesarbeitsgerichts, dessen Problematik so aktuell wie seit jeher ist: Eine Arbeitnehmerin in einem Baumarkt kommt nach der Elternzeit als Alleinerziehende in den Betrieb zurück und bittet darum, ihre Arbeitszeiten an die Öffnungszeiten der Kindertagesstätte anzupassen. Ihr Arbeitgeber lehnt das ab, unter Hinweis auf eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat, die vorsieht, dass alle Schichten, also auch am Abend und am Samstag, gleichmäßig unter allen Arbeitnehmer*innen verteilt werden – ohne Ausnahmen. Rechtlich gesehen entsteht ein Problem von Ansprüchen auf Teilzeit, die in engem Zusammenhang mit dem Antidiskriminierungsrecht stehen.
Kollektivverträge und Diskriminierungsschutz in Kollision
Bei allen gravierenden rechtlichen Unterschieden weisen Tarifautonomie und betriebliche Mitbestimmung insofern Gemeinsamkeiten auf: Sie legitimieren Kollektivverträge, die eigenständige Rechtsquellen darstellen – und die dabei in ein Spannungsverhältnis zu Gleichbehandlungsrechten und Diskriminierungsschutz geraten können.
Dieses Spannungsverhältnis ist wahrscheinlich eine der interessantesten rechtlichen Fragen der letzten Jahre gewesen: Wie setzt man Kollektivverträge, die einen Interessenausgleich im vertikalen Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen zum Gegenstand haben, in ein Verhältnis zur horizontalen Ebene der Interessenkonflikte zwischen Arbeitnehmer*innen? Rechtlich formuliert: Wie können Gleichbehandlungsansprüche von Arbeitnehmer*innen angemessen in ein Verhältnis zu Kollektivverträgen gesetzt werden? Gibt es noch andere Wege, als entweder Arbeitnehmer*innen den Weg aus dem Betrieb heraus zu weisen – wie im Fall der Alleinerziehenden –, oder die Kollektivvereinbarung aufzubrechen und dadurch wertlos zu machen?
Im Dezember 2024 hat das Bundesverfassungsgericht erstmals zum grundsätzlichen Verhältnis von Gleichbehandlungsrecht und Tarifautonomie entschieden und dabei die Autonomie der Tarifvertragsparteien stark hervorgehoben: Die Tarifvertragsparteien dürfen „Typisierungen und Generalisierungen vornehmen und müssen nicht die objektiv vernünftigste und sachgerechteste Lösung treffen. [Sie] sind sogar befugt, Regelungen zu treffen, die die Betroffenen im Einzelfall für ungerecht halten und die für Außenstehende nicht zwingend sachgerecht erscheinen“, heißt es in dem Beschluss.
Allerdings gilt dies nicht, „wenn tarifvertragliche Differenzierungen an personenbezogene Merkmale anknüpfen oder Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Minderheiten betroffen sind und diese oder spezifische Gruppeninteressen systematisch vernachlässigt wurden.“ Das ist verfassungs- und unionsrechtlich eine zwingende Schlussfolgerung, die Folgen hat: Kollektivverträge können deshalb durch antidiskriminierungsrechtliche Ansprüche durchlöchert oder gar wirkungslos gemacht werden. Und das gilt nicht nur für Tarifverträge, sondern auch für Betriebsvereinbarungen, die ohnehin anders als Tarifverträge keinen speziellen verfassungsrechtlichen Schutz genießen.
Individualansprüche gegen soziale Ausschlüsse
Alternativen dazu werden seit längerem diskutiert, vor allem in zwei Richtungen: der personellen Repräsentation von Gleichbehandlungsinteressen einerseits, und der inhaltlichen Berücksichtigung dieser Interessen im Kollektivvertrag andererseits.
Für den ersten Weg steht § 15 Abs. 2 BetrVG. Dieser sieht vor, dass in der Regel „[d]as Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, […] mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein [muss]“. Auch Gewerkschaften haben solche Quoten häufig satzungsrechtlich geregelt (siehe z.B. § 13 der IG Metall-Satzung).
Den zweiten – potenziell wirksameren – Weg schlägt das Entgelttransparenzgesetz ein. Diese Regelungen sehen unter anderem vor, dass kollektive Entgeltregelungen – also auch Kollektivverträge – systematisch auf diskriminierende Elemente und Strukturen geprüft werden.
Eine ähnliche Herangehensweise findet sich auch im Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum Fall der Alleinerziehenden. Dort wird verlangt, dass ein Betriebsrat bei der Ausübung seines Mitbestimmungsrechts darauf „[achtet], dass die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit gefördert wird“.
Diese Entscheidung macht aber auch gleich deutlich, wo der Haken liegt: Denn „[d]iese allgemeine Aufgabe des Betriebsrats […] führt nicht notwendig zum Vorrang der Interessen des einzelnen Arbeitnehmers, der Familienpflichten zu erfüllen hat“, wie es ebenso in dem Urteil heißt. Die alleinerziehende Arbeitnehmerin verlor ihren Fall am Ende. Die Regelungen zur Entgelttransparenz wiederum werden von Anfang an mit Individualansprüchen auf Auskunft darüber, welches Entgelt für vergleichbare Tätigkeiten gezahlt wird, und dem antidiskriminierungsrechtlichen Individualanspruch auf Entgeltgleichheit flankiert, vertrauen also nicht allein auf die systematische Überprüfung der Entgeltstruktur auf Diskriminierung.
Tatsächlich sind starke Individualansprüche das Mittel der Wahl, wenn es gilt, soziale Ausschlüsse, die in gesellschaftlichen Strukturen begründet sind, gegen das, was im Betrieb oder für die Mehrheit als „normal“ gilt, in Anschlag zu bringen und wirksam zu thematisieren. Sie ermächtigen einzelne Arbeitnehmer*innen und bieten dem Recht einen Modus der immanenten (Selbst‑)Kritik.
Das Problem ist nur, dass mit solchen subjektiven Rechten auch „Pathologien des Juridismus“ einher gehen. Dabei handelt es sich um Subjektivierungseffekte, die den einzelnen nahelegen, sich als von anderen getrennt, nicht auf andere angewiesen zu verstehen und Konflikte in Kategorien von richtig/falsch anzugehen.
Verfahren für ein inklusiv solidarisches Kollektivrecht
Deshalb sind die utopischen Perspektiven so interessant. Sie zeigen alternative Formen des Rechts auf und sind bereits vereinzelt auch normiert: Verfahrens- und Verhandlungsregelungen, die mehr als nur zwei oder drei Parteien in eine Debatte einbeziehen, bei der man sich in einem „offenen Suchprozess“ einer Lösung annähert, die nicht nur die Interessen aller Beteiligten „berücksichtigt“, sondern auch alle persönlich einbezieht. Je nach Fall können das Personen in ganz unterschiedlichen Rollen sein. Im Fall der Alleinerziehenden hätte das Ergebnis möglicherweise anders ausgesehen, wenn man nicht nur die Betriebsvereinbarung angesehen hätte, sondern Betriebsrat und einzelne direkte Kolleg*innen mit ihr in ein Gespräch gebracht hätte. Es fällt mir schwer zu glauben, dass man dann nicht eine bessere Lösung gefunden hätte. Und wenn utopisches Denken erlaubt ist: Warum nicht auch die Angehörigen und Kinder der Arbeitnehmer*innen einmal – in einem strukturierten „offenen Suchprozess“ nach ihren Gedanken und Ideen fragen?
In einem Umfeld, das von der Macht des Arbeitgebers geprägt ist, ist es alles andere als leicht, solche offenen Verfahren zu etablieren. Dennoch stellen diese Verfahren und Prozesse interessante Perspektiven der Vermittlung von Solidarität dar – und sie könnten Kollektivvereinbarungen auf inklusiv solidarische Grundlagen stellen.
Eva Kocher 2025, Solidarität – zwischen kollektiven und individuellen Rechten, in: sozialpolitikblog, 03.11.2025, https://difis.org/blog/solidaritaet-zwischen-kollektiven-und-individuellen-rechten-181 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Eva Kocher ist seit 2009 Professorin für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) sowie Gründungsmitglied des Deutschen Instituts für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (DIFIS). Sie ist Leiterin des Center for Interdisciplinary Labour Law Studies (C*LLaS). Sie war Vorsitzende der Zweiten Gleichstellungskommission der Bundesregierung. 2024 erschien Ihre Open-Access-Veröffentlichung „Das Andere des Arbeitsrechts“, deren Gedanken dieser Blog weiterführt.