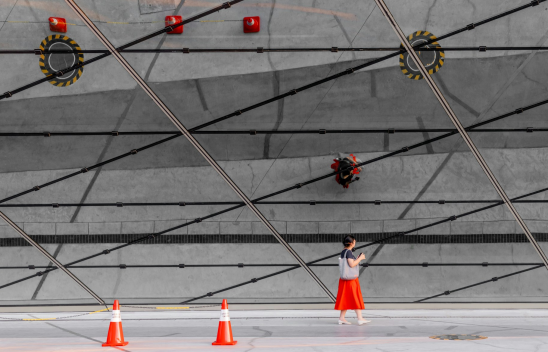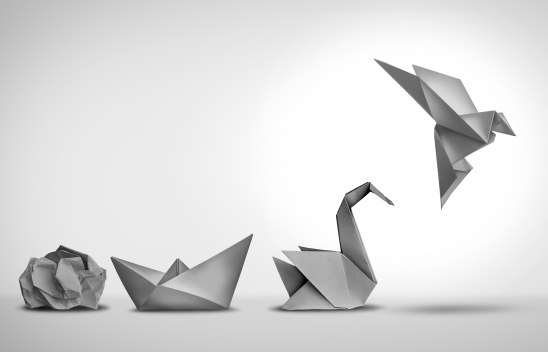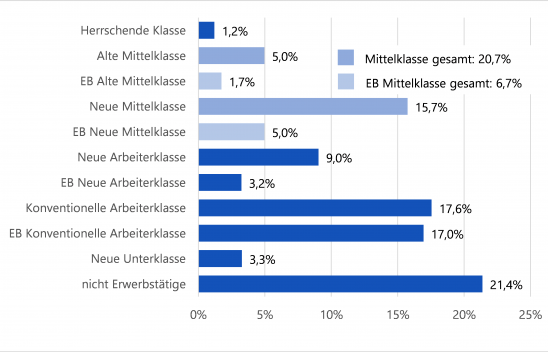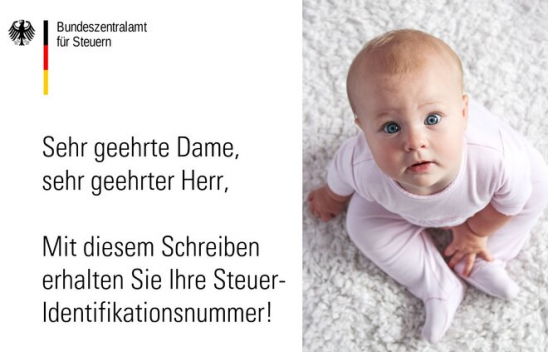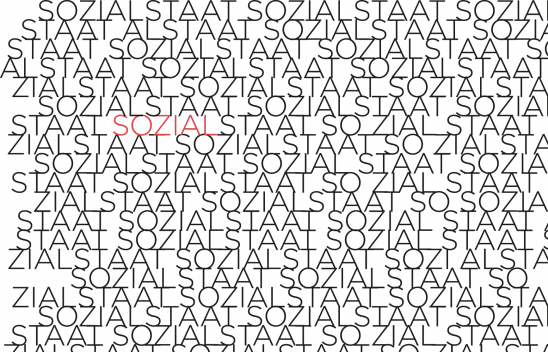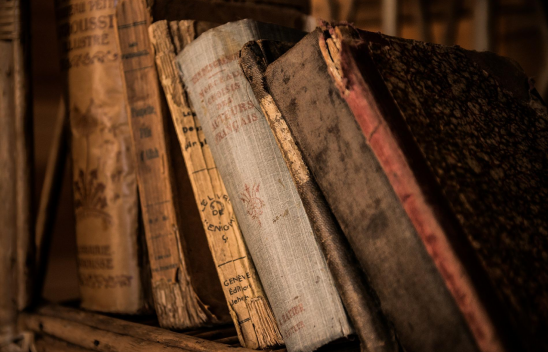Welche Rolle für die Gewerkschaften in einer neuen Interessenskonstellation für die sozial-ökologische Transformation?
In der Sozialpolitikforschung hatte die Beschäftigung mit der sozial-ökologischen Transformation lange Zeit einen marginalen Stellenwert (für einen Literaturüberblick siehe Bohnenberger 2022) und die meisten Beiträge waren von großer Skepsis gegenüber dem erwerbszentrierten Modell der sozialen Sicherung geprägt (beispielhaft Koch 2019). Eines der zentralen Strukturprinzipien des Sozialstaats, das besonders relevant erscheint, um die Anpassungsfähigkeit – und das Anpassungspotential des deutschen Sozialmodells an die Herausforderungen des Klimawandels auszuloten, ist die Grundkonstellation um den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital.
Die Gewerkschaftsbewegung – eine Barriere für die ökologische Transformation?
In der sozial-ökologischen Transformationsdebatte gilt das Machtspiel zwischen Arbeit und Kapital öfter als Barriere und Problem für die ökologisch notwendige Anpassung unserer Wirtschaftsweise, denn als produktiver Mechanismus der Transformationsgestaltung (Brand 2019). Der Grundkonflikt ist jedoch für den deutschen Sozialstaat strukturgebend. An die Stelle einer politischen Grundkritik sollte daher verstärkt die wissenschaftliche Analyse der Bedingungen für die Integration ökologischer Zielsetzungen in diesen Interessenskonflikt treten. Hierzu können wir uns auf die Grundeinsicht von Esping-Andersen (1990) berufen, dass Machtverhältnisse durch gesellschaftliche Konflikte und Koalitionsbildung entschieden und in Form (sozial-)politischer Institutionen verankert werden. Sozialpolitische Interventionen bedeuten somit immer eine Parteinahme und eine Verschiebung des aktuellen Machtverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital – und rufen dementsprechend stets Widerstand hervor. Entsprechend sind Struktur und Alltagskultur einer Gesellschaft auch von diesen ‚erstarrten‘ Interessenskonflikten geprägt. Mit dem Übergang zum Sozialstaat wurde die liberale Ausrichtung des Rechtsstaats des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der vor allem die individuelle Freiheit vor staatlicher Bevormundung im Blick hatte, überwunden (Kaufmann 2002). Parallel zur pluralen liberalen Demokratie etablierte sich die ‚unbürgerliche‘ Gewerkschaftsbewegung (Streeck 2021) mit dem Ziel, die schlimmsten sozialen Auswüchse der marktwirtschaftlich organisierten Industriegesellschaft einzuhegen. Das Kollektiv der Arbeiterbewegung hat sich im Kampf gegen Armut und Ungleichheit geformt und vermittels der parlamentarischen Kanalisierung ihrer Anliegen durch die Sozialdemokratie die Etablierung von sozialen und Statusrechten erreicht. Dem massiven politischen Druck – nicht politischer oder gesellschaftlicher Vernunft der bürgerlichen Mitte – ist zu verdanken, dass die Teilhabe an Wohlstand und politischer Mitgestaltung für die Arbeiter*innen durchgesetzt werden konnte. Die Wirkmächtigkeit dieser Grundkonstellation gilt es anzuerkennen, wenn wir nach Anknüpfungspunkten für die Durchsetzung neuartiger gesellschaftlicher Interessen und die Überwindung des häufig angenommenen Zielkonflikts zwischen dem Kampf um soziale und ökologische Interessen suchen.
Der Kampf um gute und nachhaltige Arbeit
Dabei ist zu bedenken, dass der Interessenskonflikt über die Teilhabe der ‚Besitzlosen‘ (Castel 2005) an einem guten Leben auch heute keinesfalls erledigt ist – im Gegenteil: Die soziale Ungleichheit hat sich seit den 1980er Jahren durch die Deregulierung des Arbeitsmarkts und die Vermarktlichung und Finanzialisierung existentiell unentbehrlicher Güter und Leistungen verstärkt. Wie die Arbeitskämpfe der jüngeren Zeit zeigen, haben sogar traditionell eher schwache Beschäftigtengruppen, nämlich die (frauendominierten) sozialen Dienstleistungsbereiche, diese kollektive Form des Machtkampfs für sich entdeckt. Das Machtspiel zwischen Arbeit und Kapital muss also ein Ausgangspunkt, nicht Endpunkt der Überlegungen sein, wie der sozial-ökologischen Transformation mit den Mitteln des Sozialstaats zu begegnen ist. So wäre zu fragen, unter welchen Bedingungen Gewerkschaften und Arbeitgeber den Gegenstand des Konflikts neu bestimmen: Wie können industrielle Transformationsprozesse gerecht ausgestaltet werden? Was wissen wir über die Veränderungsbereitschaft von Gewerkschaften und Arbeitgebern oder der Betriebsparteien? Was gilt jenseits der materiellen Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse für die Beschäftigten als Teil eines ‚guten Lebens‘? Dass die Sicherung eines möglichst hohen Einkommens in der Tarifpolitik längst durch qualitative Aspekte wie Weiterbildung, Freistellungen oder innovative Arbeitszeitregelungen ergänzt werden, zeigt, dass Betrieb und Tarifpolitik schon zu Arenen für die Aushandlung von breit angelegten Schutz- und Anpassungsmaßnahmen geworden sind. Wo finden sich dann aber neue gesellschaftliche Koalitionen für ein neues nachhaltiges Verständnis eines guten Lebens? Und (wie) kann öffentliche Politik die notwendigen Umbauprozesse unterstützen?
Drei Perspektiven für die Forschung
Aus diesen Fragen ergeben sich für die Sozialpolitikforschung oder die Forschung zu den Industriellen Beziehungen mindestens drei interessante Forschungsstränge. Erstens wird die Frage nach der Möglichkeit gerechter Übergänge (‚just transition‘) und der Kompatibilität sozialer mit ökologischen Zielsetzungen im Tarifkonflikt zeigen, inwiefern die tragenden Institutionen der Erwerbsgesellschaft – Tarifpolitik, betriebliche Mitbestimmung oder Arbeitsmarktpolitik – weiterentwickelt und Zielkonflikte ausgeräumt werden können. Die klimapolitische Position der IG-Metall bietet inzwischen ein breites Spektrum an Vorschlägen für den Umbau von Produktion, Mobilität und Konsumentenverhalten und soziologische Konfliktanalysen loten derzeit bereits die Überschneidungen sozialer und ökologischer Interessen und Einstellungen in der Bevölkerung aus (Eversberg 2023). Zweitens zeichnet sich eine Veränderung des tripartistischen Steuerungsmodells – also des Zusammenwirkens zwischen Staat und Sozialpartnern – im Bereich Arbeit und Wirtschaft ab: Die Wirtschaftspolitik setzt mit Subventionen und Förderprogrammen bereits große Anreize für industrielle Anpassungsprozesse. Arbeitsmarktpolitische Instrumente, insbesondere die Weiterbildungsförderung oder das Kurzarbeitergeld werden bereits für notwendige Anpassungen auf Seiten der Arbeitskräfte eingesetzt. Die Gestaltung der sozial-ökologischen Transformation wird also verstärkt als Staatsaufgabe verstanden. Möglicherweise wandelt sich der Staat aktuell damit tatsächlich, wie Kaufmann bereits vor zwanzig Jahren skizzierte, vom bloß ‚intervenierenden‘ Sozialstaat zu einem „Steuerungsstaat“, der sich die Gewährleistung des „unschädlichen Zusammenspiels der Eigendynamik der verschiedenen sozialen Systeme“ (Kaufmann 2002) zur Aufgabe macht. Ganz konkret entstehen im Bereich ‚grüner Stahl‘ derzeit große Modellvorhaben der industriellen Transformation, in denen ein neues tripartistisches und industriepolitisches Zusammenspiel bei der Gestaltung von Transformationsprojekten erprobt und die Rahmenbedingungen erforscht werden. So wird derzeit in Bremen die Umstellung des Stahlwerks auf Wasserstofftechnologie aus EU-, Bundes- und Landesmitteln gefördert und durch einen von der IG-Metall initiierten Beschäftigungspakt begleitet. Und schließlich stellt sich, drittens, die ‚alte‘ Frage nach neuen gesellschaftlichen Interessenskoalitionen in bislang ungekannter Dringlichkeit. Seit einigen Jahren werden politische und wissenschaftliche Debatten im Gewerkschaftslager über das politische Potential einer „Mosaiklinken“ (Urban 2009; Aulenbacher 2021 u.a.) als Vorbotin neuer gesellschaftlicher Koalitionen für die Gestaltung einer Transformation der Arbeits- und Sozialpolitik geführt und ausgelotet. Sicherlich wird auch die Forschung zu den neuen sozialen Bewegungen helfen zu verstehen, inwiefern sich die junge Klimabewegung von einer ‚unbürgerlichen‘ (und teilweise wieder kriminalisierten) zu einer gesellschaftlich anerkannten und wirkmächtigen politischen Kraft entwickeln kann und Bündnisse zur Durchsetzung konkreter politischer Anliegen zu knüpfen vermag (Brand 2017). Kurz – eine der zentralen aus der Sozialpolitikforschung heraus formulierten Frage wird ohne Zweifel die Grundsatzfrage nach einem Wandel der polit-ökonomischen Interessenskonstellation und die Rolle der öffentlichen Hand in diesen Prozessen sein.
Literatur
Aulenbacher, B., Deppe, F., Dörre, K., Ehlscheid, C. und Pickshaus, K. (Hg.) (2021). Mosaiklinke Zukunftspfade. Gewerkschaft, Politik, Wissenschaft. Münster, Westfälisches Dampfboot.
Brand, K.-W. (2017). Zur Problematik der Steuerung sozial-ökologischer Transformationsprozesse. In: ders. (Hg.) Die sozial-ökologische Transformation der Welt: ein Handbuch. K.-W. Brand. Frankfurt, Campus Verlag: 117-154.
Brand, U. (2019). "In der Wachstumsfalle." Die Gewerkschaften und der Klimawandel. Blätter für deutsche und international Politik 7: 79-88.
Castel, R. (2005). Die Stärkung des Sozialen. Hamburg, HIS Verlagsgesellschaft.
Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, Polity Press.
Eversberg, D. (2023). "Anpassung, Verteilung, Externalisierung: Drei Dimensionen des sozial-ökologischen Transformationskonflikts." PROKLA. 53 (210): 137-159.
Kaufmann, F.-X. (2002). Diskurse über Staatsaufgaben. Sozialpolitik und Sozialstaat: Soziologische Analysen, Springer: 297-321.
Koch, M. (2019). "Nachhaltige Wohlfahrt." Kursbuch 55 (197): 177-190.
Streeck, W. (2021). Zwischen Globalismus und Demokratie: Politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus: Suhrkamp Verlag.
Urban, H.-J. (2009). "Die Mosaik-Linke. Vom Aufbruch der Gewerkschaften zur Erneuerung der Bewegung." Blätter für deutsche und internationale Politik (5): 71-78.
Silke Bothfeld 2023, Welche Rolle für die Gewerkschaften in einer neuen Interessenskonstellation für die sozial-ökologische Transformation?, in: sozialpolitikblog, 08.06.2023, https://difis.org/blog/?blog=65 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Silke Bothfeld ist Politikwissenschaftlerin und Professorin im Internationalen Studiengang Politikmanagement an der Hochschule Bremen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Sozialpolitik, insbesondere Arbeitsmarkt-, Gleichstellungs- und Familienpolitik sowie der vergleichenden Sozialstaats;forschung. Sie ist Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung (SAMF) sowie Vorsitzende der Sachverständigenkommission für den Vierten Gleichstellungsbericht mit dem Schwerpunkt "Gleichstellung in der sozialökologischen Transformation".