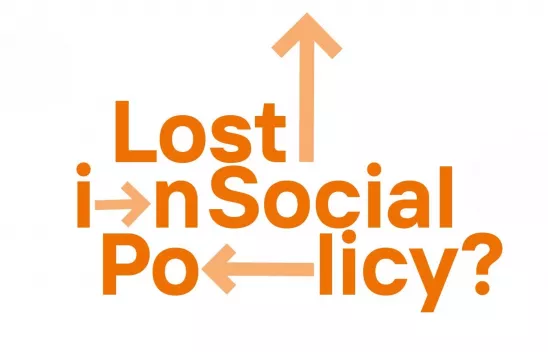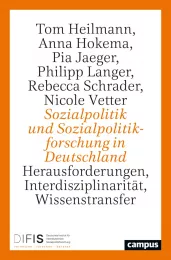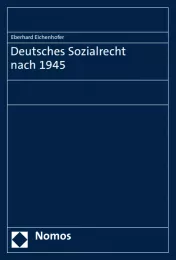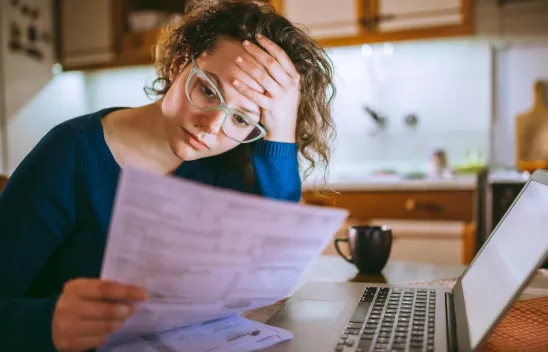Warum Ländervergleiche für Sozialpolitik wichtig sind
Sozialpolitik ist angesichts von Krisenlagen zu schnellen Reaktionen gezwungen. Hilft in solcher Situation der Vergleich mit anderen Ländern? Ja, findet Prof. Traute Meyer von der University of Southampton. Denn davon können sozialpolitische Praktiker*innen und Forschende lernen – auch über ihr Verhältnis zueinander.
Journalist*innen blicken gern ins Ausland, zum Beispiel um die Gegenwart durch den vergleichenden Rückblick zu verstehen. So stand etwa in einem Kommentar der Financial Times nach Wahl des „Kontinuitätkandidaten“ Olaf Scholz zum Kanzler am 4. Oktober 2021, dass die Deutschen wegen ihrer Erfahrung mit Faschismus weniger leicht in den Bann populistischer Führungsfiguren geraten als Großbritannien und die USA. Ein anderes Motiv für den journalistischen Vergleich ist, das eigene Land vor Problemen zu warnen, die anderswo bereits eingetreten sind, etwa wenn die gesellschaftlichen Folgen von Kürzungen für Sozialhilfeempfänger in den USA beschrieben und vor Nachahmung gewarnt wird (Guardian, 18 November 2015).
Politiker*innen vergleichen ebenfalls. So riet ein Ex-Berater britischer und australischer Premierminister dem britischen Oppositionschef Starmer, sich an den progressiveren Regierungen Europas ein Beispiel zu nehmen, ganz wie Schröder, Blair und Clinton sich einst gegenseitig inspiriert hätten (FT 2 April 2022). Auch internationale Akteure nutzen den Vergleich. Beispielsweise glaubt der Direktor des Verbandes Age International, dass Menschen überall ein Bedürfnis nach Gesundheit, einem Einkommen und Sicherheit haben (2022). Die International Labour Organisation (ILO) vergleicht die Interessen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Regierungen verschiedener Länder, um Gemeinsamkeiten zu finden für die Entwicklung tragfähiger Strategien im Kampf gegen Covid19 (ILO 2022).
In der sozialwissenschaftlichen Forschung nutzen wir den Ländervergleich, um die Entstehung und Wirkung von Wohlfahrtstaaten zu verstehen. Zum Beispiel wird gefragt, warum Land X sozialpolitische Reformmöglichkeiten hat, die Land Y und Z verstellt sind – sichtbar wird die Besonderheit in Land X erst durch den Vergleich mit Y und Z. Die Sozialstaatsforschung hat auf diesem Weg Faktoren etabliert, die unterschiedliche Regime sozialer Sicherung erklären. Dazu gehören ökonomische Stärke, politische Mobilisierung und demokratischer Wettbewerb, die Pfadabhängigkeit von Reform durch die Struktur staatlicher Institutionen, religiöse und kulturelle Traditionen, Werte und Meinungen, internationale Akteure, Kriege und Katastrophen.
Was die Praxis aus dem Ländervergleich der Forschung lernen kann – und was nicht
Die bisherigen Überlegungen illustrieren, dass akademische Akteur*innen, Praktiker*innen und Journalist*innen aus ähnlichen Gründen vergleichen: um Unterschiede und Ähnlichkeiten zu beschreiben, damit deren Ursachen besser verstanden werden, und Lösungen für Probleme entwickelt werden können. Die wissenschaftliche Perspektive ist systematischer, aber dafür nicht unbedingt auf die drängenden Fragen der Praxis zugeschnitten.
Forscher*innen analysieren zum Beispiel umfangreiche Datensätze, um festzustellen, welchen Unterschied verschiedene Typen von Wohlfahrtsstaaten für soziale Ungleichheit, Einstellungen, oder Gesundheit und Lebenserwartung machen. Dies hat ergeben, dass Armut und Ungleichheit in liberalen Wohlfahrtsstaaten wie Großbritannien ausgeprägter ist als in sozialdemokratischen wie Dänemark oder konservativen wie Deutschland oder Österreich. Von Sozialpolitiker*innen in liberalen Ländern wird daher erwartet, dass Armutsbekämpfung eine unvermeidliche Priorität ist, wohingegen Reformer*innen in sozialdemokratischen und konservativen Ländern zunächst die Kosten ihrer teuren Programme kontrollieren müssen und für Neues weniger Spielraum bleibt.
Diese Ergebnisse können Praktiker*innen zeigen, warum in ihren Ländern bestimmte Probleme mehr oder weniger stark ausgeprägt sind und dabei helfen, Handlungsspielraum einzuschätzen. Sie liefern allerdings keine präzisen Antworten darauf, was im Einzelfall getan werden kann, und wie weit institutionelle Zwänge wirklich gelten oder auch ignoriert werden können, wenn zum Beispiel die Mauer fällt, die Banken zu kollabieren drohen, eine Pandemie auftritt, oder andere Fragen von großer Tragweite (auch) für die sozialpolitische Praxis zu plötzlichen Entscheidungen zwingen. Hier wiederum muss die Theorie von der Praxis lernen, sozialpolitisches Handeln in Krisen zeigt der Wissenschaft, ob sie die Macht von Institutionen überschätzt hat.
Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen haben unterschiedliche Perspektiven, aber diese Beispiele zeigen, dass der Ländervergleich für beide Seiten produktiv ist. Wenn wir ein gemeinsames Interesse daran voraussetzen können, dann muss dies auch eine Basis sein für die Kooperation zwischen Handelnden in der Praxis und Wissenschaft, im Interesse besserer Sozialpolitik.
Den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis einem Ländervergleich unterziehen
Aus vergleichender Perspektive lässt sich darüber hinaus auch etwas über die Rahmenbedingungen lernen, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis fördern oder erschweren. In vielen Ländern müssen Forschende zunehmend ihren gesellschaftlichen Nutzen demonstrieren. Zu den guten Erfahrungen mit dieser „Impact Agenda“ (Bandola-Gill et al. 2021) gehören ein verbessertes Verständnis der Wissenschaftler*innnen für die sozialpolitische Praxis. Dies kann zu relevanteren Forschungsfragen und größerer akademischer Interdisziplinaritat führen (Geddes et al 2018) und Anreize schaffen, Forschungsfragen und -ergebnisse so zu formulieren, dass sie für einen größeren Kreis von Menschen verständlich sind.
Es gibt aber auch eine problematische Seite, wenn sich Sozialwissenschaft vorrangig über ihren gesellschaftlichen Nutzen legitimieren muss und hier kann die Sozialpolitikforschung wiederum durch den Vergleich lernen. Der britische Justizminister Gove antwortete 2016 auf die Frage, warum so viele Akademiker*innen und Praktiker*innen gegen Brexit seien, mit dem Satz „das britische Volk hat jetzt genug von Experten“. Forschung, die nur beleuchten kann, was die Regierenden nützlich finden, ist nicht mehr unabhängig. Die Kritik an der „Impact Agenda“ ist auf diesem Hintergrund gewachsen. Ihr wird vorgehalten, dass sie Forschungsfragen durch praxisbetonte Förderkriterien verengt, dass sie wissenschaftliche Qualität mit praktischem Erfolg gleichsetzt, dass sie akademische Unabhängigkeit und Kreativität einschränkt und dass damit der Staat als Finanzier von Forschung und nicht die Forschenden selbst akademische Exzellenz definieren (Bandola-Gill 2021 et al.).
In Deutschland ist die Impact-Agenda bisher weniger institutionalisiert als in Großbritannien, und dies ist eine Chance für intrinsisch motivierte Kooperation. Vor diesem Hintergrund möchte man der sozialpolitischen Forschung – und ganz besonders dem DIFIS – wünschen, dass es die Vorteile der vergleichenden Perspektive für Theorie und Praxis auch weiterhin nutzen wird, dass der Vergleich vor allem dazu dient, zu verstehen, wo wir in der Sozialpolitik stehen und wohin wir gehen können, und dass die Kooperation zwischen Forschenden und sozialpolitisch Aktiven auch weiterhin öffentlich unterstützt wird, aber freiwillig bleiben kann, bestimmt von gemeinsamem Interesse an relevanten Ergebnissen, statt einer administrativ-politischen Definition von Nützlichkeit.
Literatur
Age International 2022. https://www.ageinternational.org.uk/news-features/news/2022/farewell-to-our-founding-leader/ (Zugang: September 2022).
Bandola-Gill, J., et al. 2021. "Co-option, control and criticality: the politics of relevance regimes for the future of political science." European Political Science 20(1): 218-236.
Guardian, 18. November 2015. America’s welfare state is shameful, the UK shouldn’t follow our lead.
Geddes, M., et al. 2018. "A recipe for impact? Exploring knowledge requirements in the UK Parliament and beyond." Evidence & Policy 14(2): 259-276.
Financial Times, 2. April 2022. Starmer can learn from centre-left success stories across Europe.
Financial Times, 4. Okober 2021. Why Germany is the west’s sanest country.
Flinders, M., et al. 2016. "The politics of co-production: risks, limits and pollution." Evidence & Policy 12(2): 261-279.
ILO 2022. Global South-South Expo 2022 – ILO solution forum “Building multi stakeholder alliances in the Global South to Build Back Better” https://www.ilo.org/pardev/south-south/WCMS_854574/lang--en/index.htm, (Zugang September 2022).
Traute Meyer 2023, Warum Ländervergleiche für Sozialpolitik wichtig sind, in: sozialpolitikblog, 27.07.2023, https://difis.org/blog/warum-laendervergleiche-fuer-sozialpolitik-wichtig-sind-72 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Traute Meyer ist Professorin für Sozialpolitik an der School of Economic, Social and Political Sciences, University of Southampton (UK) und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des DIFIS. In ihrer Forschung hat der Ländervergleich immer eine wichtige Rolle gespielt, sie interessiert sich insbesondere für den Zusammenhang zwischen Wohlfahrtsstaatsregimes und sozialer Ungleichheit in Europa im Hinblick auf Rentensysteme und Migration.