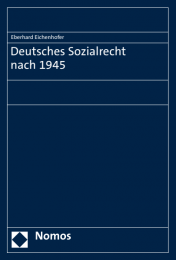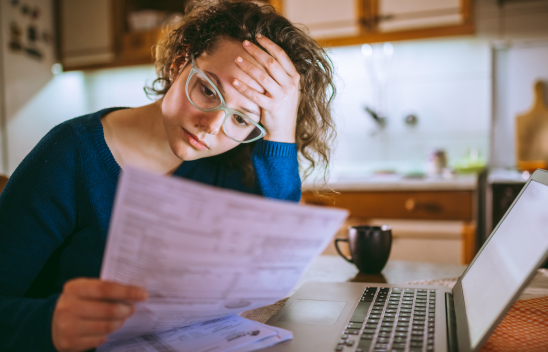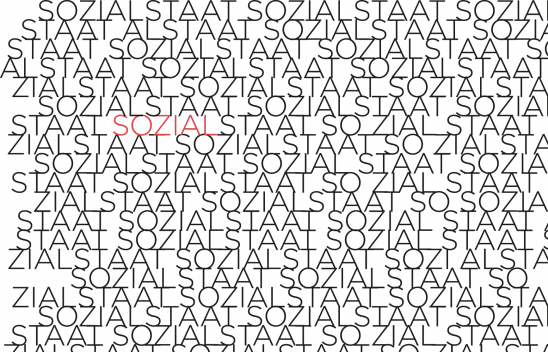Prioritätensetzung in der Sozialpolitik – eine vernachlässigte Debatte
Die Finanzierung der Sozialpolitik in Deutschland stößt schon jetzt an ihre Grenzen und wird demografisch bedingt noch voraussetzungsvoller. Daher ist eine normativ breit akzeptierte und empirisch gestützte Debatte über Prioritätensetzungen überfällig.
Deutschland weist eine im Trend deutlich zunehmende Sozialleistungsquote auf, die Sozialausgaben wachsen seit Jahren stärker als das Sozialprodukt. Aktuell erfordern zudem die erhöhten Ausgaben für Verteidigung und für die Bewältigung der „grünen“ und „digitalen“ Transformation sowie die wieder stark steigende Zinslast hohe zusätzliche Ausgaben. Zugleich nehmen im demographischen Wandel sozialpolitische Bedarfe zu. Insbesondere pflegerischen Versorgungserfordernissen kommt eine wachsende Bedeutung zu, weil nach offiziellen Vorausberechnungen die Zahl der pflegebedürftigen Menschen ebenso wie die Zahl der Kinderlosen je Kohorte weiter zunehmen wird.
Angesichts sich abzeichnender zusätzlicher Finanzierungsbedarfe auch für andere Politikbereiche ist eine Debatte, welche sozialpolitischen Maßnahmen künftig noch möglich und sinnvoll sind, naturgemäß hoch normativ. Auffallend ist aber, dass dabei nahezu ausschließlich die Frage dominiert, welche sozialpolitischen Defizite welche zusätzlichen Interventionen mit welchem finanziellen Mehraufwand erfordern. Demgegenüber gibt es keinen intensiven Diskurs über eine mögliche Aufgabenkritik bestehender sozialpolitischer Leistungen oder über eine Priorisierung oder De-Priorisierung neuer und zusätzlicher Leistungen. Dafür fehlt es erstens an einem allgemein akzeptierten normativen Referenzsystem, zweitens an einer vielfach fehlenden Evidenz und drittens auch an einer belastbaren Evaluationskultur. Daher ist es Zeit für einen neuen Anlauf in der sozialpolitischen Wirksamkeitsforschung.
Eine investive und lebenslaufbezogene Sozialpolitik sollte Bestandteil eines Referenzsystems sein.
Für ein normatives Bezugssystem ist der Grundgedanke der investiven Sozialpolitik weiterführend. Er betont, dass sozialpolitische Maßnahmen entweder zukünftige Einnahmen (z.B. Erträge der Ausgaben für Bildung und Beschäftigungsförderung) generieren oder zu verminderten Ausgaben (z.B. durch präventive statt kompensatorischer Maßnahmen der Gesundheitsförderung) führen sollen. Leitbild für Sozialinvestitionen ist es, durch vorausschauendes Agieren die gegenwärtigen und künftigen Fähigkeiten der Menschen zu stärken (Cremer, 2021). Dies knüpft an früheren Überlegungen zur Produktivitätsfunktion von Sozialpolitik und die durch sie zu vermittelnden Handlungspotenziale („agencies“) der Menschen an (Preller, 1962). Beispiele hierfür sind etwa die frühkindliche Erziehung und Betreuung, die Jugend- und Gesundheitsförderung, die allgemeine und berufliche Bildung im Laufe des Lebens, eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Unterstützung von guten Arbeitsbedingungen, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zur Vorbereitung auf Ruhestand und Alter sowie eine aktivierende Senioren- und Pflegepolitik.
Wird die Idee der investiven Sozialpolitik mit der Lebenslaufanalyse verknüpft, kann zudem auch zwischen verschiedenen Lebensphasen und den hier jeweils bestehenden sozialpolitisch relevanten Bedarfen unterschieden werden, etwa für Kinder, junge Erwachsene, Menschen im erwerbsfähigen Alter, Rentner und Pflegebedürftige. Dadurch können auch die Wirkungen von Zusammenhängen zwischen lebensphasentypischen Risiken und ihrer sozialpolitischen Bearbeitung durch rechtzeitig eingeleitete Sozialinvestitionen auf vorherigen Stufen des Lebenslaufs in den Blick genommen werden, um der potenziellen Kumulation von Benachteiligungen in späteren Lebensphasen entgegenzuwirken. Dieser "Multiplikatoreffekt" investiver Wohlfahrtsleistungen gilt sowohl auf der Mikroebene von Einzelpersonen und Haushalten, indem Investitionen in früheren Lebensphasen dazu beitragen können, soziale Risiken im späteren Leben zu mindern, als auch für die Makroebene der Gesellschaft als Ganzes, etwa für eine verbesserte wirtschaftliche Produktivität, eine höhere und produktivere Beschäftigung, eine geringere Armutsgefährdung und einen späteren Renteneintritt (Hemerijck, 2022).
Ein allgemein akzeptiertes Sozialstaatskonzept scheitert bisher an einer fehlenden empirischen Basis. Und der Investitionsbegriff ist analytisch noch zu wenig trennscharf.
So eingängig der Grundgedanke eines investiven „life course multipliers“ der Sozialpolitik ist, so wenig fundiert sind bisher konzeptionelle Überlegungen sowie deren empirische Grundlagen. Zum einen wird der Begriff der „sozialpolitischen Investition“ von seinen Befürwortern gern sehr weit ausgelegt. Zwar hat sich bereits 2013 die Europäische Kommission für Sozialinvestitionen als Motor für Wachstum und sozialen Zusammenhalt stark gemacht, vermag diese aber bis heute weder definitorisch noch statistisch trennscharf abzugrenzen. Nach diesem Ansatz sind „Sozialinvestitionen“ lediglich „alle staatlichen Leistungen, die die Fähigkeiten und Qualifikationen der Menschen stärken“ (European Commission, 2013; zu einem Assessment der Entwicklung seither vgl. de la Porte und Palier, 2022). Es bleibt bisher unklar, was Sozialinvestitionen genau sind. Je nach Abgrenzung kommen empirische Studien zur Entwicklung von Sozialinvestitionen zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen (Heitzmann und Matzinger, 2015).
Erschwerend kommt zum anderen hinzu, dass es für weite Bereiche der Sozialpolitik kaum Vorbilder für Evaluationen sowie Effizienz- und Effektivitätsanalysen gibt. Eine Gesamtevaluation für die Ausgabenseite der Sozialpolitik steht bisher aus, so wie sie etwa für den Bereich der Familienpolitik durch das BMFSFJ im Rahmen einer „Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Maßnahmen und Leistungen“ versucht wurde. Dabei wurden erstmals zentrale Instrumente der deutschen Familienpolitik hinsichtlich ihrer Zielerreichung systematisch und umfassend evaluiert (BMFSFJ, 2014). Allerdings sind solche umfassenden Evaluationen nicht nur konzeptionell, sondern auch in ihren Wirkungsanalysen hoch voraussetzungsvoll. So können viele Maßnahmeneffekte z.T. erst lange nach der Intervention ermittelt werden (z.B. Outcomes im Bereich der Gesundheitsförderung), sind Effekte und Evidenzen häufig instabil, volatil und zeitvariant, gibt es Time-lags von Wirkungen und Lock-in Effekte, Effekte „verblassen“ mit der Zeit und Kausalitäten werden immer unklarer.
Es ist Zeit für einen neuen Anlauf in der sozialpolitischen Wirksamkeitsforschung.
Im Rahmen einer zu entwickelnden Evidenz- und Evaluationsbasierung eröffnet ein normatives Referenzsystem einer investiven und lebenslaufbezogenen Sozialpolitik zusätzliche bzw. ganz neue Optionen für eine Debatte um Prioritäten und De-Priorisierungen sozialstaatlichen Handelns. Bisher ist Sozialpolitik in Deutschland traditionell stark domänenspezifisch ausgeprägt (z.B. Alterssicherung, Familie, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Bildung), was sich institutionell im Sozialbudget und in verschiedenen Sozialgesetzbüchern niederschlägt. Dies gilt übrigens auch für internationale Vorbilder wie das ESSOSS-Handbuch der EU oder das SOCX-Konzept der OECD.
Plädiert wird deshalb hier für einen Lebenslaufzugang über den reinen Domänenbezug hinaus mit dem Ziel, auf der Basis bestehender standardisierter Berichtssysteme sozialpolitische Interventionen über verschiedene institutionelle Domänen hinweg zu kategorisieren und somit zu neuen Wirkungsanalysen im Sinne von Langfristeffekten zu gelangen. Eine derartige Nutzung bestehender Domänen für eine auf lebenslaufbezogene Wirkungen basierende Weiterentwicklung würde auch eine Evaluation ermöglichen, bei der Statusveränderungen und Statuspassagen entlang einer Biografie (z.B. Schule - Ausbildung; Bildung - Beruf; Beruf - Erwerbstätigkeit; Nichterwerbstätigkeit - Erwerbstätigkeit; Erwerbstätigkeit - Nichterwerbstätigkeit) eher berücksichtigt werden können. Im Kern geht es um die Frage, inwieweit die soziale und berufliche Mobilität und die darauf bezogene individuelle Befähigung und Handlungskompetenz im Lebenslauf durch treffsichere Investitionen in der jeweiligen „Domäne“ zum richtigen Zeitpunkt verbessert werden können. Es liegt nahe, derartige Analysen auch für die Ableitung von Prioritäten (bzw. De-Priorisierungen) bei der Entwicklung sozialpolitischer Interventionen und deren Finanzierung zu nutzen.
Literatur
BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2014). Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Maßnahmen und Leistungen in Deutschland, Endbericht, Berlin
Cremer, Georg (2021). Sozial ist, was stark macht. Warum Deutschland eine Politik der Befähigung braucht und was sie leistet. Freiburg: Herder.
De la Porte, Caroline; Palier, Bruno (2022). The Politics of European Union`s Social Investment Initiatives, in: Garritzmann, Häusermann, Palier (eds.), The World Politics of Social Investment (Vol I). Oxford: Oxford University Press, 132-169.
European Commission (2013). Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020, Brussels, COM (2013) 83 final.
Heitzmann, Karin; Matzinger, Sandra (2018). Zur Konzeptualisierung von Sozialinvestitionen auf Basis der ökonomischen Humankapitaltheorie. Zeitschrift für Sozialreform, 64 (3), 363-386, https://doi.org/10.1515/zsr-2018-0019.
Hemerijck, Anton; Ronchi, Stefano und Plavgi, Ilze (2023). Social investment as a conceptual framework for analysing well-being returns and reforms in 21st century welfare states. Socio-Economic Review, 21 (1), 479–500, https://doi.org/10.1093/ser/mwac035.
Naegele, Gerhard (Hrsg.) (2011). Soziale Lebenslaufpolitik, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Preller, Ludwig (1962). Sozialpolitik: Theoretische Ortung, Tübingen: J.C.B. Mohr.
Hans-Peter Klös und Gerhard Naegele 2023, Prioritätensetzung in der Sozialpolitik – eine vernachlässigte Debatte, in: sozialpolitikblog, 11.05.2023, https://difis.org/blog/?blog=61 Zurück zur Übersicht

Dr. Hans-Peter Klös ist Volkswirt und war bis August 2022 Leiter Wissenschaft des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Im Rahmen von Kommissionen, Beiräten und Beratungstätigkeiten war er verantwortlich für die Vernetzung der IW-Forschung mit Ministerien, Verbänden, Wissenschaft, Politik und NGOs. Zuletzt war er Mitglied der High Level Group der Europäischen Kommission „The Future of the Welfare State“ und ist aktuell stellvertretendes Mitglied im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss.

Prof. Dr. Gerhard Naegele ist Sozialwissenschaftler und war bis 2017 Direktor des Instituts für Gerontologie an der TU Dortmund und dort zuvor Inhaber des Lehrstuhls für Soziale Gerontologie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Sozialpolitik, demografischer Wandel mit Schwerpunkt Arbeitswelt, Pflegepolitik und soziale Dienstleistungen. Er ist Autor zahlreicher einschlägiger Veröffentlichungen und ist heute in der wissenschaftlichen Politikberatung auf EU-, Bundes- und Landesebene tätig.