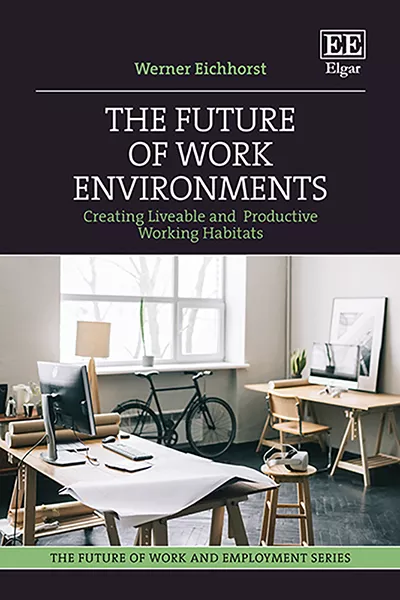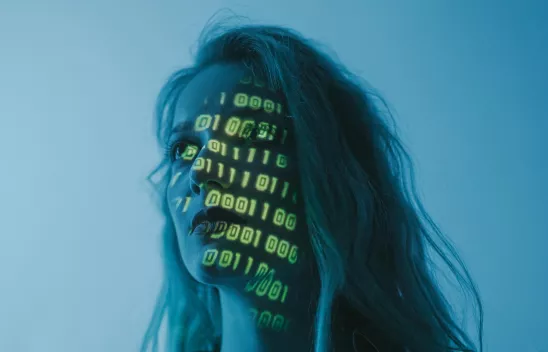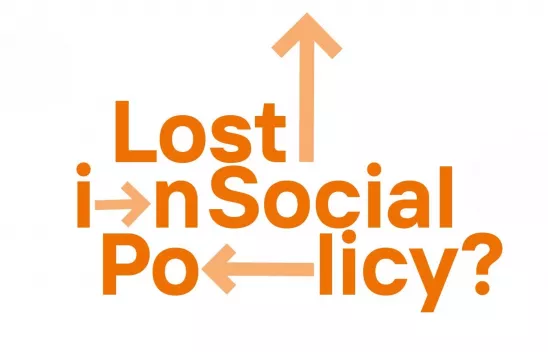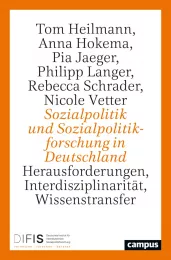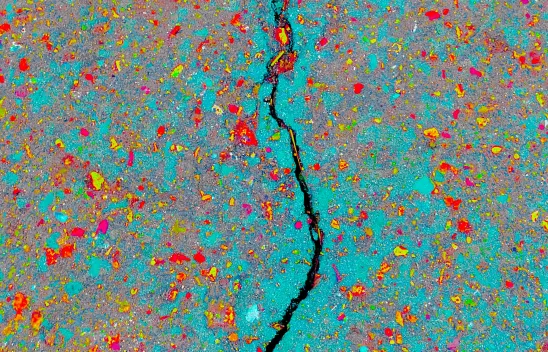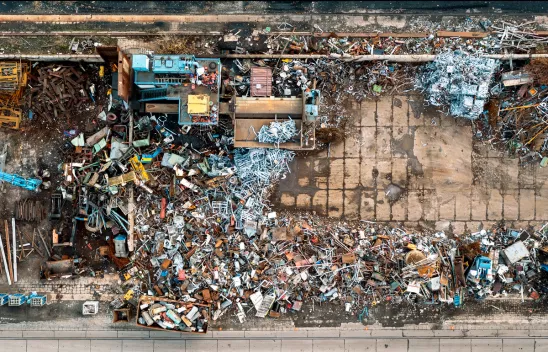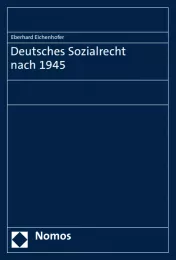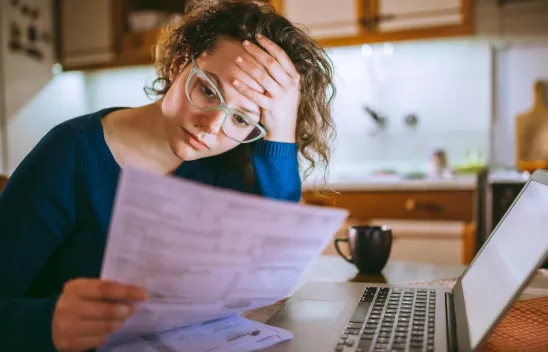Welche Bedeutung hat die Europawahl für die Sozialpolitik?
Die Europawahlen stehen unmittelbar bevor. In Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Welche Bedeutung kommt diesen Wahlen für die Sozialpolitik zu? Im ersten Teil dieses Interviews zur Europawahl ziehen PD Dr. habil. Jana Windwehr und Torben Fischer eine Bilanz der Von-der-Leyen-Kommission.
Interview: Frank Nullmeier
Die Europäische Union besitzt nur begrenzte Kompetenzen in der Sozialpolitik und europäische Sozialpolitik ist etwas anderes, als wir das von der nationalen Ebene kennen. In den letzten Jahren ist aber durchaus einiges passiert. Ist die Europäische Kommission ein Motor der Sozialpolitik gewesen?
Windwehr: Man muss bis in die Amtszeit von Jean-Claude Juncker (2014-2019) zurückgehen, um den Wandel zu verstehen: Im Jahre 2017 erfolgte die Unterzeichnung der Europäischen Säule sozialer Rechte. Und dieses Dokument ist auch unter der von Frau Von der Leyen geführten Europäischen Kommission Grundlage der Arbeit geblieben. Gegenüber der Europäischen Säule sozialer Rechte gab es zunächst große Skepsis in der Wissenschaft, man hielt die Deklaration für einen Papiertiger und erwartete keine erfolgreichen Umsetzungsinitiativen. Heute kann man sagen, es ist überraschenderweise ein wichtiges Referenzdokument geworden, auf dessen Basis konkrete neue Initiativen für Richtlinien der EU entstanden sind. Insofern können die letzten fünf Jahre sozialpolitisch als Follow-up-Prozess für die Europäische Säule sozialer Rechte verstanden werden. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich die Mindestlohnrichtlinie, von der man annahm, dass die EU sich diesem Thema gar nicht annehmen könne. Schließlich ist Lohnpolitik ein Thema, das ausdrücklich nicht zum Kompetenzbereich der Europäischen Union gehört. Auf Umwegen – nämlich mittels des Arguments, dass es um Arbeits- und Lebensbedingungen gehe – ist die Richtlinie aber doch gekommen, wenn auch sicherlich nicht in der Form, wie sich das die ambitioniertesten Player vielleicht gewünscht hätten.
Lassen sich noch andere Beispiele finden?
Windwehr: Der zweite wichtige Baustein der Von-der-Leyen-Kommission sind sicherlich die krisengetriebenen Instrumente, man denke an die Pandemie, nun der russische Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Lebenshaltungskosten- und Energiekrise. Darauf wurde reagiert mit auch sozialpolitisch wichtigen Maßnahmen. Im Gesundheitsbereich zum Beispiel gab es die gemeinsame Impfstoffbeschaffung. Man ist so einige Schritte weiter gegangen in Richtung von mehr gemeinsamer Verantwortung für Lieferketten. Dann war das Thema Kurzarbeit in der Pandemiezeit sehr wichtig, geregelt über ein europäisches Instrument (SURE), das eine Art europäisches Kurzarbeitergeld bzw. dessen Refinanzierung bereitstellte und mehrheitlich als Erfolgsmodell betrachtet wird. Zu den krisengetriebenen Punkten gehört natürlich auch das große Paket NextGenerationEU, auch wenn das nicht nur, nicht einmal primär sozialpolitisch ausgerichtet ist, sondern die doppelte Transformation, also die grüne und die digitale, vorantreiben soll. Das sind die großen Maßnahmen, die auch finanziell bedeutend sind. Daneben wäre noch einzelne weitere Punkte wie die heiß diskutierte und erst kürzlich verabschiedete Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit zu nennen oder die Entgelttransparenzrichtlinie.
Fischer: Ein wichtiger Punkt der Von-der-Leyen-Kommission war von Anfang an der European Green Deal. Er gilt als das große Projekt ihrer Kommissionszeit. Mit dem Just Transition Fund wird die soziale und die ökologische Komponente nicht nur ideell vorangetrieben, sondern konkret mit Mitteln hinterlegt, sodass Regionen, die stark von fossiler Industrie abhängig waren, in ihrem Wandel unterstützt werden. Ein weiterer Klima-Sozialfonds wurde aufgesetzt im Kontext des EU-Emissionshandels für Emissionen aus dem Gebäude- und Straßenverkehrssektor (ETS II) für die Zeit nach 2027. Damit kann man über diesen neuen sozialen Klimafonds vulnerable Gruppen schützen, wenn sie erhöhte Mobilitätskosten oder erhöhte Kosten im Gebäude- bzw. Energiebereich tragen müssen.
Wie eng ist die Europäische Säule sozialer Rechte mit den einzelnen Initiativen verknüpft? Werden die Initiativen aus der Europäischen Rolle sozialer Rechte hergeleitet, ist das ein konsistenter programmatischer Zusammenhang?
Windwehr: Ich würde sagen: ja. Es gibt Dokumente, die explizit für den Follow-up-Prozess dieser Europäischen Säule sozialer Rechte gedacht waren, vor allem der entsprechende Aktionsplan, in dem die nächsten Schritte aufgelistet werden, um genau dem Vorwurf, das sei doch alles nur nettes Window-Dressing, entgegenzuwirken. Auch das Social Scoreboard, mit dem soziale Indikatoren gemessen und regelmäßig veröffentlicht werden, ist schon ein sichtbarer Fortschritt. Es gibt aber auch Themen in der Europäischen Säule sozialer Rechte, die vorerst nur recht abstrakt auf der Agenda stehen, aber noch keine Umsetzung gefunden haben, so die Forderung, dass alle Mitgliedsstaaten ein soziales Mindesteinkommen festlegen sollen. Aber in den Dokumenten wird sich wirklich gebetsmühlenartig auf die Europäische Säule sozialer Rechte bezogen. Zumindest in der Anfangszeit nach Verabschiedung der Säule im Jahr 2017 ist dies bei nationalen Berichtsdokumenten weit weniger der Fall gewesen. Es bleibt zudem die Hoffnung, dass auch der Europäische Gerichtshof in Zukunft dieses Dokument stärker in Betracht ziehen und so dem Vorwurf, die Binnenmarktfreiheiten hätten am Ende doch ohnehin Vorrang, ein wenig entgegentreten könnte. Der Symbolwert der Säule ist nicht zu unterschätzen.
Fischer: Man hat mit dem Sozialgipfel in Porto 2021 einen Aktionsplan verabschiedet, dem alle wichtigen europäischen Akteure zugestimmt haben. Mit diesem wurde versucht, stringent Initiativen aus den 20 Rechten der Säule abzuleiten, und so ein relativ verbindlicher Fahrplan für die nächsten Jahre entworfen. Im Vergleich zum Vorgänger, der Europa-2020-Strategie wurde so eine höhere Verbindlichkeit für arbeitsmarkt- und sozialpolitische Maßnahmen geschaffen.
Wenn der Entwicklungspfad der Von-der-Leyen-Kommission fortgesetzt werden könnte, was wären dann die nächsten Schritte?
Fischer: Auf dem Portogipfel wurden drei Zielwerte für 2030 definiert, nämlich, dass mindestens 78 % der Bevölkerung in Beschäftigung sein sollen, dass mindestens 60 % der Bevölkerung pro Jahr an einem Training oder einer Weiterbildung teilnehmen und dass mindestens 15 Millionen Menschen weniger in Armut sein sollen. Das bleiben auch die Zielvorgaben für die nächste Kommission. Zudem ist am 16. April 2024 unter der belgischen Ratspräsidentschaft, die nach dem Tagungsort so benannte La Hulpe Declaration, verabschiedet worden. Darin ist relativ ambitioniert versucht worden, die sozialpolitischen Dossiers noch voranzubringen – nicht zuletzt im Sinne einer Haltelinie, falls sich die politische Situation nach der Wahl verschlechtert – und einen verbindlichen Rahmen dafür festzulegen, was die Kommission in Zukunft tun soll. Die Kommission wird viel damit beschäftigt sein, angemessenen sozialen Schutz und die notwendigen Bedingungen für qualitative Arbeit und Jobs im Prozess der Zwillings-Transformation aus digitaler und ökologischer Transformation zu definieren. Das heißt auch, die Rechte von entsendeten Arbeitnehmer*innen zu stärken, indem zum Beispiel die European Labour Authority mehr Kompetenzen erhält. Zu nennen ist auch die Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt, etwa bei der Work-Life-Balance, mit dem Hintergrund, dass noch mehr Frauen in Beschäftigung kommen sollen. Das sind alles Elemente eines Social-Investment-Ansatzes, der ja über die letzten Jahre eine wichtige Rolle auf europäischer Ebene gespielt hat und in der La Hulpe Declaration explizit genannt wird, womit Sozialpolitik nicht mehr allein als Kostenfaktor, sondern auch als ein produktiver Faktor gedacht wird, als Grundlage für eine prosperierende Wirtschaft und für ein gutes Sozialsystem.
Während sich darüber alle Parteien der Mitte einig zu sein scheinen, entsteht, sobald Finanzierungsfragen zu klären sind, ein Konflikt nicht zwischen Mitte-Parteien einerseits und populistischen Parteien rechts und links andererseits, sondern genau in der Mitte.
Windwehr: Das stimmt. Das ist kein Konflikt zwischen den Parteien in der Mitte und dem populistischen Rest. Im Wahlprogramm der AfD stehen ein paar Dinge drin, die keine andere Partei so fordern würde und die auch schlicht rechtswidrig sind. Also die Ablehnung von Freizügigkeit zum Beispiel, die Ablehnung von Mindeststandards und der „Genderideologie“. Aber in den ziemlich entscheidenden Fragen der gemeinsamen Schuldenaufnahme, der Volumina zukünftiger EU-Haushalte bis hin zu der Frage: Soll die Europäische Union eines Tages Steuern erheben dürfen? gehen die Konfliktlinien ziemlich quer durch die politische Mitte.
Fischer: Die Mitte-links- bis linken europäischen Parteien, also die europäischen Sozialdemokraten, die europäischen Grünen und die europäische Linke fordern eine Verstetigung des SURE-Instruments im Sinne einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung, fordern höhere Haushaltsmittel und die Verstetigung von NextGenerationEU in Form einer europäischen Investitionskapazität. Die gegensätzliche Position findet sich bei den anderen Mitte-Parteien, also Mitte-rechts, den Liberalen und der Europäischen Volkspartei, den Christdemokraten im weitesten Sinne. Das ist schon eine recht starke Konfliktlinie. Was die Verstetigung der innovativen Finanzierungsinstrumente angeht, sehen wir in der Mitte zwischen Mitte-links und Mitte-rechts einen klaren Dissens.
Wenn das Ergebnis der Europawahlen eine – relativ wahrscheinliche - Rechtsverschiebung im Parlament werden würde, welche Auswirkungen hätte das für die Kommission und deren sozialpolitischen Kurs?
Windwehr: Man muss drei Dinge im Blick behalten: Das eine sind die Mehrheitsverhältnisse im Parlament. Die werden sich den Umfragen zufolge in der Tat nach rechts verschieben, aber nicht so weit, dass man nachher erwarten müsste, dass aus dem rechtspopulistischen Lager ernsthaft eine Person als Kommissionspräsidentschaftskandidat oder -kandidatin in Frage käme. Das zweite ist das Spitzenkandidatenprinzip, mit dem man ja bisher eher ‚gemischte‘ Erfahrungen gemacht hat. Es ist schwer zu prognostizieren, wie sich nach den Europawahlen aus den Spitzenkandidaten ein Kommissionsvorsitz ergeben wird. Und das dritte ist die Zusammensetzung der Kommission selbst. Denn auf der nationalen Ebene, wo die Nominierung stattfindet für die einzelnen Kommissarsposten, haben wir in etlichen Mitgliedstaaten nach rechts hin verschobene Mehrheitsverhältnisse, man denke nur an die neue niederländische Regierungskoalition. Durch diese national bestimmten Nominierungen sind richtungspolitische Verschiebungen innerhalb der Kommission zu erwarten. Wir wissen natürlich nicht, wer welchen Kommissarsposten am Ende bekommt, also etwa bei wem das Ressort Beschäftigung und Soziale Rechte landet. Aber über Nominierungen für die Kommissionspositionen sind gravierendere Verschiebungen zu erwarten als durch das Wahlergebnis zum Europäischen Parlament.
Fischer: Ja, auch in der nächsten Legislaturperiode ist nach allen Umfragen nur eine Mehrheit in der Mitte möglich, um den Kommissionsvorsitz zu erreichen. Eigentlich kann man sich nur eine Große Koalition mit Unterstützung durch Stimmen der Liberalen und bzw. oder mit Stimmen der Grünen vorstellen. Das sind die Konstellationen, die realistisch eine Chance haben, Mehrheiten zu generieren, während die linken und die rechteren Parteien bzw. Fraktionen das allein nicht schaffen. Vor ein paar Tagen erfolgte die Bekräftigung der pro-europäischen Parteienfamilien aus Liberalen, Grünen, Linken und Sozialdemokraten, dass sie eine Zusammenarbeit mit den rechtspopulistischen und anti-europäischen Kräften im Parlament nicht befürworten. Der Aufruf erfolgte, weil sich Ursula von der Leyen in dieser Frage ein bisschen weicher gezeigt hatte. Auf der Ebene des Parlaments erfolgt – zumindest was realistische Mehrheiten angeht – also sehr wahrscheinlich keine gravierende Rechtsverschiebung, dagegen schon eher bei der Kommissionszusammensetzung und womöglich in den kommenden Jahren auch im Rat, also in den Mitgliedstaaten selbst. Und deswegen wird es aus einer proeuropäischen Sozialperspektive heraus darum gehen, die Haltelinien, die jetzt eingezogen wurden, auch in den nächsten fünf Jahren zu bewahren.
Da die europäische Sozialpolitik sehr stark auf die Ausweitung der Erwerbsarbeitsgesellschaft, auf Innovation und Wachstum ausgerichtet ist mit einem sozialpolitischen Schwerpunkt bei Social-Investment-Programmen, kann ich mir noch nicht vorstellen, was eine Rechtsverschiebung auf Seiten der Kommissionsmitglieder für die Sozialpolitik genau bedeuten würde. Sind grundlegendere Änderungen denkbar?
Windwehr: Es kommt schon sehr auf die Person des Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin an. Das zeigt der Vergleich zur Barroso-Kommission (2004-2014), die doch, um das abgenutzte Schlagwort zu bemühen, den Neoliberalismus recht gut verkörpert hat. Danach kam die Kommission Juncker (2014-2019) und hat das ziemlich anders gemacht. Und Von der Leyen hat, ob man das jetzt erwartet hat oder nicht, eher die Juncker-Linie weitergeführt, auch wegen politischer Abhängigkeiten, weil sie z.B. die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament für ihre Wahl gebraucht hat. Einzelne Personen können also einen entscheidenden Unterschied machen. Und wenn man sich den derzeitigen Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte anschaut, Nicolas Schmit, aktuell auch Spitzenkandidat der Sozialdemokraten in Europa, kann man die Wirksamkeit von Personen deutlich feststellen. Was er als Leiter der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration allein für die Sichtbarkeit von sozialen Zielen getan hat, das war schon fast ein Quantensprung. Er war sehr präsent und hat immer wieder soziale Rechte, auch gegenüber rein wirtschaftlichen Zielen oder gegenüber Angriffen auf die Budgets verteidigt.
Also unter dem Strich: Wir werden wahrscheinlich einen gewissen Rechtsruck bekommen, im Parlament, in der Kommission und über die nationale Ebene natürlich auch im Rat, der ja zentrale sozialpolitische Dossiers bekanntlich effektiv blockieren kann. Und in Fragen wie: „Wo brauchen wir neue Mindeststandards und wie streng dürfen diese werden?“, verläuft die Konfliktlinie in der Tat eher zwischen den Mitgliedstaaten, als dass sie primär parteipolitischer Art wäre, stärker sogar Ost-West als Nord-Süd.
Herzlichen Dank bis hierhin.
Den zweiten Teil des Interviews lesen Sie hier.
Jana Windwehr und Torben Fischer 2024, Welche Bedeutung hat die Europawahl für die Sozialpolitik?, in: sozialpolitikblog, 28.05.2024, https://difis.org/blog/welche-bedeutung-hat-die-europawahl-fuer-die-sozialpolitik-118 Zurück zur Übersicht

PD Dr. habil. Jana Windwehr ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Koordinatorin der deutsch-französischen Studiengänge am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin.
Bildnachweis: privat

Torben Fischer (M.A.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Systemanalyse und Vergleichende Politikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Projektmanager im Bereich Zukunftsfähiger Sozialstaat beim Zentrum für neue Sozialpolitik in Berlin.
Bildnachweis: privat