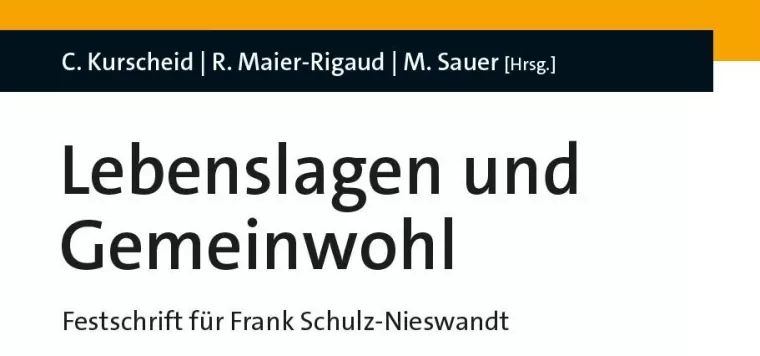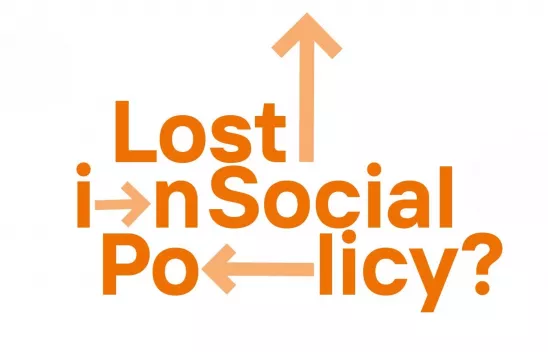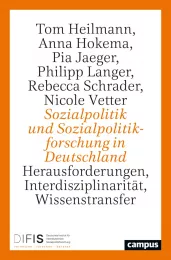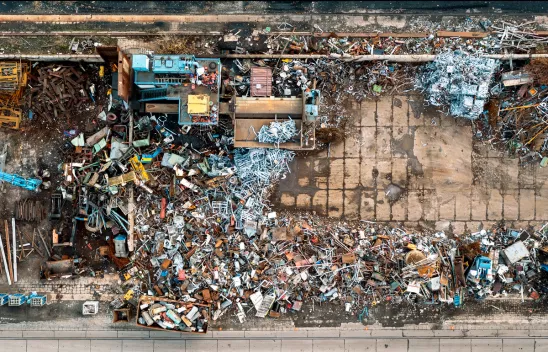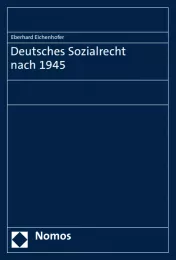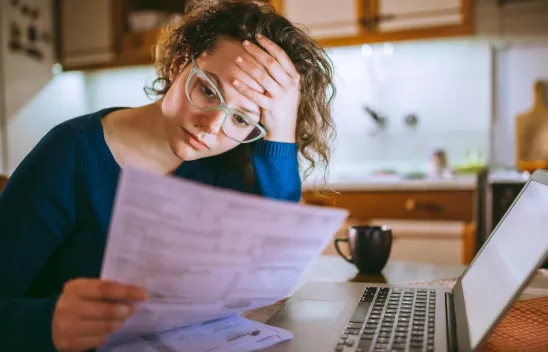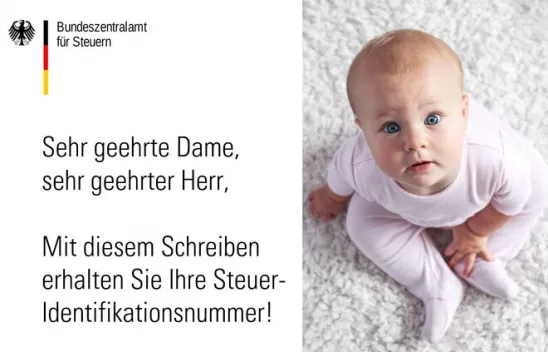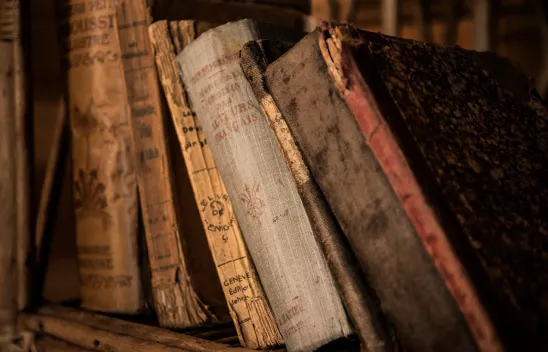Die Kölner Tradition: Mehr als nur Empirie
Sozialpolitikforschung steht vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen empirischer Analyse und normativen Zielsetzungen einer lebenswerten Gesellschaft zu finden. So lautet das Verständnis der Kölner Tradition der Sozialpolitikforschung, das in einer Festschrift für Professor Frank Schulz-Nieswandt gewürdigt wird. Dieser Blogbeitrag beleuchtet den Balanceakt eines normativ-kritizistischen Sozialpolitikverständnisses und seine Bedeutung für eine gerechte Gesellschaft.
Während sich viele Ansätze in der Sozialpolitikforschung primär auf empirische Daten und Wirkungsanalysen konzentrieren, geht die Kölner Tradition einen Schritt weiter. Sie versteht Sozialpolitik als eine Wissenschaft, die sowohl empirische als auch normative Aspekte umfasst. Anders ausgedrückt: Es geht nicht nur darum, „was ist“, sondern auch darum, „was sein sollte“.
Dieser Doppelcharakter von Sozialpolitikforschung als normativ-empirische Wissenschaft (Schulz-Nieswandt 1990, S. 273) mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Schließlich werden normative Fragen in der Wissenschaft oft als „unwissenschaftlich" abgetan. Doch gerade in der Sozialpolitik, die das Leben von Menschen unmittelbar beeinflusst, ist es unerlässlich, auch über Werte, Haltungen und Ziele nachzudenken.
Von Kant zu Rawls: Philosophische Grundlagen
Die Kölner Tradition schöpft aus reichen philosophischen Quellen. Werfen wir einen Blick auf die Ideen, welche den Ansatz stark prägen: Die Moralphilosophie Immanuel Kants fordert, dass wir handeln sollen, als könnten unsere Handlungen allgemeingültige Gesetze werden. Dieses Prinzip schließt egoistisches Handeln und reinen Konsumismus aus, da diese nicht als allgemeines Gesetz zustimmungsfähig wären (Kant 1994/1785).
Kants Pflichtethik ist geprägt von drei grundlegenden Einsichten: Der Mensch als Wert an sich, ein Freiheitsverständnis, das auf der Willensfreiheit beruht, und der Fokus auf Motive statt auf Folgen. Diese Prinzipien sind fundamental für das Verständnis der Sozialpolitik in der Kölner Tradition. Insbesondere das Freiheitsverständnis Kants, welches die Fähigkeit betont, vernünftig zu reflektieren und sich selbst moralische Maximen zu geben, bietet eine Alternative zu utilitaristischen und konsequentialistischen Ansätzen.
John Rawls Theorie der Gerechtigkeit ergänzt Kants Ethik durch zwei Grundsätze: Gleiche Grundfreiheiten und das Unterschiedsprinzip, welches besagt, dass soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten nur dann zulässig sind, wenn sie sich zum Vorteil der am wenigsten Begünstigten auswirken. Diese Grundsätze sollen durch die „reine praktische Vernunft“ hinter einem „Schleier des Nichtwissens“ ermittelt werden, wodurch Diskriminierungen und große Wohlstandsunterschiede vermieden werden (Rawls 1998/1971). Rawls lehnt eine Gerechtigkeitstheorie, die auf der Formel Chancengleichheit plus Leistungsprinzip beruht ab, denn die Verinnerlichung dieses meritokratischen Ideals hat polarisierendes und letztlich demokratiegefährdendes Potenzial (Sandel 2020). Es übersieht aber, dass Zufälle und Schicksalsschläge die unterschiedlichen Lebenslagen erheblich beeinflussen.
Die Kölner Tradition sieht in diesen Gerechtigkeitsgrundsätzen eine zentrale Orientierung für die praktische Sozialpolitik und insbesondere den Lebenslageansatz. Dieses unter anderem von Gerhard Weisser geprägte Konzept zielt darauf ab, Handlungsspielräume durch Sozialpolitik zu erweitern. Dabei werden verteilungspolitische Fragen aufgeworfen, für die das Unterschiedsprinzip ein brauchbares Kriterium abgibt.
Wohlverstandene Interessen und meritorische Güter
Eine wichtige neukantianische Ergänzung erfahren die moralphilosophischen Grundlagen durch die Theorie der wohlverstandenen Interessen von Leonard Nelson (1971/1913). Wohlverstandene Interessen sind solche, die im Sinne einer Person sind, selbst wenn sie diese selbst nicht unmittelbar überblickt (Thiemeyer 1972). Dieser Ansatz impliziert, dass geäußerte Präferenzen nicht immer akzeptiert werden sollten, sondern einer kritischen Bewertung unterzogen werden müssen. Beispielsweise könnte ein Mensch, der unwissentlich eine vergiftete Suppe isst, durch eine Intervention im Namen seiner wohlverstandenen Interessen davor bewahrt werden. Dies zeigt insbesondere die Notwendigkeit von unter anderem pädagogischen Interventionen in der Sozialpolitik.
Das Konzept der meritorischen Güter, wie es von Richard Musgrave eingeführt wurde, erweitert diese Perspektive, indem sie Interventionen im wohlverstandenen Interesse von der ethischen auf eine politische Ebene hebt. Denn meritorische Güter sind solche, deren Bereitstellung im öffentlichen Interesse liegt, unabhängig von an Märkten zum Ausdruck kommenden Konsumpräferenzen (Mackscheidt 1984).
Letztlich sind in der praktischen Sozialpolitik nach Gerhard Weisser Haltungen erforderlich, die zwar außerhalb der Wissenschaft stehen, aber begründungsbedürftig sind. Dies ist der Kern des kritizistisch-normativen Sozialpolitikverständnisses und so ist auch Weissers (1957) bahnbrechende Kritik an der wirtschaftspolitischen Maximierung des Sozialprodukts zu verstehen: Das Sozialprodukt ist aus mehreren Gründen ein unzureichender Indikator für den Fortschritt einer Gesellschaft. Offenkundig weil es Verteilungsfragen und die Lebenslagenperspektive ausklammert, aber vor allem, weil es die wahren Interessen der Gesellschaftsmitglieder nicht berücksichtigt.
Kritizistische Sozialpolitik in der Praxis
Das normativ-kritizistische Sozialpolitikverständnis in Kölner Tradition bietet eine tiefgehende und reflektierte Grundlage für die Gestaltung sozialpolitischer Maßnahmen. Durch die Integration von Kantischer Pflichtethik, Rawlsianischer Gerechtigkeitstheorie und Weissers Lebenslageansatz wird eine Sozialpolitik angestrebt, die die Würde und die Autonomie der Person in den Mittelpunkt stellt.
Die Kölner Sozialpolitiktradition fordert eine sensible Handhabung von Anreizen und die Stärkung ethisch-gemeinwohlorientierten Handelns. Eine gute Gesellschaftsordnung sollte demnach nicht ausschließlich auf Anreizstrukturen beruhen, sondern die moralischen Motive der beteiligten Personen berücksichtigen. Ein zentrales Anliegen der Kölner Tradition ist die Förderung der Autonomie der Menschen. Dies geht über die reine Handlungsfreiheit hinaus und betont die Bedeutung von Selbstreflexion, intersubjektiver Kritik und bildungsfähiger Interessen. Sozialpolitische Interventionen sollten darauf abzielen, die Willensfreiheit der Person zu stärken und sie in ihrem wohlverstandenen Interesse zu unterstützen.
Dieser Beitrag ist eine Kurzfassung des Beitrags "Sozialpolitik im wohlverstandenen Interesse – Elemente eines normativ-kritizistischen Sozialpolitikverständnisses in Kölner Tradition" von Remi Maier-Rigaud (2024), erschienen in der Festschrift für Prof. Frank Schulz-Nieswandt.
Literaturverweise:
Kant, Immanuel (1994/1785). Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Stuttgart.
Kurscheid, Clarissa/Maier-Rigaud, Remi/Sauer, Michael (2024). Lebenslagen und Gemeinwohl. Festschrift für Frank Schulz-Nieswandt, Baden-Baden.
Maier-Rigaud, Remi (2024). Sozialpolitik im wohlverstandenen Interesse. Elemente eines normativ-kritizistischen Sozialpolitikverständnisses in Kölner Tradition. In: Kurscheid, Clarissa/Maier-Rigaud, Remi/Sauer, Michael (Hg.). Lebenslagen und Gemeinwohl. Festschrift für Frank Schulz-Nieswandt, Baden-Baden, S. 29-40.
Nelson, Leonard (1971/1913), Sittlichkeit und Bildung, in: Leonard Nelson, Gesammelte Schriften Bd. 8, hrsg. von Paul Bernays et al., Hamburg.
Rawls, John (1998/1971). Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt.
Sandel, Michael J. (2020). The Tyranny of Merit. What‘s Become of the Common Good?, o.O.
Schulz-Nieswandt, Frank (1990). Die Weisser’sche Schultradition der deutschen Sozialpolitikwissenschaft im Vergleich zur modernen britischen Sozialpolitiklehre in der Tradition von Titmuss. In: Sozialer Fortschritt, 39. Jg., Heft 12, S. 273–279.
Thiemeyer, Theo (1972). Zur Theorie der Gemeinwirtschaft in der Wirtschaftswissenschaft. In: Gewerkschaftliche Monatshefte, Heft 3, S. 129-141.
Weisser, Gerhard (1953), Über die Unbestimmtheit des Postulats der Maximierung des Sozialproduktes, in: Leonard Nelson. Zum Gedächtnis, hrsg, von Minna Specht und Willi Eichler, Frankfurt a. M., S. 151–191.
Remi Maier-Rigaud 2024, Die Kölner Tradition: Mehr als nur Empirie, in: sozialpolitikblog, 18.07.2024, https://difis.org/blog/die-koelner-tradition-mehr-als-nur-empirie-122 Zurück zur Übersicht

Remi Maier-Rigaud ist Volkswirt sozialwissenschaftlicher Richtung und Professor für Sozialpolitik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er ist im Editorium der Zeitschrift Sozialer Fortschritt und der Zeitschrift für Gemeinwirtschaft und Gemeinwohl. Seit 2022 ist er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Fördernetzwerks Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (FIS) am BMAS. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Gesundheits- und Alterssicherungspolitik, Solidaritätseinstellungen und Verbraucherpolitik.
Bildnachweis: Bernadett Yehdou/Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
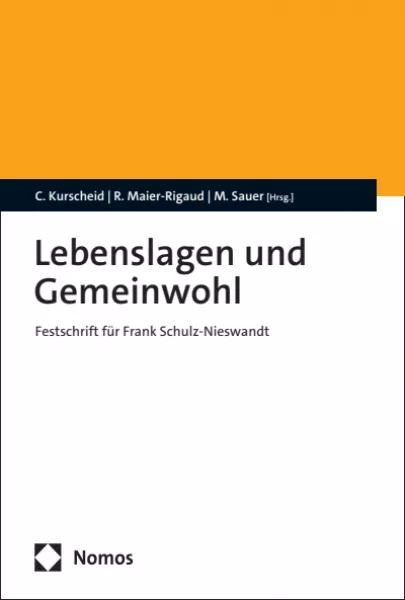
Kurscheid, C./Maier-Rigaud, R./Sauer, M. (Hg.) (2024): Lebenslagen und Gemeinwohl. Festschrift für Frank Schulz-Nieswandt. Nomos, Baden-Baden.