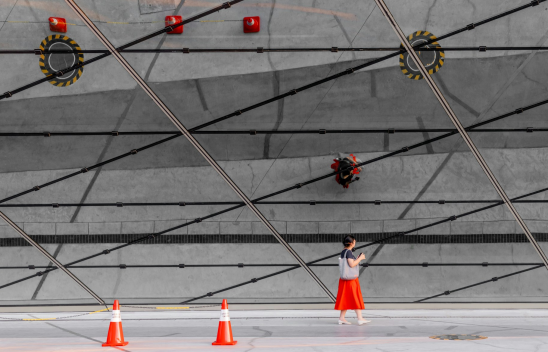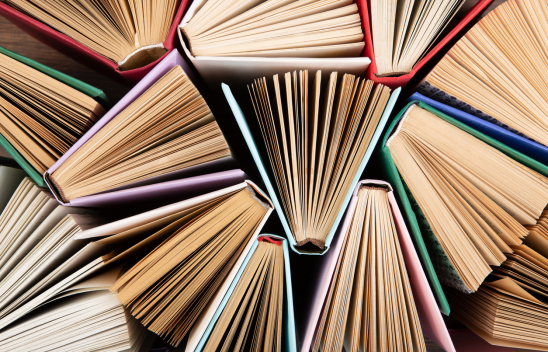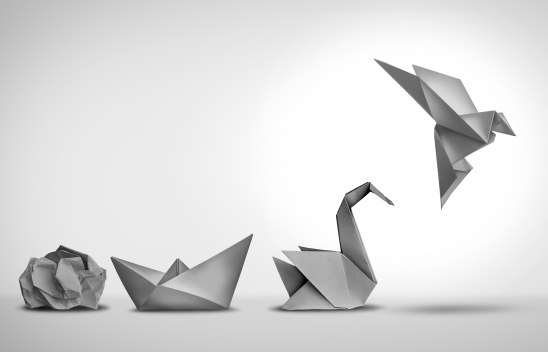Von der Bürokratie-Misere in die „Bürokratopia“?
Dass es um den deutschen Verwaltungsstaat schlecht bestellt zu sein scheint, ist mittlerweile nicht nur Stammtischerkenntnis, sondern weitestgehend Konsens unter Politik- und Medienschaffenden sowie Verwaltungswissenschaftler*innen geworden. In ihrer Analyse geht Julia Borggräfe den Ursachen der Verwaltungsmisere nach, hebt aber zugleich heraus, warum wir Verwaltung brauchen und wie wir sie besser machen können. Philipp Gräfe hat den Band gelesen und für sozialpolitikblog rezensiert.
Es ist zunächst der Titel von Julia Borggräfes „Bürokratopia“, der deutlich macht, dass dieses Buch nicht auf Abrechnung mit der deutschen Verwaltung zielt. Vielmehr versteht sich die Autorin darauf, die Problemlagen kenntnisreich zu analysieren und Ursachen zu erläutern. Dabei hat Borggräfe ihr eigener Lebenslauf mit Stationen im Personalmanagement, als Abteilungsleiterin für Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesarbeitsministerium und inzwischen in der Beratung der öffentlichen Hand die notwendigen Einsichten aus erster Hand gelehrt. Sie weiß, dass Digitalisierung häufig an nicht kompatiblen IT-Systemen hängen bleibt und dass die Verwaltungsbeschäftigten davon genauso frustriert sind wie die Bürger*innen draußen (S. 39). Sie erklärt, dass Bildung aufgrund der gegebenen politisch-administrativen Logiken und Strukturen einfach kein „Gewinnerthema“ ist und an politischer Relevanz hinter kurzfristigen Themen zurückbleibt (S. 33f.). Sie zeigt auf, wie politische Fehlentscheidungen der Vergangenheit die Verwaltung noch immer hemmen (S. 46f.). Auch benennt sie die Ressortautonomie der Ministerien, die sinnvolle Lösungen häufig da erschweren, wo mehrere Ressorts miteinander kooperieren müssten (S. 87), zuletzt etwa bei der gescheiterten Kindergrundsicherung.
Ein komplexes Problem
Natürlich kommt auch dieses Buch nicht ohne den Hinweis auf die ARD-Satiresendung „Extra 3“ aus, die den realen Irrsinn deutscher Bürokratie regelmäßig aufs Korn nimmt. Und an dem dort gezeigten Irrsinn ist auch sehr viel Wahres dran. Und dennoch: Die Verwaltung ist eine essenzielle Säule des demokratischen Staates, wie Borggräfe bereits auf der ersten Seite klarstellt. Es braucht die Verwaltung, welche die Rechte der Einzelnen und der Gemeinschaft zur Umsetzung bringt. Gleichwohl muss eine Verwaltung auch eine Orientierung an demokratischem Recht und Gesetz sowie am Gemeinwohl aufweisen, sonst verkommt sie schlimmstenfalls zur Erfüllungsmaschinerie wie in Nazizeiten.
Das Buch startet mit einer Phänomenbestimmung, was die Verwaltung eigentlich ist, was sie sein soll und worin die aktuell sichtbaren Probleme bestehen. Dazu widmet sich die Autorin mit der Schulbildung und der Verwaltungsdigitalisierung zwei jener Zukunftsthemen, in denen Deutschland seit langem unter seinen Möglichkeiten bleibt. In darauffolgenden sechs Kapiteln nimmt Borggräfe dann einige der Erklärungsfaktoren in den Blick. Diese reichen von den sehr präsenten Herausforderungen der Personalgewinnung im öffentlichen Dienst bis hin zu dem, was bei den Bürger*innen am Ende ankommt: Dass der deutsche Beamtenapparat zwar wunderbar in der Lage ist, juristisch einwandfreie Lösungen zu formulieren, aber die Praktikabilität für die Bürger*innen kein Kriterium ist (S. 74; vgl. auch Bogumil/Voßkuhle 2024). Damit durchaus verbunden diagnostiziert Borggräfe einen Mangel an Strategiearbeit, die Visionen entwickelt, Perspektiven einbindet und vorausschauend handelt. Interessant ist, dass ein ganzes Kapitel dem Auseinanderfallen politischer und fachlicher Logiken gewidmet ist, was in der Literatur bislang erst in Ansätzen adressiert wird (siehe etwa Dinessen et al. 2025). Eine Stärke des Buches liegt auf jeden Fall darin, dass Borggräfe die Komplexität nicht in monokausale Erklärungen zu vereinfachen sucht. Stellenweise merkt man gleichwohl, dass sich die Analyse sehr stark auf die Ministerial- und steuernden Verwaltungen bezieht und dabei die spezifischeren Problemlagen der umsetzenden Verwaltung, z.B. auf kommunaler Ebene, teils unterbelichtet bleiben.
Was Verwaltung auch mit Demokratie zu tun hat
Verwaltung könne die Demokratie „retten“, gibt Borggräfe im Untertitel des Buches aus. Aktuell scheint aber die Verwaltung durch ihre Umsetzungsprobleme eher das Vertrauen in den Staat und damit auch in die Demokratie zu gefährden. „Im Ergebnis macht sich in diversen Bevölkerungsschichten die Auffassung breit, dass der Staat – so wie er sich ihnen in der Verwaltung präsentiert – nicht für die Bürgerinnen und Bürger da ist“ (S. 9). Folglich müssen, so die Autorin, mehr spürbare Gemeinwohlorientierung und langfristigere Perspektiven in die Verwaltung einziehen. Innovation bloß um der Innovation willen, meint sie dabei nicht.
Mithin würde man sich aber auch wünschen, diese Verknüpfung von funktionierender Verwaltung und Demokratie würde in den 133 Seiten mehr vertieft. „Bürokratopia“ hat aber auch gar nicht das Ziel, eine vertiefte wissenschaftliche Analyse der Wirkmechanismen von Verwaltung und Demokratie vorzulegen. Vielmehr will das Buch Lösungen für Probleme (an)bieten.
Borggräfe schließt dazu mit einer Top-12 von Reformvorschlägen, die in den kommenden Jahren angegangen werden sollen. Diese sind teilweise kleinteilig (z.B. „Rahmenstandard für Verwaltungsprozesse“), teilweise mehr erwünschtes Ergebnis als echter Reformvorschlag („zeitgemäße Führung in Verwaltungsorganisationen“). Aber diese Liste soll in erster Linie mehr ein Anstoß für den grundsätzlicheren Wandel in der Verwaltung sein. Dieser scheint im Übrigen bereits das Bohren von genug (sehr) dicken Brettern zu umfassen, fordert Borggräfe doch (zurecht) ein, dass die starren Budgetzyklen öffentlicher Haushalte Platz für mehr Flexibilität machen sollen oder, dass das Beamtenrecht grundsätzlich reformiert gehört.
Man muss sich nicht jede der Forderungen zu eigen machen. Bei vielen Vorschlägen im ganzen Buch (etwa zu mehr Wirkungsorientierung und strategischer Vorausschau) ist beispielsweise auffällig, dass sie vor allem ein Anwachsen der Bürokratie mit neuen Verwaltungsstellen bedeuten würden, die vor dem Hintergrund aktueller Fachkräftesituation und Finanzlage sowie der gesellschaftlichen Stimmung besonders gut gerechtfertigt sein müssten. Doch gerade für die Reflexion über unsere Verwaltung, über das, was wir als Gesellschaft von ihr haben und wollen, und wie wir sie auch verbessern können, bietet „Bürokratopia“ wichtige Denkanstöße.
Literatur
Bogumil, J./Voßkuhle, A. (2024): Wie Bürokratieabbau wirklich gelingt. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.02.2024 (33/2024).
Dinnessen, F./Kuhlmann, S./Bannach, T./Gräfe, P./Nagel, M./Wehmeier, L. (2025): Umsetzungsfähigkeit des Staates. Fünf Kernbotschaften für die öffentliche Verwaltung. München/Potsdam: Deloitte/Universität Potsdam. https://www.deloitte.com/de/de/Industries/government-public/research/umsetzungsfaehigkeit-des-staates.html
Philipp Gräfe 2025, Von der Bürokratie-Misere in die „Bürokratopia“?, in: sozialpolitikblog, 14.07.2025, https://difis.org/blog/?blog=171 Zurück zur Übersicht

Philipp Gräfe ist Politik- und Verwaltungswissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum. Er forscht und publiziert zur Digitalisierung, zu Verwaltungsverflechtungen und der Sozialverwaltung. Mit Jörg Bogumil hat er jüngst in einer Studie die Fragmentierung des deutschen Sozialstaats herausgestellt.

Julia Borggräfe
Bürokratopia. Wie Verwaltung die Demokratie retten kann
Wagenbach
Hier geht es zum Buch