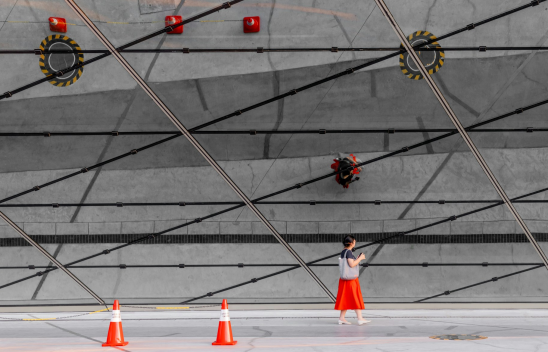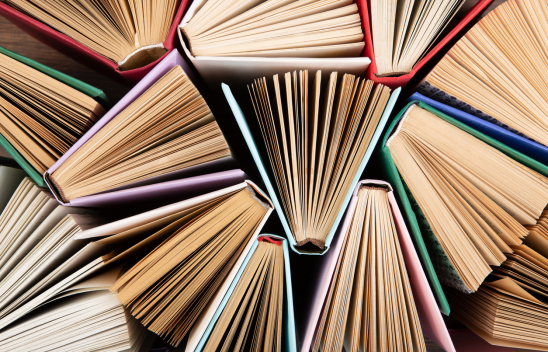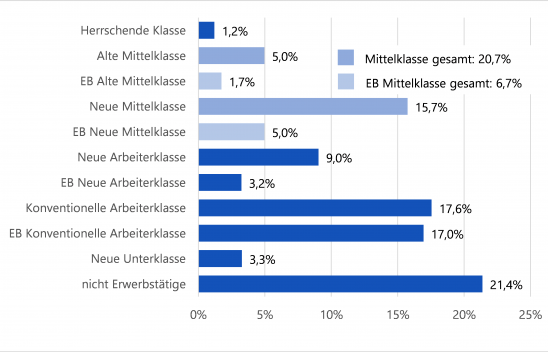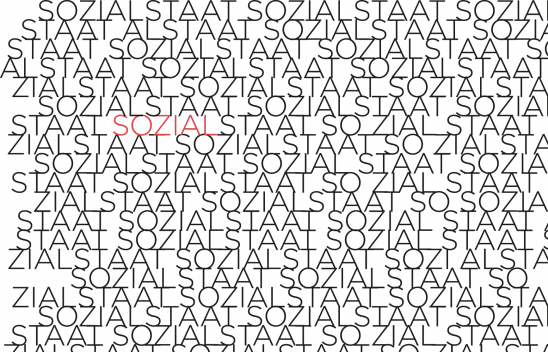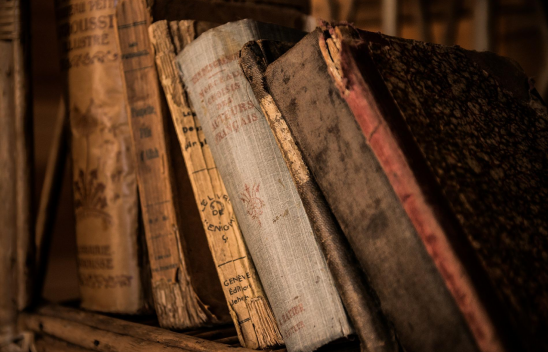Geht es immer weiter nach oben?
Bis heute ist die Vorstellung, dass es die nächste Generation einmal besser haben soll, tief verankert in der deutschen Gesellschaft. Damit geht auch der Vorstellung einher, dass ein Aufstieg mit Fleiß und dem Zugang zu guter Bildung wirklich jedem Einzelnen gelingen kann. Aber ist das wirklich (noch) so?
Es gibt wohl kaum einen Satz, der den Wunsch nach dem sozialen Aufstieg in Deutschland so gut zusammenfasst wie dieser: „Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir.“ Diese Vorstellung ist wahrlich nicht neu: Schon 1957 veröffentlichte Ludwig Erhard sein Buch „Wohlstand für alle“. Darin plädiert er dafür, dass alle Schichten vom Wohlstand profitieren müssen - und nicht nur eine „dünne Oberschicht“. Es sollte für alle nach oben gehen. Bis heute ist die Vorstellung, dass es die nächste Generation einmal besser haben soll, tief verankert in der deutschen Gesellschaft. Damit geht auch die Vorstellung einher, dass ein Aufstieg mit Fleiß und dem Zugang zu guter Bildung wirklich jedem Einzelnen gelingen kann. Aber ist das wirklich (noch) so?
Lassen Sie mich eines vorwegnehmen: Ungleichheit wird es in einer Gesellschaft immer geben. Die Vorstellung der totalen Gleichheit ist eine schreckliche und sinnlose Utopie. Vor allem bedeutet Ungleichheit nicht automatisch auch Ungerechtigkeit. Schließlich ist es auch erst die Ungleichheit, die zum freien wirtschaftlichen Wettbewerb führt. Die Soziale Marktwirtschaft, die Erhard begründet hat, ist daher auch kein Umverteilungsentwurf. Sie macht uns nicht alle gleich – aber sie soll uns allen die gleichen Chancen geben, unseren ganz persönlichen Weg möglichst erfolgreich zu gehen. Es ist also ein Konzept, dass entscheidend durch die Möglichkeit des Aufstieges geprägt ist. Die Frage ist deswegen auch, wann Ungleichheit zu Ungerechtigkeit führt – und warum. Wenn der soziale Aufstieg durch die Herkunft, das Geschlecht oder andere Merkmale bestimmt wird, ist das ungerecht. Dann fehlt es einer Gesellschaft an der so wichtigen Durchlässigkeit, die einen sozialen Aufstieg überhaupt erst ermöglichen kann.
Die soziale Herkunft bestimmt immer noch
Und zumindest der jüngste Hochschul-Bildungs-Report zeichnet genau dieses Bild. Der Report untersucht unter anderem, welche soziale Herkunft Studienanfänger haben. Demnach gehen von 100 Kindern aus Akademikerhaushalten 74 auf eine Hochschule. Bei Kindern aus Arbeiterfamilien sind es deutlich weniger: Dort nehmen von 100 gerade einmal 21 ein Hochschulstudium auf. Mit Blick auf höhere Bildungsstufen verdüstert sich das Bild weiter: Einen Doktortitel erreichen Arbeiterkinder zehn Mal so selten wie Akademikerkinder. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass natürlich nicht alle Arbeiterkinder immer die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Im Schnitt zeigt das Ergebnis aber eines sehr deutlich: Kinder aus nicht-akademischen Haushalten studieren nicht nur seltener, sie erreichen auch seltener die nächste Bildungsstufe.
Die Pisa-Studie aus dem Jahr 2018 macht ebenfalls deutlich, dass die soziale Herkunft noch immer einen Unterschied macht: Im Test, der internationale Schulleistungen untersucht, schnitten Kinder aus reicheren Haushalten besser ab als Kinder aus ärmeren. Die Chancengerechtigkeit liegt damit in Deutschland noch immer unter dem OECD-Durchschnitt. Herkunft bestimmt also maßgeblich die spätere berufliche Laufbahn - und nicht das Potential oder die Begabung eines Menschen.
Wie lässt sich diese Lücke schließen?
Gründe für die Diskrepanz gibt es zur Genüge: In einem Bericht des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) wird davon ausgegangen, dass Eltern, die selbst nie studiert haben, die Kosten für eine höhere Bildungsstufe überschätzen – den Ertrag jedoch unterschätzen. Denn wer studiert hat, verdient im Durchschnitt mehr. Auch fehlen Nicht-Akademikerkindern häufig Vorbilder in der Familie, die den Weg des Studiums schon gegangen sind. Zudem gebe es unter ihnen die Angst, sich mit einem sozialen Aufstieg von der eigenen Familie zu entfremden. Andere Forscher verorten die Gründe in mangelhafter frühkindlicher Förderung oder fehlenden finanziellen Mitteln.
Warum schaffen wir es aber nicht, diese Lücke zwischen Arbeiter- und Akademikerkinder zu schließen?
Es wäre unfair zu sagen, dass die Politik das Problem ignoriert. Armut und Ungleichheit spielt in fast jedem Wahlprogramm eine Rolle. Auch im neuen Koalitionsvertrag finden sich Passagen wie diese: „Jede und jeder soll das eigene Leben frei und selbstbestimmt gestalten können. Aber die Chancen sind nicht für alle gleich verteilt.“ Die Koalition will vor allem bei den Kindern ansetzen, denn „die Grundlagen für soziale Aufstiegschancen“ müssten schon im Kindergarten und in der Schule gelegt werden (Koalitionsvertrag 2021: 6).
Damit hat die Regierung recht. Die frühkindliche Förderung nimmt in der Forschung einen besonderen Stellenwert ein. Wir wissen heute, dass ein Kind, dass früh gefördert wird, sich besser in das Schulsystem einfindet. Die Bildung in der frühen Kindheit legt sogar das Fundament für den weiteren Bildungsweg. Denn fehlende Förderung von Kindern zwischen drei und sechs Jahren kann nur sehr schwer später in der Schule nachgeholt werden.
Mehr Schein als Sein
Nun klingt die Passage aus dem Koalitionsvertrag zwar gut. Mehr als schöne Wörter scheinen aber bislang leider nicht dahinterzustecken. Denn gerade bei der frühkindlichen Förderung setzt die Bundesregierung den Rotstift an: Bis Ende des Jahres läuft zum Beispiel die Unterstützung der sogenannten „Sprach-Kitas“ aus, in denen zusätzliches Personal die Sprachentwicklung der Kindergartenkinder schult. Es läuft aus, nachdem viele Kinder aufgrund der Corona-Pandemie sowieso schon zusätzlich belastet sind.
Das Milliarden-Projekt „Aufholen nach Corona“ sollte hingegen den Schulen helfen, den Schaden durch die Corona-Pandemie zu minimieren. Laut Forschern des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) kamen die Gelder und Hilfen aber nicht bei den Kindern an, die es am nötigsten gehabt hätten: dem Nachwuchs aus benachteiligten Familien. Sowieso sind die Schulen und Bildungseinrichtungen seit langem in schlechtem Zustand. Gebäude sind marode, Lehrkräfte und Erzieher fehlen. Viel getan wird dagegen nicht. Und selbst Studierenden kommt die Politik mit schlechten Nachrichten: So streicht der Bund Stipendien und Förderprogramme des Deutschen Akademischen Austauschdienstes.
Stattdessen verteilt die Bundesregierung lieber nach dem Gießkannenprinzip Gelder – konkret beispielsweise 18 Euro mehr Kindergeld. Das oft diskutierte Projekt Kindergrundsicherung wurde erst einmal verschoben. Ein konkretes Finanzierungsmodell oder die Höhe der Leistungen sind sowieso noch nicht bekannt.
Bleibt bei Erhard!
Dabei wäre es in Zeiten des allgegenwärtigen Fachkräftemangels umso wichtiger, die vorhandenen Arbeitskräfte ausreichend zu qualifizieren. Das geht aber nur, wenn Menschen von Kindesbeinen an ihre Fähigkeiten und Begabungen kennenlernen und entwickeln können. Bildung führt zu besseren Jobs, schützt vor Arbeitslosigkeit, generiert höhere Einkommen. Kurzum: Wohlstand für alle.
Daher wäre es wohl besser, wenn sich die Bundesregierung wieder öfter auf den Vater der Sozialen Marktwirtschaft beriefe. Der schrieb einst: „Das mir vorschwebende Ideal beruht auf der Stärke, dass der Einzelne sagen kann: Ich will mich aus eigener Kraft bewähren, ich will das Risiko des Lebens selbst tragen, will für mein Schicksal selbst verantwortlich sein. Sorge du, Staat, dafür, dass ich dazu in der Lage bin.“ Für die Kinder aus den benachteiligten Elternhäusern wäre das nur wünschenswert. Damit es nach oben geht – für alle.
Stefanie Diemand 2022, Geht es immer weiter nach oben?, in: sozialpolitikblog, 27.10.2022, https://difis.org/blog/?blog=33 Zurück zur Übersicht

Stefanie Diemand ist Wirtschaftsredakteurin im Karriere- und Unternehmensressort der Frankfurter Allgemeine Zeitung und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Dort schreibt sie vor allem über Hochschule, Arbeit und Konsum.
Bildnachweis: Helmut Fricke | F.A.Z.