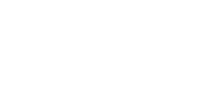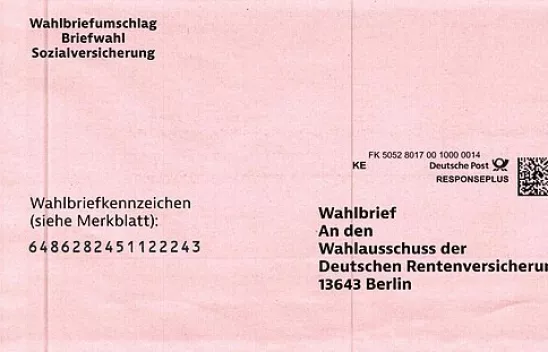Das Ende der fragmentierten Sozialstaats-Governance?
Mit der Sozialplattform macht Deutschland einen sichtbaren Schritt in Richtung digitaler Sozialstaat. Ziel ist es, allen Bürger*innen, insbesondere denen in schwierigen Lebenslagen, einen einfachen Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen zu ermöglichen, unabhängig von ihrem Wohnort. Wie komplex die Umsetzung ist, zeigen neue Forschungsergebnisse.
Die Sozialplattform offenbart Anklänge an „Government as a Platform“ (GaaP) als Leitbild digitaler Verwaltungsreform. Als zentrales Portal ermöglicht sie eine Online-Antragsstellung bei den an sie angeschlossenen zuständigen Stellen, einen personalisierten „Sozialleistungsfinder“ sowie Online-Terminbuchungen und direkte Online-Beratung durch die freigemeinnützige Sozialwirtschaft. Angedacht sind auch pro-aktive Leistungsvergabe mittels automatischer Datenverarbeitung verbundener Register – spätestens hier entsteht wohl eine Vorstellung davon, dass die technischen Neuerungen sozialpolitische Tragweite haben könnten.
Wie verhält sich Verwaltungsdigitalisierung zum Wohlfahrtsstaat?
Die Diskussionen in unseren Nachbarländern, deren Entwicklung weiter fortgeschritten ist, können uns sowohl Inspiration als auch Warnung sein. Dänemark, um hier ein für die Entwicklungen in Deutschland instruktives Beispiel zu wählen, ist der Musterschüler in Sachen Gesundheitsdigitalisierung. Das Land gilt aufgrund der hohen Güte seiner Gesundheitsdaten als Eldorado für die epidemiologische Forschung, die von offensichtlich hohem öffentlichem Nutzen ist. Gleichzeitig gibt es eine kritische Debatte um die Verwendung der Gesundheits- und Sozialdaten. Forscherinnen wie Rosie Collington (2022) zeigen, wie das im Sozialstaat produzierte „Rohöl der Digitalwirtschaft“ sorglos zum Aufbau der nationalen Digitalwirtschaft an „WelfareTech“-Unternehmen übergeben wird. Ohne die Software dieser Unternehmen funktioniert bald keine Einrichtung mehr und so entsteht eine strukturelle Machtposition privater Firmen bei der Bereitstellung öffentlicher Gesundheitsgüter. Kommerzielle Logiken mischten sich in die demokratische Sphäre sozialer Rechte. Eine Form des strukturellen Rückbaus wohlfahrtsstaatlicher Leistungsfähigkeit sei langfristig zu befürchten, weil dem öffentlichen Sektor das Wissen für die Steuerung und Kontrolle der digitalen Infrastruktur verloren geht.
Diese Kontrolle über die Gestaltung digitaler Infrastrukturen – und noch wichtiger: der sozialpolitischen Programme, die auf ihnen ausgeführt werden sollen – ist es aber, die im Laufe der Entwicklung auch über deren sozialpolitische Implikationen entscheiden wird, meint beispielsweise Marion Fourcade (2019). Die Digitalisierung der Verwaltung des Sozialstaats könne natürlich beispielsweise dazu genutzt werden, Leistungsempfänger*innen zu überwachen und zu disziplinieren. Dieselben Technologien ließen sich aber einspannen, um die universalistischen und dekommodifizierenden Momente des Sozialstaats zu stützen, indem sie einfachen Zugang gewähren, wo sonst bürokratische Hürden, Stigma und Komplexitätsfallen lauern. Wie gestaltet sich also Deutschlands Gang in den digitalen Sozialstaat und welche Akteure werden in der neuen digitalen Infrastruktur wie miteinander verbunden?
Die Vision eines bürgerfreundlichen Sozialstaats
Die Sozialplattform ist eines von vielen Umsetzungsprojekten des 2017 verabschiedeten Online-Zugangsgesetz (OZG), das bis heute größte Modernisierungsprojekt der öffentlichen Verwaltung seit Bestehen der Bundesrepublik. Das ursprüngliche Ziel dieses Herkulesprojekts war es, binnen fünf Jahren 575 Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger digital bereitzustellen.
Die empirische Rekonstruktion des Implementierungsprozesses der Sozialplattform (Einhaus & Klenk 2024) zeigt: Dass der ‚einfache‘ Online-Zugang zu Verwaltungsbehörden durch die schrittweise Transformation des Sozialstaates in eine bzw. mehrere Plattformen passieren soll, steht so gar nicht im Gesetz, sondern ist die Übersetzungsleistung der für die Implementation verantwortlichen Verwaltungsakteure. Da sich das Onlinezugangsgesetz vor allem auf das ‚front-end‘ der digitalen Verwaltung konzentriert, hätten die Verantwortlichen auch einfach die bestehenden Anträge in ausfüllbare PDF-Dokumente für die Bürger*innen überführen können – im „back-end“ in den Verwaltungen wären womöglich viele neue Jobs im Bereich „Ausdrucken und Abtippen“ entstanden.
Jedoch entwickelte die unternehmerisch denkende Projektleitung eine Vision, die zugleich stark von den technischen Gegebenheiten, dem Einfluss von Expert*innen-Communities und den eingesetzten Management-Tools geprägt wird. Durch interoperable Schnittstellen, gemeinsam geteilte Register und Akten sollen an die Sozialplattform angedockte Verwaltungsbehörden in einem hohen Maße kooperieren können und so die administrativen Lasten für Bürger*innen in erheblichem Maße reduzieren. Der Anspruch der Sozialplattform ist es, in Lebenslagen – und nicht in administrativen Zuständigkeiten! – zu denken. Bürger*innen soll, wie es der Normenkontrollrat in einer Stellungnahme formuliert, ein Weg aus der Komplexitätsfalle der vielfältigen Politik- und Verwaltungsverflechtungen des deutschen Sozialstaats geboten werden.
Die Vision prallt auf die Realität
Doch beim Versuch, die fragmentierte Sozialstaats-Governance unter eine gemeinsame Plattform zu bringen, müssen die Implementationsakteure ihre Ambitionen deutlich reduzieren. So gibt es zum Beispiel neben der Sozialplattform noch ein anderes, ebenfalls staatliches, Plattformprojekt: „DigiSucht“, ein umfassendes Online-Suchtberatungstool von überverbandlichen Akteuren der freigemeinnützigen Wohlfahrtspflege und Bundesgesundheitsministerium. Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Sozialplattform und DigiSucht wäre aus der Perspektive eines Lebenslagenansatzes sinnvoll und wünschenswert gewesen. Doch diese Zusammenarbeit misslang, auch aufgrund der Eigeninteressen der jeweiligen Plattformentwickler*innen. Dass die Freie Wohlfahrtspflege über ein zentrales Terminbuchungstool und einen Beratungsstellenfinder angebunden an die Sozialplattform werden soll, weckt außerdem Sorgen über mögliche Neuordnungen des Verhältnisses zwischen Staat und Sozialwirtschaft. So scheitert die Idee der horizontalen Verwaltungsintegration angesichts der Vielzahl von Portal- und Plattformprojekten, die im Rahmen deutscher E-Government-Initiativen initiiert wurden und ehrgeizig darauf abzielen, ein Monopol in ihrem jeweiligen Leistungsbereich zu erlangen.
Wichtig für die Entwicklung eines konvergenten und irreversiblen Netzwerkes ist zudem die Unterstützung der kommunalen IT-Wirtschaft. Diese ist in Deutschland, der traditionellen Logik der Sozialstaats-Governance folgend dezentral organisiert und außerordentlich fragmentiert. Nicht nur ist das Ökosystem für Digitalisierung in jedem Bundesland ganz unterschiedlich gestaltet. Erschwerend kommt hinzu, dass auch innerhalb eines Bundeslands Behörden aus unterschiedlichen Landkreisen oder Kommunen mit je unterschiedlichen IT-Anbietern zusammenarbeiten und in der Folge für gleiche sozialstaatliche Leistungen ganz unterschiedliche Software- und Cloud-Lösungen verwenden. Die technologische Struktur, die der sozialstaatlichen Leistungserbringung unterliegt, ist also hochgradig divergent – und sie wird es auch bleiben, denn die Zustimmung der sub-nationalen Verwaltungsakteure zur Umsetzung des OZG wurde mit dem Versprechen erkauft, dass die jeweiligen lokalen technischen Infrastrukturen im Grundsatz unverändert bleiben können, lediglich Interoperabilität ist herzustellen.
Freilich ist Interoperabilität an sich eine gute Idee, mehr noch: sie ist conditio sine qua non für einen plattformbasierten Sozialstaat. Im Fall der konkreten Umsetzung des „Einer für Alle“-Prinzips verhindert jedoch die allzu schnelle Einigung auf ‚bloß‘ interoperable Lösungen das Neudenken über innovative Prozesse im kommunalen „Back-End“ – obwohl paradoxerweise aufgrund der notwendigen Schnittstellen sehr viel Aufmerksamkeit und Ressourcen in die Gestaltung des Back-Ends investiert werden! Die Chance auf eine größere Vereinheitlichung der technischen Infrastruktur durch Standardsetzung wurde vertan. Kommunen wählen, ihren eingeschlagenen technologischen Pfaden folgend, unterschiedliche Module aus dem Angebot der Sozialplattform aus und schließen diese im Zusammenspiel mit kommunalen Rechenzentrumsbetreibern und spezifischen Fachverfahrenherstellern auf sehr unterschiedliche Weise an die Sozialplattform an. „Wir müssen quasi für alle 11.000 Kommunen eigene Anbindungslösungen erarbeiten“, konstatiert einer der für die Entwicklung der Sozialplattform verantwortlichen befragten Experten.
Sozialstaatsforscher*innen können hier eine Pfadabhängigkeit par excellence beobachten. Ähnlich wie in Dänemark führen sich selbst verstärkende Mechanismen Kommunen und Landkreise in einen technologischen Lock-in. Unterschiede zum Nachbarland bestehen allerdings (noch) in Bezug auf die Marktstruktur und die unternehmerische Machtkonzentration: Während in Dänemark der Markt für öffentliche IT hochkonzentriert ist, finden wir in Deutschland eine kleinteilige, fragmentierte Struktur mit einem Mix aus privaten und öffentlichen Unternehmen vor. Aus der fragmentierten Struktur ergeben sich ganz eigene Geschäftsstrategien zum Nachteil der kommunalen Haushalte, beispielsweise wenn für neue Schnittstellen zwischen den vielen Systemen plötzlich über die Maße zur Kasse gebeten wird. Da ein Anbieterwechsel mit all seinen organisationalen Folgen noch teurer zu Buche schlagen würde, akzeptiert man zähneknirschend die neue Rechnung.
Dass die vertikale Integration misslingt, kann also kaum der Leitung des OZG-Projektes „Sozialplattform“ angelastet werden, denn dieser fehlen im kooperativ-föderalen Sozialstaat die entsprechenden Kompetenzen für eine hierarchische Intervention, ihnen steht lediglich der Weg der Verhandlung und Überzeugung offen. Auch die kommunale IT-Wirtschaft folgt letztlich nur ihrer Organisationslogik, wenn sie erfolgreich platzierte Produkte unverändert lässt und für die Anschlussaktivitäten ein neues Geschäftsfeld entwickelt. Vorgaben zur Standardsetzung hätten 2017 durch den Bundesgesetzgeber erfolgen müssen, der aber den für die Umsetzung verantwortlichen Ländern (nahezu) freie Hand gelassen hat, wie das ‚Einer für Alle‘-Prinzip im Zusammenspiel zwischen Ländern und innerhalb Länder konkret zu gestalten ist. Das Ergebnis ist eine Steigerung der Vielzahl der Verwaltungslösungen. Statt bis Ende 2022 Bürgerinnen und Bürger aus der Komplexitätsfalle hinauszuführen, führt das OZG im Falle der Sozialplattform Bürger*innen – und Verwaltungsnutzer*innen! - mitten in die Komplexitätsfalle hinein.
Dass aus den Erfahrungen von fünf Jahren OZG gelernt wird, ist nicht zu erkennen: alle politischen Bemühungen, mit einem Nachfolge-Gesetz ‚OZG 2.0‘ den bereits eingeschlagenen Weg der digitalen Verwaltungstransformation weiterzuführen, scheiterten – das ‚OZG 1.0‘ endete 2022, ohne dass ein konkretes Anschlussgesetz in greifbarer Nähe wäre. Erst im Vermittlungsausschuss im März 2024 gelang eine Einigung. Doch wieder fehlen Vorgaben für konkrete IT-Standards und Sanktionen bei Nicht-Einhaltung. Es liegt also wieder an der Verwaltung, was aus der Umsetzung des Gesetzes gemacht wird. Oder mit einer Portion Zweckoptimismus, der beim Projekt der Verwaltungsdigitalisierung nicht schaden kann, gesagt: Es bietet den Verwaltungs-Entrepreneurs erneut viel Spielraum, um innovative Lösungen zu entwickeln.
Was ist vom plattformisierten Wohlfahrtsstaat zu erwarten?
Die Gefahr oder das Potential (je nach Sichtweise), das mit der Sozialplattform wie in Dänemark langfristig bisher sehr disparat gespeicherte Daten in einer Weise zusammengeführt werden, die die Idee einer kommerziellen Ausbeutung („Sekundärnutzung“) überhaupt aufkommen lassen, scheint im deutschen Fall keine erkennbare Rolle zu spielen. Im Vordergrund steht die Frage, ob wir den wirklich vollständigen Rollout der Plattform über alle zuständigen Kommunen hinweg überhaupt erleben werden und ob Daten wirklich irgendwann nicht mehr von einem Formular ins nächste übertragen werden müssen („Primärnutzung“). Und die Abgabe von Souveränität über öffentliche IT an private Akteure? In die Lücken deutscher Verwaltungsdigitalisierung springen neben die bestehenden öffentlichen und privaten klein- und mittelständischen Unternehmen auch Big-Tech-Unternehmen sowie findige GovTech-Startup. Noch besteht hier aber die Chance, durch Regulation und eine Restrukturierung der öffentlichen Unternehmenslandschaft, wie zum Beispiel durch den jüngst zu beobachtenden Zusammenschluss mehrerer öffentlicher Anbieter zu einer bundesweiten Genossenschafteiner von privaten Großunternehmen dominierten Marktstruktur zu entgehen.
Literatur
Einhaus, M., & Klenk, T. (2024): Towards a platformised welfare state? How public administration, personal data, and third-sector welfare get entangled in a nation-wide digitalisation project, Der Moderne Staat – Zeitschrift Für Public Policy, Recht Und Management, 17(1), 13–34.https://doi.org/10.3224/dms.v17i1.02
Fourcade, M. (2019): The Unfeeling State - Virginia Eubanks, Automating Inequality. How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor (New York, St Martin’s Press, 2017), European Journal of Sociology, 60(3), 401–405. https://doi.org/10.1017/S0003975619000213
Collington, R. (2022): Disrupting the Welfare State? Digitalisation and the Retrenchment of Public Sector Capacity, New Political Economy, 27(2), 312–328. https://doi.org/10.1080/13563467.2021.1952559
Maximilian Einhaus und Tanja Klenk 2024, Das Ende der fragmentierten Sozialstaats-Governance?, in: sozialpolitikblog, 31.10.2024, https://difis.org/blog/das-ende-der-fragmentierten-sozialstaats-governance-136 Zurück zur Übersicht

Maximilian Einhaus promoviert seit 2022 in Hamburg zur wirtschaftlichen Re-Organisation des Dritten Sektors. Studiert hat er Staatswissenschaften (Erfurt) und Soziologie (FfM, Paris). Nebenher arbeitet er in Beratungsprojekten in der freigemeinnützigen Sozialwirtschaft und geht universitären Lehraufträgen in der Betriebswirtschaftslehre und der politischen Theorie nach.

Prof. Dr. Tanja Klenk ist Professorin für Verwaltungswissenschaft an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. In ihrer Forschung befasst sie sich insbesondere mit der Frage, wie sich die Organisation und Steuerung der (sozial)staatlichen Leistungserbringung vor dem Hintergrund von politischem, sozialem oder technischem Wandel (wie z.B. Liberalisierung/ Vermarktlichung der Daseinsvorsorge, Internationalisierung, Digitalisierung) verändert.