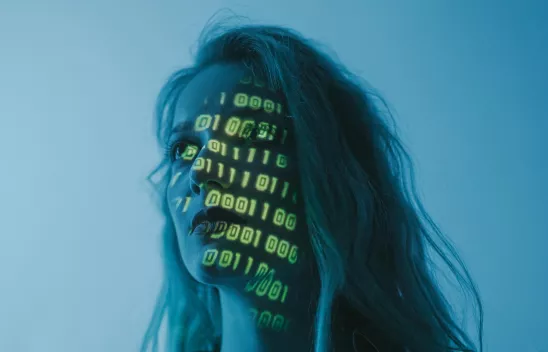Eine Zeit für Dissenting Social Work?
Zum Internationalen Tag der Sozialen Arbeit 2025
Die Zahl der Sozialarbeiter*innen steigt, doch viele sind der Ansicht, dass der Beruf seine eigentliche Bestimmung aus den Augen verloren habe. In seinem Beitrag schlägt Paul Michael Garrett vor, dass „Dissenting Social Work“ (andersdenkende, abweichende, widerständige Soziale Arbeit) eine progressive Alternative darstellen könnte.
Aus dem Englischen übersetzt von Katherine Bird und Wolfgang Hübner.
The English version is available at socialpolicyworldwide.org
Ist es eine Zeit, die Soziale Arbeit zu feiern?
Heute, am 18. März 2025, feiert die International Federation of Social Workers (IFSW, Internationaler Verband der Sozialarbeiter*innen) den Internationalen Tag der Sozialen Arbeit (World Social Work Day, WSWD). Ziel dieser jährlichen Veranstaltung ist es, die Errungenschaften des Berufsstands hervorzuheben, „die Sichtbarkeit der sozialen Dienste für die Zukunft der Gesellschaft zu erhöhen und soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte zu verteidigen.“ In mancherlei Hinsicht gibt es Grund zu feiern, denn die Soziale Arbeit scheint weltweit in einer überragend guten Verfassung zu sein. Für die Vereinigten Staaten wird zwischen 2022 und 2032 ein Beschäftigungswachstum im Bereich der Sozialen Arbeit von 7 % erwartet. Das ist mehr als der Mittelwert für alle Berufe. Durchschnittlich werden für das nächste Jahrzehnt pro Jahr etwa 63.800 offene Stellen für Sozialarbeiter*innen prognostiziert. Auch in China spricht man von einem neuen „Frühling der Sozialen Arbeit“ (Leung, 2012).
Ist es an der Zeit, die Soziale Arbeit zu begraben?
Dennoch sind einige Beobachter*innen innerhalb und außerhalb der Sozialen Arbeit zutiefst über ihre Entwicklung besorgt. In Australien fordert Maylea (2021) das „Ende der Sozialen Arbeit“ und wirft dem Beruf vor, seine „Mission“ verraten zu haben. Praktiker*innen würden mit unterdrückerischen Regimen kooperieren und versäumten es regelmäßig, Herrschaftspraktiken in Frage zu stellen. Darüber hinaus würden Lehrende der Sozialen Arbeit Studierende mit leerer Rhetorik über „soziale Gerechtigkeit“ und „Menschenrechte“ täuschen, da die Realität in den Wohlfahrtsbürokratien Sozialarbeiter*innen kaum Raum für progressives Handeln lässt. Noch schlimmer sei es, dass das ganze Unterfangen der Sozialen Arbeit idealistische junge Menschen von wirkungsvolleren Kampagnen und sozialen Bewegungen ablenke, die besser in der Lage wären, einen bedeutsamen sozialen Wandel herbeizuführen. Ähnlich wird insbesondere in den Vereinigten Staaten behauptet, der ganze Berufstand sei eng mit staatlicher Kontrolle und Überwachung verflochten, wobei das Kinder-„betreuungs“-system insbesondere für Menschen aus ethnischen Minderheiten als direkte „Pipeline“ in das Gefängnissystem fungiere (Kim et al., 2024).
Obwohl einige dieser Kritikpunkte berechtigt sind, bezweifle ich, dass sie uns einen Ausweg zeigen; vielmehr führen sie uns in eine berufliche und politische Sackgasse. Zudem ist das Aussterben der Sozialen Arbeit unwahrscheinlich: Staaten sind auf sie angewiesen, weil sie zur Aufrechterhaltung des für Kapitalakkumulationsprozesse erforderlichen sozialen Zusammenhalts beiträgt. Anstatt die Soziale Arbeit „zu beenden“ oder „abzuschaffen“, schlage ich daher die Idee einer „dissenting social work“ (DSW, widerständige Soziale Arbeit) vor.
Ist es Zeit für eine Neuorientierung der Sozialen Arbeit? Dissenting Social Work
Laut dem Oxford English Dictionary (OED) bedeutet „dissent“ (Dissens) die Nichtübereinstimmung mit einem „Vorschlag oder Beschluss; das Gegenteil von Konsens“. Das Wort selbst sowie die damit verbundenen Handlungen oder Einstellungen deuten auf eine Konstellation anderer Begriffe hin, wie Widerstand, Subversion, Dissidenz und Störung. Dissent impliziert laut OED häufig einen alternativen „Vorschlag“ oder einen „Beschluss“, der im Widerspruch zur vorherrschenden oder hegemonialen Art und Weise steht, auf eine „Frage“, ein „soziales Problem“ oder bestimmte Verhältnisse zu reagieren. Vielleicht impliziert der Verweis auf Dissens auch affektive Dispositionen, Stimmungen oder Gefühle, die darauf hindeuten, dass ein Individuum oder eine Gruppe beabsichtigt, „das Boot ins Wanken zu bringen“. Wie einige schwarze feministische Autor*innen argumentieren, kann Dissens auch Ausdruck in einer Wut finden, die darauf abzielt, „die Dinge in Ordnung zu bringen“ und soziale Gerechtigkeit herzustellen.
Für mich bedeutet DSW, vorherrschende Deutungen der sozialen Welt innerhalb der Disziplin zu hinterfragen. Sie könnte daher als eine Form der „Neo-Sozialarbeit“ interpretiert werden, die die Bemühungen unterstützt, sich der fortschreitenden Begrenzung der Handlungsmöglichkeiten für Lehrende und Praktizierende entgegenzustellen. Deutlicher ausgedrückt: DSW wendet sich gegen die Vorstellung, dass Lehrende und Praktizierende als bloße Handlanger*innen oder funktionale Hilfskräfte des Kapitalismus und der von ihm geforderten institutionellen Ordnungen dienen sollten.
Die DSW lässt sich nicht in Form von „Entwürfen“ oder „Aktionsplänen“ formulieren, doch sie könnte vorläufig als etwas verstanden werden, das innerhalb eines Raumes agiert, der durch mindestens ein Dutzend Themen, ja sogar Selbstverpflichtungen, strukturiert ist.

Natürlich ist dies keine vollständige Liste aller DSW-Themen und die identifizierten Merkmale dienen eher als Diskussionsgrundlage und sollten nicht als bombastisches „Manifest“ betrachtet werden. Als verknüpfte Koordinaten sollen diese Themen lediglich einen „Denkraum“ eröffnen. Ferner können sie selbstverständlich diskutiert, verfeinert, ergänzt oder von anderen Themen verdrängt werden. Darüber hinaus bin ich nicht so naiv zu glauben, dass die DSW zu einer mehrheitsfähigen Position innerhalb des Berufsstandes werden wird. Doch könnte das Festhalten an ihren Hauptgrundsätzen zur Herausbildung bedeutender und einflussreicher Fraktionen führen, die in einem Bündnis mit anderen Bewegungen der Zivilgesellschaft eine bedeutende und positive Wirkung entfalten könnten: Kollektives politisches Handeln ist von entscheidender Bedeutung.
DSW, „Common Sense“ und historisch-kontextuelles Denken
Das DSW-Projekt beruht auf dem Verständnis, dass eine fortschrittliche Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit nur dann voranschreitet, wenn wir uns daran machen, Strukturen innerhalb der Strukturen zu schaffen: ideologisch und organisatorisch neue Gruppierungen, die bereit sind, einen „Stellungskrieg“ zu führen und neue Formen eines kritischen „Common Sense“ zu schaffen (Hoare und Nowell Smith, 2005).
Solche Ideen sind mit den Theorien von Antonio Gramsci (1891–1937) verbunden. Für ihn ist der „Gesunder Menschenverstand“ das „polare Gegenteil des kritischen Denkens, das verlangt, dass wir keine ‚Wahrheit‘ unhinterfragt akzeptieren, sondern immer sorgfältig die Beweise hinterfragen, auf denen sie beruht“ (Crehan, 2018). Kritisch zu sein bedeutet, dass wir die Art und Weise hinterfragen, wie Inhalte, Fragestellungen, Themen und Theorien in der etablierten Sozialarbeitsausbildung formuliert und präsentiert werden. Wird über sie gesprochen und geschrieben, als ob sie selbstverständlich wären und nicht mehr hinterfragt werden können? Im Mittelpunkt stehen dabei oft Schlagworte wie „Resilienz“, „Bindung“, „Frühförderung“ usw. Eine kritische Auseinandersetzung mit den dominanten – und dominierenden – Begrifflichkeiten ist jedoch unerlässlich. Innerhalb übergreifender hegemonialer Ordnungen kann der „Common Sense“ dazu führen, dass bestimmte Fragen gar nicht erst gestellt oder überhaupt in Erwägung gezogen werden: „Es ist, wie es ist“, wie es so schön heißt.
Vielleicht führt die DSW auch zu einer Verschiebung hin zu historisch-kontextuellem Denken in der Sozialen Arbeit. Ein Hindernis hierbei ist das, was Freire eine „fokussierte Sicht“ auf soziale Probleme nennt (Freire, 2017 [1970]). Das heißt, dass Probleme in der Sozialen Arbeit durch eine enge Linse wahrgenommen werden, die es versäumt, das „Problem“ historisch, wirtschaftlich und politisch zu verorten. Auch wenn sie von Praktizierenden und Lehrenden oft nicht als solche wahrgenommen wird, ist diese eingeschränkte Sichtweise charakteristisch für „unterdrückerisches kulturelles Handeln“ und lässt die notwendige Berücksichtigung dessen vermissen, was Freire (2017 [1970]) als „Dimensionen einer Totalität“ bezeichnet. Das historisch-kontextuelle Denken markiert einen Bruch mit einer solchen Haltung. Abgeleitet von marxistischen Ansätzen zum sozialen und wirtschaftlichen Wandel versucht historisch-kontextuelles Denken Komplexität und den dynamischen Prozess der Geschichte zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verstehen. Die Bündelung oder Verknüpfung verschiedener Elemente auf diese Weise ermöglicht es uns, ihr Funktionieren innerhalb eines Ganzen zu begreifen, das mehr als die Summe seiner Teile ist. Eines der klassischen Beispiele hierfür ist Policing the Crisis von Stuart Hall und seinen Kollegen, das Ende der 1970er Jahre in Großbritannien veröffentlicht wurde (Hall et al., 1978): Hier liefern die Autor*innen eine detaillierte historisch-kontextuelle Analyse der politischen und medialen Fixierung auf das sogenannte „Mugging“ (eine zutiefst rassistisch geprägte Konstruktion von Straßenraub), die untrennbar mit einem umfassenderen Kontext verbunden war, zu dem auch der Aufstieg der Neuen Rechten und die Aufkündigung des Wohlfahrtskonsenses gehörten.
Schlussfolgerung
Damit soll nicht gesagt werden, dass die im Umfeld der DSW zirkulierenden Ideen frei von Spannungen und Komplexität wären. Widerständige Kritik ist auch anfällig für Vereinnahmung und Einbindung in gegensätzliche Diskurse und Praktiken, da die hegemonialen Apparate des Kapitals ungeheuer aufnahmefähig sind. Wie das chilenische feministische Kollektiv LasTesis (2023) betont, verfügt der Kapitalismus über die „brutale Fähigkeit, sich alles anzueignen“. Selbst Kritiken am Kapitalismus werden verarbeitet, wieder angeeignet, als Werkzeuge des Kampfes zerstört und in Konsumgüter umgewandelt, zu Waren des Marktes gemacht. Einer der Überlebensmechanismen des Kapitalismus zur Aufrechterhaltung seiner Hegemonie besteht darin, Strategien des Widerstands zu absorbieren. Er saugt sie auf, wringt sie aus. Das Bestreben, innerhalb der Sozialen Arbeit und darüber hinaus, einen umfassenden sozialen Wandel herbeizuführen und nicht nur folgenlose Kritik zu üben, könnte jedoch zum radikalen Herzstück der Ausbildung Sozialarbeitender werden. Vielleicht ist das etwas, worüber man am Internationalen Tag der Sozialen Arbeit weiter nachdenken sollte?
Literatur
Crehan, K. (2016): Gramsci’s Common Sense: Inequality and its Narratives. Durham & London: Duke University.
Freire, P. (2017[1970]): Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin Classics.
Hall, S./Critcher, C./Jefferson, T./Clarke, J./Roberts, B. (1978): Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order. Houndmills: MacMillan Education.
Hoare, Q./Nowell Smith, G. (Hrsg.) (2005): Antonio Gramsci: Selections from Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart.
Leung, T. F. (2012): „The Work Sites as Ground of Contest: Professionalisation of Social Work in China“, British Journal of Social Work, 42: 335-352.
Maylea, C. (2021): „The End of Social Work“, The British Journal of Social Work, 51(2): 772-789.
Kim, M. I./Rasmussen, C. W./Washington Sr, D. M. (Hrsg.) (2024): Abolition and Social Work: Possibilities, Paradoxes, and the Practice of Community Care. Chicago: Haymarket Books.
LasTesis (2023): Set Fear on Fire: The Feminist call that set the Americas ablaze. London: Verso.
Paul Michael Garrett 2025, Eine Zeit für Dissenting Social Work?, in: sozialpolitikblog, 18.03.2025, https://difis.org/blog/eine-zeit-fuer-dissenting-social-work-157 Zurück zur Übersicht

Dr. Paul Michael Garrett arbeitet an der Universität von Galway in Irland. Das International Journal of Social Welfare beschreibt ihn als „wahrscheinlich den bedeutendsten Theoretiker der kritischen Sozialarbeit in der englischsprachigen Welt“. 2020 wurde er in die Royal Irish Academy gewählt und 2024 wurde ihm von der Universität Gent die Ehrendoktorwürde verliehen. Er hat unter anderem die Bücher Welfare Words (2018), Dissenting Social Work (2021) und Social Work and Common Sense (2024) verfasst.

Der Forschungsverbund für Sozialrecht und Sozialpolitik (FoSS) der Hochschule Fulda und der Universität Kassel existiert seit 2013. Wissenschaftler*innen der Rechts-, Politik- und Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, und Sozialpädagogik bearbeiten in fünf Arbeitsgruppen aktuelle Fragen zu Diversität, Gesundheit, Kindheit und Familie, Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und zur Sozialgerichtsbarkeit.
Unterstützt wird FoSS vom Verein zur Förderung von Forschung und Wissenstransfer in Sozialrecht und Sozialpolitik e.V. Ihm gehören Institutionen aus der Praxis in Nordhessen an.