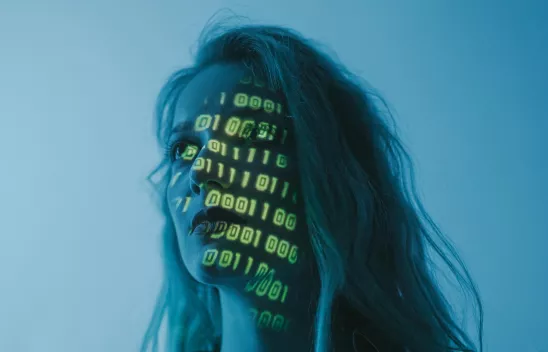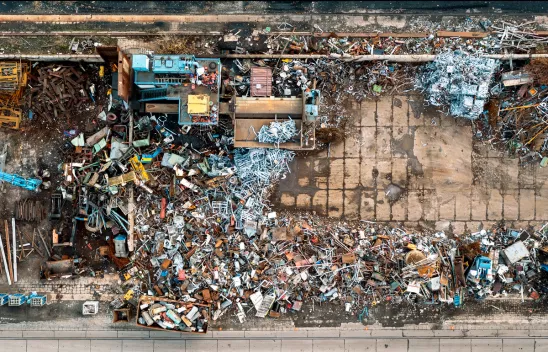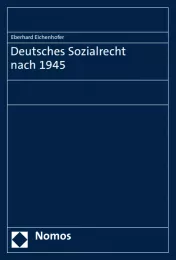Wie sich Altern und unsere Sicht darauf verändern
Das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) wird 50 Jahre alt. Im Laufe der Jahre wandelte sich das DZA vom Dokumentations- zum Forschungsinstitut zur Lebenssituation älter werdender Menschen. Dr. Julia Simonson ist kommissarische Leiterin des DZA und spricht über historische Entwicklungen, aktuelle Projekte und Perspektiven für die Zukunft.
Interview: Johanna Ritter
Das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte DZA feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Wie hat sich Altern in Deutschland seit 1974 verändert?
Die Phase, die wir Alter nennen, ist durch die gestiegene Lebenserwartung länger geworden. Menschen gehen heute auch gesünder und aktiver in das Alter als früher. Zunehmend werden Alter und Älterwerden nicht nur mit Verlusten verbunden, sondern auch mit positiven Aspekten. Auf der anderen Seite muss die längere Ruhestandsphase geplant, strukturiert und finanziert werden. Mit der gestiegenen Lebenserwartung ist beispielsweise auch eine Zunahme von demenziellen Erkrankungen verbunden. Und was ist mit denjenigen, die nicht dem Bild des aktiven älteren Menschen entsprechen, zum Beispiel aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder finanzieller Notlagen? Auch diese Menschen dürfen nicht vergessen werden.
Wie sah das Aufgabenspektrum des Instituts damals aus und wie hat es sich bis heute weiterentwickelt?
Anfangs war das DZA vor allem ein Dokumentationszentrum. Eigene Forschung spielte eine untergeordnete Rolle. Das änderte sich im Laufe der Zeit, vor allem als der Deutsche Alterssurvey mit der zweiten Welle ans DZA kam. Er ist bis heute das Herz unserer Forschung. Mit ihm können wir die Lebenssituationen von Menschen in der zweiten Lebenshälfte sowohl im Längs- als auch im Querschnitt abbilden. Die Themen sind dabei vielfältig: Wohnen, Arbeit und Ruhestand, Gesundheit, Einsamkeit, materielle Situation, Ehrenamt und vieles mehr.
Zu unseren Forschungsprojekten gehören auch zunehmend Drittmittelprojekte zu Themen wie Wohnen im Alter, Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbstätigkeit, Ruhestandsübergängen und vielem mehr. Durch sie erweitern wir unsere Finanzierung, holen uns Expertise ins Institut und bauen Kooperationen aus. Das DFG geförderte Projekt „Historische Unterschiede in der Anpassung an den Ruhestand“ ermöglicht uns beispielsweise eine Kooperation mit Wissenschaftler*innen aus Schweden, Israel und der Schweiz. Seit 2010 bieten wir die Daten des Alterssurveys in unserem Forschungsdatenzentrum für Wissenschaftler*innen aus dem In- und Ausland an.
Aber sie betreiben nicht nur Forschung.
Die Daten des Alterssurveys sind nicht nur die Basis für unsere Forschung, sondern auch für unsere Sozialberichterstattung. Damit wenden wir uns an eine breitere Öffentlichkeit und an die Politik. Des Weiteren bildet die Politikberatung eine wichtige Aufgabe. Die Geschäftsstelle für die Altersberichte der Bundesregierung unterstützt die Arbeit der jeweiligen Sachverständigenkommissionen. Im Januar 2025 soll der Neunte Altersbericht erscheinen, diesmal zum Thema „Alt werden in Deutschland – Potenziale und Teilhabechancen“, also die Unterschiedlichkeit der Lebenssituationen und die ungleiche Verteilung von Teilhabechancen älterer Menschen. Die Geschäftsstelle Nationale Demenzstrategie unterstützt die Entwicklung sowie die Umsetzung der Nationalen Demenzstrategie inhaltlich und organisatorisch. Ein weiterer wichtiger Bereich des DZA sind die Informationssysteme. Neben dem Forschungsdatenzentrum haben wir auch die größte gerontologische Bibliothek im deutschsprachigen Raum am DZA.
Wo steht das DZA in diesem Jubiläumsjahr?
Das Jubiläumsjahr ist aus unterschiedlichen Gründen ein spannendes Jahr für uns. Nachdem der langjährige Institutsleiter Prof. Clemens Tesch-Römer 2023 in Rente gegangen ist, leiten Dr. Laura Romeu Gordo und ich das DZA derzeit kommissarisch. Von einer Neubesetzung der Institutsleitungsstelle ist im Laufe des Jahres 2025 auszugehen. In diesem Übergangsjahr haben wir Neues angeschoben: Wir haben erstmals Comics als Instrument der Wissenschaftskommunikation genutzt Studienteilnehmer*innen in türkischer Sprache angesprochen und die wahrgenommene Bedrohung durch den Klimawandel bei den Älteren untersucht. Die Befunde zum Klimathema hat unsere Kollegin Dr. Mareike Bünning in einem DIFIS Hot Topic vorgestellt und diskutiert. Bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin haben wir das Thema mit Aktivistinnen diskutiert.
Der Deutsche Alterssurvey liefert repräsentative Erkenntnisse über die zweite Lebenshälfte in Deutschland. Immer wieder gibt es auch Neuerungen an der Befragung. Welche Themen haben Sie zuletzt aufgenommen?
Die Frage nach der empfundenen Bedrohung durch den Klimawandel ist ganz neu. Aber auch die Frage danach, welche gesetzlichen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Anspruch genommen werden. Bei der nächsten Erhebung werden verstärkt Heimbewohner*innen und Hochaltrige befragt, wir werden also inklusiver – das erfordert natürlich auch an Lebenssituationen und Belastbarkeit angepasste Befragungsinstrumente
Wie sieht es mit der Einbettung in die internationale Forschungslandschaft aus?
Mit Blick auf die Sozialberichterstattung haben wir lange Zeit hauptsächlich in deutscher Sprache publiziert. Seit 2023 übersetzen wir die Ausgaben unserer Reihe DZA Aktuell ins Englische. Publikationen, die sich vor allem an andere Wissenschaftler*innen wenden, veröffentlichen wir größtenteils in internationalen renommierten Fachzeitschriften. Ein Artikel unseres Kollegen Dr. Oliver Huxhold hat gerade den Richard Kalish Innovative Publication Award der Gerontological Society of America erhalten. Zudem kooperieren wir in Projekten oder für einzelne Publikationen mit Wissenschaftler*innen aus den USA, Schweden, Norwegen, Niederlande, Schweiz und Israel. In unseren Beiräten sind Wissenschaftler*innen aus den Niederlanden, aus Österreich und der Schweiz vertreten.
Das DZA ist außerdem, gemeinsam mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) einer von vier Gesellschaftern, die das SHARE Berlin Institut (SBI), das die Auswirkungen der Gesundheits-, Sozial-, Wirtschafts- und Umweltpolitik in verschiedenen europäischen Ländern untersucht.
Geht es ums Altern, dann steht in der breiten Öffentlichkeit oft vor allem das Thema Pflege im Mittelpunkt.
Das Thema hat auch bei uns einen hohen Stellenwert und daher haben wir es auch bei unserer Veranstaltung zum Jubiläum am 8. Oktober in Berlin aufgegriffen. Beim Parlamentarischen Abend stand die Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbstätigkeit im Zentrum. Es geht dabei nicht nur um die Älteren, die gepflegt werden, sondern auch um die Pflegenden. Unsere Kollegin Dr. Ulrike Ehrlich hat dazu aktuelle Befunde vorgestellt: Fast 97 Prozent der pflegenden Befragten nehmen keine der bestehenden gesetzlichen Maßnahmen zur Vereinbarkeit in Anspruch. In der anschließenden Diskussion mit Bundestagsabgeordneten bestand darüber Einigkeit, dass sich die Situation pflegender Angehöriger verbessern muss – die Frage bleibt, wie Entlastungen finanziert werden sollen.
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Forschungslücken in der Altersforschung aktuell?
Wir wissen noch viel zu wenig über ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, ihre Lebenssituation und ihre Vorstellungen für ihr Alter. In großen Bevölkerungsstudien sind Menschen mit Migrationsgeschichte meist unterrepräsentiert, auch im Alterssurvey haben wir dieses Problem. Im DFG-geförderten Projekt TaRec, das wir gemeinsam mit dem DeZIM und dem BAMF-FZ durchführen, möchten wir herausfinden, wie Menschen mit Zuwanderungsgeschichte besser für Umfragestudien gewonnen werden können. Dies würde mittelfristig auch dem Alterssurvey zugutekommen.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Generation der Babyboomer: Über ihre konkreten Vorstellungen in Bezug auf Wohnen und Versorgung im Alter wissen wir noch sehr wenig. Wir haben kürzlich auch einen Projektantrag dazu (gemeinsam mit dem Institut für Gerontologische Forschung, IGF e.V.) gestellt.
Das DZA ist Kooperationspartner des DIFIS. Wie könnte man die Kooperation noch ausbauen?
Thematisch gibt es viele Schnittmengen zwischen DIFIS und DZA, die Anlass für gemeinsame Veranstaltungen bieten. Da wir gerade unsere Bemühungen im Bereich Wissenschaftskommunikation verstärkt haben, sind wir an einem engen Austausch mit dem DIFIS interessiert, um neue Ideen zu diskutieren.
Welchen künftigen Herausforderungen sehen Sie sich gegenüber?
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell ein neues Thema, das gerade für die ältere Bevölkerung gravierende Auswirkungen hat, auf dem Tableau sein kann: Wir mussten 2020 nicht nur eine bevorstehende Befragung des Alterssurveys stoppen, weil persönliche Befragungen plötzlich nicht mehr möglich waren; wir haben auch in kurzer Zeit einen neuen schriftlichen Fragebogen entwickelt, mit dem wir die Situation und das Bedrohungsempfinden während der Pandemie erhoben haben. In dem Projekt CoESI untersuchen wir, wie sich die Pandemie mittel- und langfristig auf soziale Beziehungen auswirkt. Diese Erfahrung gibt uns Zuversicht, dass wir auch künftig für sich plötzlich verändernde gesellschaftliche Situationen gut gerüstet sind und flexibel auf sie reagieren können.
Diese Flexibilität werden wir auch brauchen: Die Auswirkungen der Klimakrise betreffen Ältere auf besondere Weise. Hinzu kommen weitere Entwicklungen wie eine zunehmende Altersarmut und der Fachkräftemängel in wichtigen Bereichen wie der Pflege, der weiterhin ein großes Thema bleibt. Wie diese Poly-Krisen das Leben der Menschen in der zweiten Lebenshälfte beeinflussen, wird sicher auch in unserer Forschung in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen.
Eine Herausforderung – für uns, aber auch für andere Forschungsinstitute – wird vermutlich auch darin bestehen, diese wichtige Forschung in Zeiten begrenzter finanzieller Ressourcen und wissenschaftsfeindlicher Haltungen in Teilen der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
Julia Simonson 2024, Wie sich Altern und unsere Sicht darauf verändern, in: sozialpolitikblog, 12.12.2024, https://difis.org/blog/wie-sich-altern-und-unsere-sicht-darauf-veraendern-145 Zurück zur Übersicht

Dr. Julia Simonson ist kommissarische Leiterin des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Sie hat den Deutschen Freiwilligensurvey und den Deutschen Alterssurvey geleitet. Ihre Forschungsschwerpunkte sind soziale Ungleichheit, Freiwilliges Engagement und Partizipation, Erwerbsverläufe und Alterssicherung und Methoden der empirischen Sozialforschung.