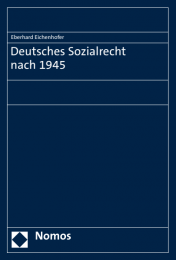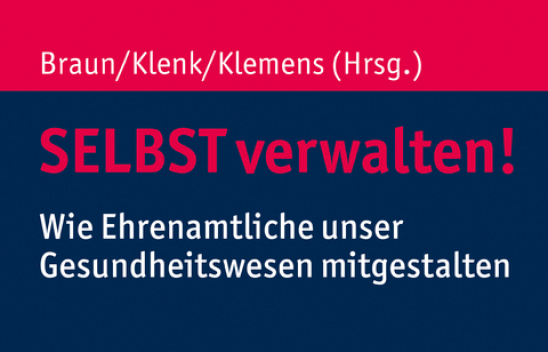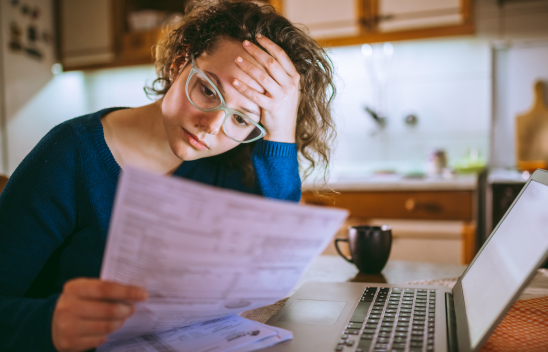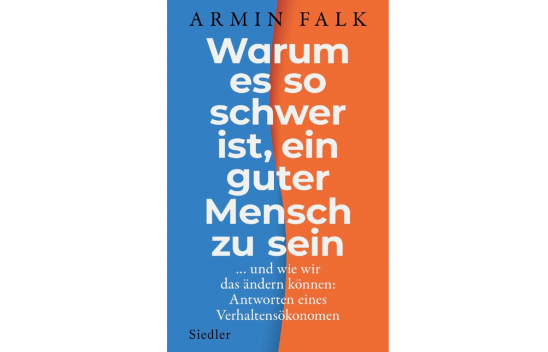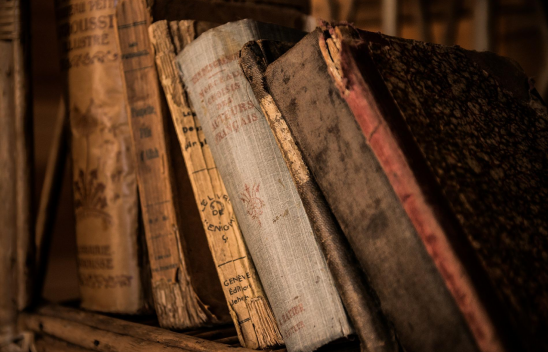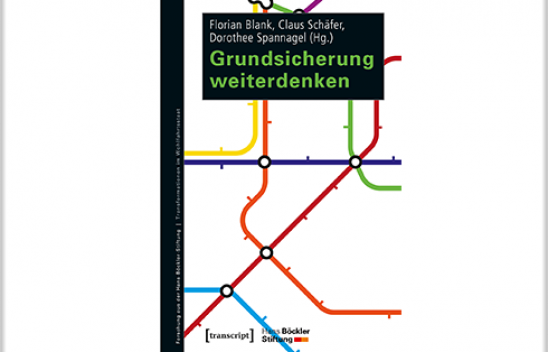Fragmentierung in der Forschung – Integration im Studium?
Das FIS-Forum 2024 widmete sich zurecht der Fragmentierung und Integration als einem zentralen Spannungsfeld der deutschen Sozialpolitik. Jahrzehnte inkrementeller Veränderungen und umfassender Reformen haben ein System geschaffen, das zunehmend an seiner eigenen Komplexität krankt. Das Angebot an Leistungen ist für Adressat*innen häufig schwer zu überblicken, die zuständigen Anlaufstellen schwer zu identifizieren und die Antragsverfahren kompliziert. Diese institutionelle Zersplitterung der Sozialpolitik ist ein Problem für Politik, Praxis und letztlich auch die Forschung, dessen Lösung sie alle auf Jahre beschäftigen wird.
Integrationslücke in der Forschung
Übersehen oder zumindest nicht direkt angesprochen wird dabei aber die Situation in der Forschung selbst. Unübersichtlichkeit und ein Mangel an sauber integrierten Strukturen ist auch der Forschung nicht fremd und prägt in vielerlei Hinsicht den Nachwuchs – möglicherweise zum Nachteil des gesamten Feldes.
Wie sich die fragmentierte Natur des deutschen Sozialstaats auf die Forschung auswirkt, ist schon an den organisatorischen Strukturen ersichtlich. Das FIS-Forum selbst ist ein Ausdruck davon. Trotz der Bandbreite abgedeckter Themen, von gesellschaftlichen Ansichten zu Sozialleistungen für Migrant*innen hin zu den Gelingens-Faktoren einer nachhaltigen Sozialpolitikforschung, bleiben unerschlossene Areale. Wie Anwesende bereits während der Vorträge anmerkten, sind die Bereiche Pflege, Gesundheit oder Bildung oft abwesend, was letztlich den Zuständigkeiten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) geschuldet ist, das für die Finanzierung des FIS (Fördernetzwerk Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung) verantwortlich ist, sich dabei aber auf die Politiken im Kompetenzbereich des Ministeriums beschränkt. Insofern setzt sich die institutionelle Struktur des deutschen Sozialstaates mittelbar auch in der Forschung fort und kreiert Barrieren zwischen Forschungsfeldern. Allerdings lässt sich längst nicht alles auf ministerielle Zuständigkeiten zurückführen, manche sind auch dem Selbstverständnis der Forschung und ihrer Definition von Sozialpolitik geschuldet. So ist es in Großbritannien etwa selbstverständlich, Wohnpolitik als eines der Kernelemente des Wohlfahrtsstaates stets zu berücksichtigen. In der deutschen Tradition und in einschlägigen Werken bleibt Wohnen i.d.R. außen vor (Weishaupt 2023).
Dabei ist die Nicht-Betrachtung individueller Forschungsfelder nur ein Teil des Problems. Denn selbst wo Forschung stattfindet, droht Fragmentierung, wenn übergreifende Forschung ausbleibt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zunächst spezialisieren sich Forschende (nicht zuletzt wegen der Komplexität der Forschungsfelder) auf individuelle Themen. Auch wenn sie dadurch häufig qualitativ hochwertige Befunde ermitteln sind diese losgelöst vom Kontext anderer Felder, wodurch Ähnlichkeiten, Unterschiede und Wechselwirkungen eher ausgeklammert werden. Erschwerend hinzu kommen die geographisch-organisatorische Verteilung der Sozialpolitikforschung auf verschiedene Standorte mit eigenen Forschungsschwerpunkten, sowie die disziplinäre Zuordnung der Forschenden. Politikwissenschaft, Soziologie, Ökonomie, Rechts- und Verwaltungswissenschaften und viele weitere Disziplinen setzen sich unter Verwendung eigener Methoden und spezifischer Blickwinkel mit sozialpolitischen Fragestellungen auseinander. Austausch und Kooperation sind nicht garantiert. Wenn Fragmentierung im Sozialstaat die Bearbeitung derselben sozialen Risiken durch verschiedene Stellen bedeutet (Bogumil und Gräfe 2024) dann hat die Forschung über Jahre ihre ganz eigene Version geschaffen.
Integrationslücke im Studium
Die meisten Punkte, die bis hierher besprochen wurden, dürften Forschenden bekannt vorkommen und in der Tat handelt es sich um anerkannte Probleme. Trotz wiederholter und teils lauter Kritik am Status-Quo scheint es deutlich weniger Bewusstsein dafür zu geben, dass die Fragmentierung der Forschung auch auf den Nachwuchs durchschlägt und Defizite hinsichtlich Quantität und Qualifikation nach sich ziehen könnte.
In Ermangelung eines spezifischen sozialpolitischen Studienangebots starten Studierende zunächst in eine der verschiedenen Fachrichtungen, die mit der Sozialpolitikforschung assoziiert sind. überlassen, ob die Studierenden überhaupt Berührungspunkte mit anderen Disziplinen und Feldern der Sozialpolitikforschung haben, geschweige denn, ob sie diese zu ihrem Schwerpunkt machen werden. Sogar bei einer nominell ausreichenden Anzahl Nachwuchskräften läuft das Feld deshalb Gefahr, Positionen mit speziellen fachlichen Anforderungen nicht besetzen zu können. Im schlimmsten Fall fallen ganze Disziplinen innerhalb der Sozialpolitikforschung in die Randständigkeit.
Selbst interdisziplinäre, explizit an Sozialpolitik ausgerichtete Studiengänge sind nicht immun gegen solche Schieflagen. Die Fähigkeit, den Studierenden eine umfassende Ausbildung zukommen zu lassen, hängt direkt mit dem Angebot an Lehrveranstaltungen zusammen, das wiederum von der Expertise des Lehrpersonals bestimmt wird. Besteht dieses nur aus Vertreter*innen einzelner Disziplinen oder bestimmter Forschungsschwerpunkte, ergeben sich quasi automatisch Lücken und tote Winkel bei den Studierenden. Während die Schnittmengen zwischen einzelnen Disziplinen, z. B. Politikwissenschaft und Soziologie, noch recht groß sind, dürfte deren Verknüpfung etwa mit den Rechts- oder Verwaltungswissenschaften weniger intensiv sein. Mit dem Fortschreiten der wissenschaftlichen Ausbildung ist i.d.R. eine zunehmende Spezialisierung verbunden. Insofern fallen Lücken in der Grundausbildung schwerer ins Gewicht, da die Gelegenheit, Kenntnisse in anderen Bereichen zu erwerben, hier noch am ausgeprägtesten sein dürfte.
Integrierter Studieren?
Wenn das Problem in der Zersplitterung liegt, muss die Lösung im Zusammenfügen liegen, kurz: in der Integration. Auf einigen Gebieten ist die Forschung auf äußere Hilfe angewiesen, speziell die der Politik, um institutionelle Schranken zu überwinden. Natürlich sind alle möglichen Änderungen den finanziellen und politischen Gegebenheiten der Zeit unterworfen. Nichtsdestotrotz existieren Bereiche, in denen Forschung und Hochschulen selbst die Initiative ergreifen und nennenswerte Fortschritte erzielen könnten. Aus der Perspektive des Autors ergeben sich speziell im Bereich des Studiums Potenziale, in denen Integration zusätzlich vorangetrieben werden könnte:
- Ausweitung interdisziplinärer Studiengänge: Bisher existieren nur wenige dezidiert sozialpolitische Studiengänge, die gleichzeitig geographisch verstreut sind und nicht immer dasselbe Qualifikationsniveau zum Ziel haben. Mit der Etablierung neuer Formate an neuen Standorten könnte die Präsenz des Feldes deutlich erweitert werden, was wiederum im Sinne der Nachwuchsgewinnung ist. Ziel muss sein, Sozialpolitik als eigenes Studium so zu verankern, dass es nicht nur bekannt ist, sondern allgemein als ernsthafte Alternative zu seinen Teildisziplinen akzeptiert wird. Dabei wäre es ratsam, Studienangebote zu schaffen, die bereits auf Bachelor-Niveau beginnen. Sozialpolitische Masterstudiengänge können hervorragend funktionieren. Allerdings ist das Feld so breit, dass, wenn es erst im Master ansetzt, nur bedingt als Spezialisierung taugen kann. Umso mehr, wenn dem Master eine Vielzahl verschiedener Disziplinen vorgeschaltet ist, deren Studierende über teils stark divergierende fachliche und methodische Vorkenntnisse verfügen und die erstmal auf „einen Nenner“ gebracht werden müssten. Eigenständige Bachelor- und Master-Studiengänge haben sich in der Praxis bereits als mehr als tauglich erwiesen. Trotzdem könnte ein durchgehendes, d.h. integriertes Angebot, das beide Abschlüsse eng miteinander verbindet, einen wertvollen Zusatz bieten.
- Bessere Verzahnung des Lehrangebots: Es sollte klargestellt werden, dass eigene Studiengänge die existierende Infrastruktur der anderen Disziplinen nicht ersetzen, sondern vielmehr ergänzen sollen. Tatsächlich wäre es wünschenswert, die Formate so eng miteinander zu verbinden, wie möglich. Gemeinsame Lehrveranstaltungen und gegenseitige Anerkennung von Leistungen sind Voraussetzung für den Erfolg. In der Praxis enthalten Prüfungsordnungen häufig noch Hürden und Barrieren, die den Erwerb von Credit-Points in angrenzenden Veranstaltungen erschweren oder sogar untersagen. Würden solche Barrieren fallen, könnten nicht nur mehr Studierende an das Feld herangeführt, die Sozialpolitikforschung könnte auch von der spezialisierten Expertise der anderen Disziplinen profitieren. In diesem Sinne ist es notwendig, möglichst viele angrenzende Disziplinen einzubinden. Die größte Herausforderung besteht vielleicht darin, institutionelle Gräben zu überwinden und Fachrichtungen zusammenzubringen, die sich selbst als separat sehen.
Über eine bessere Integration nachzudenken ist in jedem Fall ein lohnendes Unterfangen, denn eine integrierte Ausbildung ist vielleicht der beste Weg zu einer integrierten Forschung. Und diese könnte wiederum zur Entwicklung einer besser integrierten Sozialpolitik beitragen.
Literatur
Weishaupt, T. (2023): Wohnen, die neue soziale Frage: von aktuellen Herausforderungen und der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels. Deutsches Institut für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung. DIFIS-Impuls- 2023/12.Bogumil, J./Gräfe, P. (2024): Fragmentierung der Sozialpolitik – Schnittstellen und Brüche zwischen unterschiedlichen Sozialpolitikfeldern. Eine Literaturstudie. Deutsches Institut für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung. DIFIS-Studie 2024/06.
Felix Bernshausen 2025, Fragmentierung in der Forschung – Integration im Studium?, in: sozialpolitikblog, 27.02.2025, https://difis.org/blog/?blog=153 Zurück zur Übersicht

Felix Bernshausen ist aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kooperationsstelle Hochschule – Gewerkschaften der Universität Oldenburg und hat davor seinen Master Sozialpolitik an der Universität Bremen abgeschlossen.