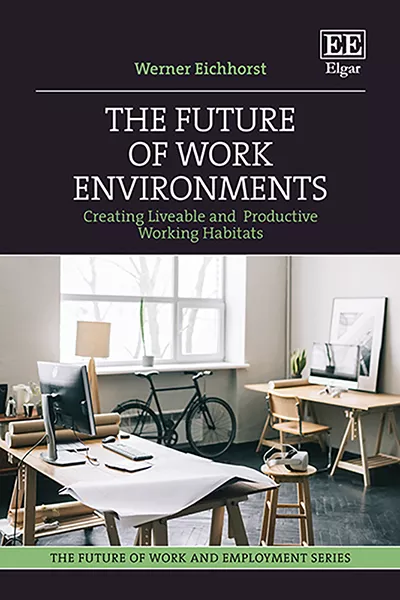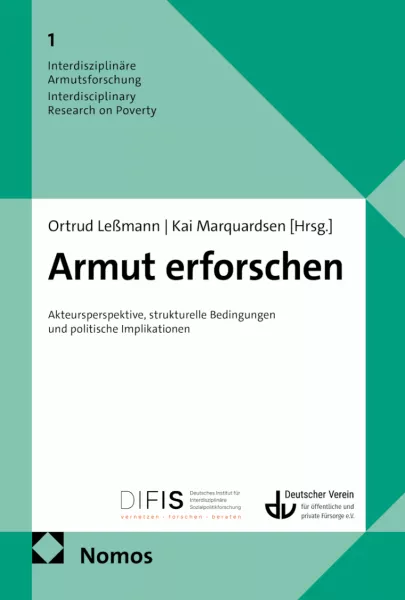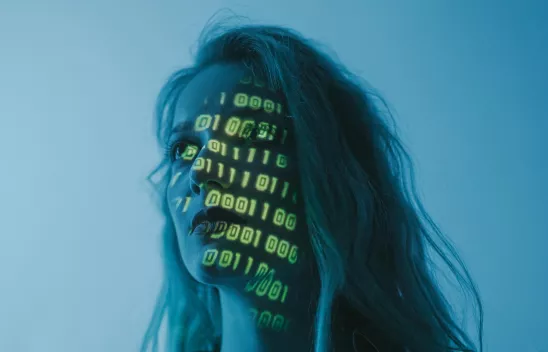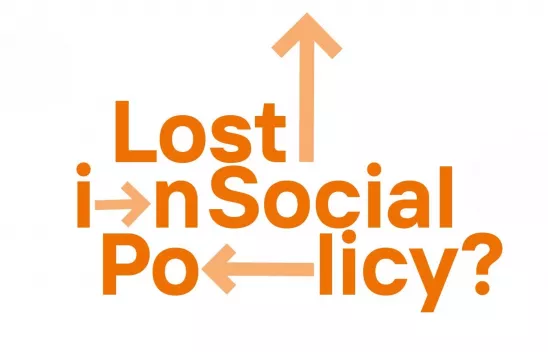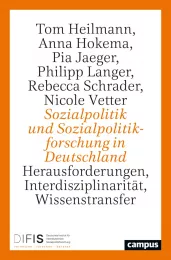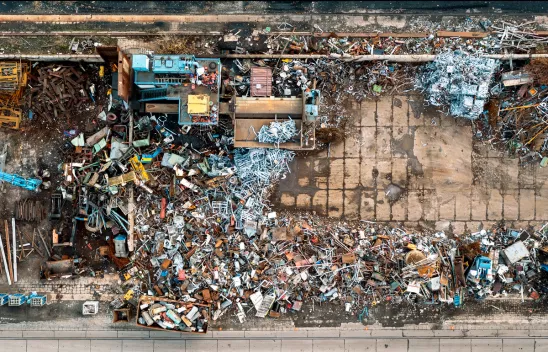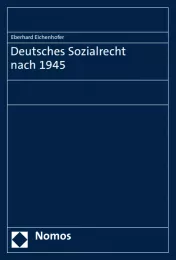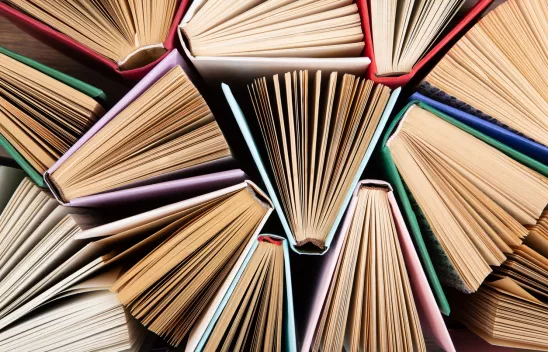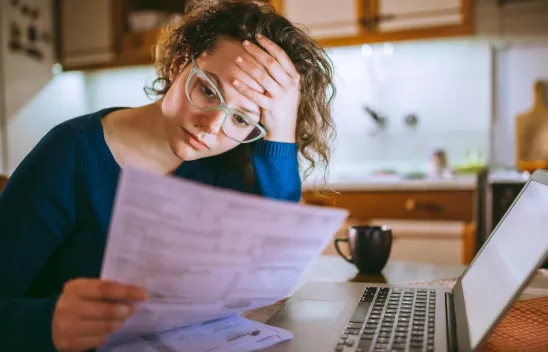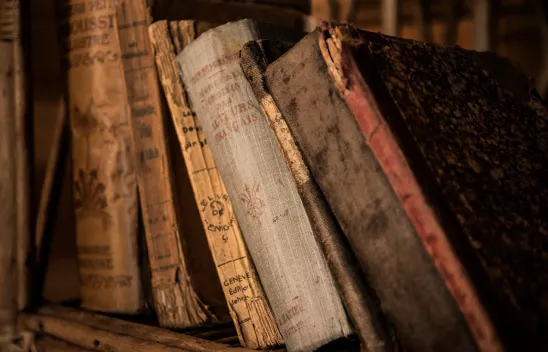Laura Lüth, 18.12.2025
Care: Leistungslogik festigt Ungleichheit
Sorgearbeit in Paarbeziehungen bleibt ungleich verteilt. Wöchentliche Planungsmeetings und Schichtdienste für den Familienalltag versprechen Abhilfe. Doch können solche Praktiken Geschlechterungleichheiten abbauen? Nein, sagt Laura Lüth, die zu dem Thema forscht. Ungleichheiten halten durch die Hintertür wieder Einzug.
weiterlesen
Agnieszka Piasna, 27.11.2025
Zurück in die Zukunft der Arbeit
In ihrer Rezension zu Werner Eichhorsts neuem Buch The Future of Work Environments hebt Agnieszka Piasna hervor, wie umfassend der Autor die Rolle der Arbeit beleuchtet und dabei eine zentrale Frage stellt: Wie können Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass Menschen sich beruflich wie privat entfalten und zu einer florierenden Gesellschaft und Wirtschaft beitragen?
weiterlesen
Ortrud Leßmann, Kai Marquardsen, 13.11.2025
"Von Armut zu sprechen ist nicht neutral"
Im DIFIS Issue Network Armutsforschung entstand ein Sammelband, der Armut in unterschiedlichen Facetten beleuchtet – von der Lebensrealität Betroffener bis zu ihren strukturellen Ursachen. Im Mittelpunkt steht die Akteursperspektive, die Menschen als handelnde Subjekte begreift. Wir sprechen mit den Herausgeber*innen über Idee und Bedeutung.
weiterlesen

Werner Eichhorst, 17.07.2025
Mehr Fordern als Fördern?
Die neu formierte Bundesregierung sieht sich in der 21. Legislaturperiode vor historischen Herausforderungen und will neue Akzente in der Arbeitsmarktpolitik setzen. Prof. Dr. Werner Eichhorst erörtert im sozialpolitikblog-Gespräch die Perspektiven der Politik unter veränderten Rahmenbedingungen.
weiterlesen
Katrin Menke, 03.07.2025
Reproduktionspolitiken als neues Feld der Sozialpolitikforschung
Inwiefern ist und sollte der Sozialstaat in Fragen der menschlichen Fortpflanzung involviert sein? Dieser Frage geht der Sammelband „Reproduction Policy in the Twenty-First Century“ nach, der von Hannah Zagel herausgegeben wurde. Zwölf Kapitel liefern Analysen der Reproduktionspolitiken etwa von Deutschland, Polen, den USA, Südkorea oder Uganda – und damit erste Einsichten in ein noch junges, globales Forschungsfeld der Sozialpolitikforschung. Katrin Menke hat den Band gelesen und für sozialpolitikblog rezensiert.
weiterlesen

Felicitas Hillmann, Lisa Sommerfeld, Gökçe Şenol, 26.06.2025
Zwischen Scam und dem Versprechen fairer Migration: die Vermittlungspraxis
Mit der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte soll der Fachkräftemangel im deutschen Arbeitsmarkt bekämpft werden. Verschiedene Initiativen sollen dabei sicherstellen, dass die Vermittlungspraxis nach fairen Maßstäben erfolgt, sowohl was die Arbeitsverhältnisse in Deutschland angeht, als auch bezüglich der Folgen für die Herkunftsländer und für die Migrant*innen selbst. Felicitas Hillmann, Lisa Sophie Sommerfeld und Gökçe Şenol haben in einer Mikrostudie die internationale Vermittlungspraxis im Kontext fairer Migration untersucht und präsentieren ihre Erkenntnisse.
weiterlesen
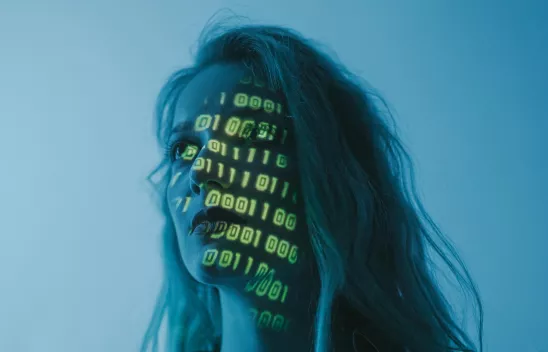
Gina Glock, 17.04.2025
Algorithmen in der Dienstleistungsarbeit: Es muss nicht weniger Autonomie sein
Schafft Künstliche Intelligenz neue Handlungsspielräume bei der Arbeit? Diese Frage ist eng verbunden mit der Hoffnung auf technische Heilsbringer zur Entlastung von Beschäftigten von müßigen Routinen, als kreativer Allrounder, als Wundermittel für Produktivität und Effizienz oder gar als Antwort auf den Fachkräftemangel. Gina Glock berichtet Forschungsergebnisse aus ihrer Dissertation "Algorithmic Decision-Making in Service Work".
weiterlesen

Kati Kuitto, Dirk Hofäcker, 27.03.2025
Junge Erwachsene: prekäre Arbeit, ungewisse Rente
Die Arbeitsmarktunsicherheit junger Erwachsener hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Das wirkt sich negativ auf ihre Alterssicherung aus. Ein europäisches Forschungsprojekt hat das Sparverhalten und die Rentenansprüche junger Menschen im internationalen Vergleich untersucht und leitet aus den Ergebnissen Empfehlungen für die Rentenpolitik ab.
weiterlesen

Florian Blank, 06.03.2025
Eine bessere Alterssicherung bei prekärer Arbeit?
Befristete Arbeitsverträge, geringe Stundenlöhne und Teilzeitbeschäftigung können bewirken, dass Menschen keine Ansprüche auf existenzsichernde Rente haben. Das öffentliche Alterssicherungssystem kann aber für ausreichende Renten sorgen, auch wenn die früheren Beitragszahlungen gering waren. Ob die Idee einer speziellen Beitragsgestaltung dazu beitragen kann, prüft Florian Blank in seinem Beitrag.
weiterlesen
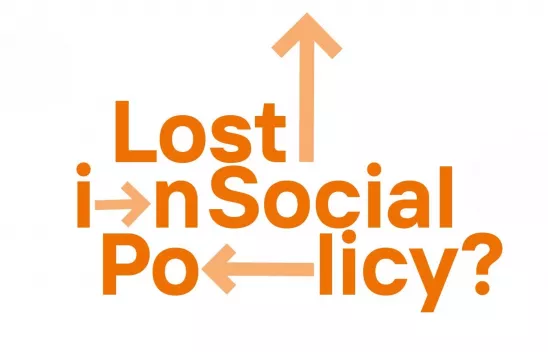
Felix Bernshausen, 27.02.2025
Fragmentierung in der Forschung – Integration im Studium?
Fragmentierung lässt sich nicht nur in der institutionellen Ausgestaltung des Sozialstaats und in der Sozialstaatspraxis beobachten, sondern auch in der sozialpolitischen Forschung. Felix Bernshausen diskutiert Ansätze zur Integration in der Sozialpolitikforschung aus der Perspektive des wissenschaftlichen Nachwuchses.
weiterlesen

Christopher Smith Ochoa, Corinna Schein, Laura Einhorn, 06.02.2025
Positioniertheit, Grenzen und Emotionen in der Armutsforschung
Wissenschaftler*innen des Projekts „DemSoZ – Sozialstaatsreform ‚von unten‘“ reflektieren über ihre persönlichen Erfahrungen im Forschungsprozess zur Interessenvertretung armutsbetroffener Menschen, die Rolle der Forschung in gesellschaftlichen Ungleichheitsdynamiken, die eigene Positioniertheit und Emotionalität.
weiterlesen

Julia Simonson, 12.12.2024
Wie sich Altern und unsere Sicht darauf verändern
Das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) wird 50 Jahre alt. Im Laufe der Jahre wandelte sich das DZA vom Dokumentations- zum Forschungsinstitut zur Lebenssituation älter werdender Menschen. Dr. Julia Simonson ist kommissarische Leiterin des DZA und spricht über historische Entwicklungen, aktuelle Projekte und Perspektiven für die Zukunft.
weiterlesen
Bastian Becker, 05.12.2024
Das Bürgergeld: Ein unvollendetes Kapitel der Sozialpolitik
Das Bürgergeld ist eines der zentralen Projekte der Ampelregierung und wird im Vorwahljahr eifrig diskutiert. Wie kam es dazu und kann es halten, was es verspricht? Diese Fragen beleuchtet der Sammelband „Der weite Weg zum Bürgergeld“, herausgegeben von Michael Opielka und Felix Wilke, in elf Kapiteln von 16 Autor*innen. Bastian Becker hat den Band gelesen und für sozialpolitikblog rezensiert.
weiterlesen

Lukas Lehner, 24.10.2024
Die Jobgarantie von Marienthal
Die Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ veranschaulicht bis heute die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit. 90 Jahre später untersuchte ein Forschungsprojekt die Auswirkungen eines umgekehrten Ereignisses, indem allen langzeitarbeitslosen Einwohner*innen ein Arbeitsplatz angeboten wurde – und sieht positive Effekte.
weiterlesen

Serkan Topal, Fabian Hoose, 17.10.2024
Regulierung von Plattformarbeit: Für wen und wie?
Plattformarbeit ist oft prekär. Eine neue Richtlinie der EU soll den Beschäftigungsstatus von Plattformarbeitenden klären und sichern. Wie die Arbeitenden selbst, Plattformanbieter, Gewerkschaften und andere Stakeholder auf die Regulierung und soziale Absicherung blicken, hat ein Forschungsprojekt erkundet.
weiterlesen

Peter Starke, 10.10.2024
Die neue Härte?
Sanktionen beim Bürgergeld machen wieder Schlagzeilen und werfen die Frage nach dem Maß sozialstaatlicher Disziplinierung auf. Eine aktuelle Studie widmet sich dem Zusammenhang von Leistungssanktionen und Law-and-order-Politik in der inneren Sicherheit. Geht ein härteres Strafrecht auch mit mehr sozialstaatlichen Sanktionen einher? Die Autoren kommen zu überraschenden Ergebnissen.
weiterlesen
Tom Heilmann, 26.09.2024
Wie anwendungsorientiert sollte Sozialpolitikforschung sein?
Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis sind sich größtenteils einig über sozialpolitische Herausforderungen. Sie haben aber unterschiedliche Erwartungen an deren Erforschung. In einer Interviewstudie mit Vertreter*innen beider Seiten sind DIFIS-Autor*innen diesen Perspektiven systematisch auf den Grund gegangen.
weiterlesen

Theresia Kayed, Johannes Wieschke, Susanne Kuger, 19.09.2024
Herausforderungen der Kindertagesbetreuung: Handlungsbedarf bei den Jüngsten
Der Bedarf an Plätzen in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) erreichte im Jahr 2023 für Kinder unter drei Jahren einen neuen Höchststand. Obwohl das Betreuungsangebot expandiert, reicht es häufig nicht aus, zeigt eine neue Studie des Deutschen Jugendinstituts im Auftrag des Bundesfamilien-ministeriums. Vor allem Eltern von Kindern unter drei Jahren sind betroffen. Auch Familien in sozialen Risikolagen haben es schwerer.
weiterlesen

Finn Beckmann, Johannes Greiser, 29.08.2024
Streitpunkt Regelbedarfsbemessung im Bürgergeld
Wie hoch die Regelsätze im Bürgergeld sein sollen, ist politisch seit Jahren sehr umstritten. Jenseits der politischen Debatte gibt es auch verfassungsrechtliche Anforderungen an das Existenzminimum, sagt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Wie großzügig es seine Kompetenzen auslegen darf, fragt dieser Beitrag aus interdisziplinärer Perspektive.
weiterlesen
Kirsten Hoesch, 25.07.2024
Perspektivwechsel entlang der ‚Phantomgrenze‘
Mit „Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt“ macht Steffen Mau unterschiedliche Sichtweisen in Ost und West auf die Geschichte seit der Wende deutlich und bietet eine Orientierungshilfe, schreibt Kirsten Hoesch in ihrer Rezension. Sie beleuchtet die Neuerscheinung mit Blick auf dessen Diagnose zu soziostrukturellen Unterschieden und Herausforderungen des Wohlfahrtsstaats.
weiterlesen
Remi Maier-Rigaud, 18.07.2024
Die Kölner Tradition: Mehr als nur Empirie
Sozialpolitikforschung steht vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen empirischer Analyse und normativen Zielsetzungen einer lebenswerten Gesellschaft zu finden. So lautet das Verständnis der Kölner Tradition der Sozialpolitikforschung, das in einer Festschrift für Professor Frank Schulz-Nieswandt gewürdigt wird. Dieser Blogbeitrag beleuchtet den Balanceakt eines normativ-kritizistischen Sozialpolitikverständnisses und seine Bedeutung für eine gerechte Gesellschaft.
weiterlesen

Laura Boemke, Tine Haubner, 11.07.2024
In der Abwärtsspirale?
Ländliche Armut ist oft nur ein Nebenschauplatz der Forschung. Ein kürzlich abgeschlossenes Forschungsprojekt macht Armut auf dem Land sichtbar und zeigt die Grenzen aktivierender Arbeitsmarktpolitik in ländlichen Peripherien auf.
weiterlesen

Jana Windwehr, Torben Fischer, 04.06.2024
Sozialpolitik im Europawahlkampf
Die Europawahl findet in den kommenden Tagen statt. Die sozialpolitischen Vorhaben der Parteien für die kommenden fünf Jahre analysieren PD Dr. habil. Jana Windwehr und Torben Fischer im zweiten Teil des Interviews zur Europawahl und Sozialpolitik.
weiterlesen

Jana Windwehr, Torben Fischer, 28.05.2024
Welche Bedeutung hat die Europawahl für die Sozialpolitik?
Die Europawahlen stehen unmittelbar bevor. In Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Welche Bedeutung kommt diesen Wahlen für die Sozialpolitik zu? Im ersten Teil dieses Interviews zur Europawahl ziehen PD Dr. habil. Jana Windwehr und Torben Fischer eine Bilanz der Von-der-Leyen-Kommission.
weiterlesen

Patricia Frericks, Julia Höppner, 13.05.2024
Ungleiche Umverteilung: Familien im Vergleich
Armutsgefährdete Familien in Deutschland erhalten geringere Sozialleistungen als ihnen zustehen und zahlen höhere Abgaben als sie müssten – für Familien mit höheren Einkommen gilt das Gegenteil. Das zeigt eine Studie aus dem DFG-Projekt FaSo. Die Ergebnisse werfen ein Schlaglicht auf die diskutierten Änderungen bei der Kindergrundsicherung, dem Kinderfreibetrag und den Steuerklassen bei Paaren.
weiterlesen

Timo Weishaupt, 29.04.2024
Der Nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit: Ein Kommentar
Die SPD-Bündnis90/Die Grünen-FDP Regierungskoalition hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 die Wohnungslosigkeit in Deutschland abzuschaffen. Derzeit wird es für viele Menschen aber immer schwieriger an bezahlbaren Wohnraum zu kommen und Wohnungslosigkeit schrieb 2023 einen neuen Rekordwert. Der Nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit beinhaltet wichtige Instrumente. Allein dabei kann es nicht bleiben.
weiterlesen

Anna Wanka, Moritz Heß, 18.04.2024
Pflegende Studierende: Versteckte Leben
Mehr als zehn Prozent aller Studierenden pflegen Angehörige. Für sie ist das häufig eine Belastung – doch das Umfeld bekommt meist wenig davon mit. Woran das liegt und wie sich es ändern lässt, damit befasst sich ein neues Forschungsprojekt.
weiterlesen

Bettina Kohlrausch, 11.04.2024
Soziale Desintegration: Nährboden für Rechtsextremismus
Die Enthüllungen von Correctiv verdeutlichten die tiefsitzenden Wurzeln rechter Ideologien in der deutschen Gesellschaft. Doch während die Gegendemonstrationen ein Zeichen der Hoffnung setzen, bleibt die Frage nach den sozialpolitischen Ursachen für rechtsextreme Einstellungen zentral. Über die komplexen Zusammenhänge zwischen Anerkennungsverlust, Arbeitswelt und dem Aufstieg des Rechtsextremismus spricht Bettina Kohlrausch, Direktorin des WSI, im Interview.
weiterlesen

Josef Hilbert, Gerhard Naegele, Hans-Peter Klös, 27.03.2024
Digitalisierung und Kommunalisierung in der Pflegeversorgung
In der Pflegeversorgung gibt es zahlreiche Herausforderungen. Während die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, wächst die Zahl der Pflegekräfte und familiär Pflegender nicht an. Welche Potentiale neue Technologien in Kombination mit kommunaler Versorgung bieten können, erkunden die Autoren dieses Beitrags.
weiterlesen

Julia Jirmann, 29.02.2024
Das Ringen um Kinderfreibetrag und Kindergeld
Finanzminister Christian Lindner plant noch in diesem Jahr, die Kinderfreibeträge zu erhöhen, ohne dabei das Kindergeld erneut anzupassen. Damit würden einseitig Eltern mit höheren Einkommen entlastet. Das steht jedoch Vereinbarungen des Koalitionsvertrags entgegen. Verfassungsrechtlich wäre auch eine andere Lösung möglich, die wird aber noch zu wenig diskutiert.
weiterlesen

Christian Gräfe, 22.02.2024
Familienleben im Grundsicherungsbezug
Familien, die mit dem Existenzminimum leben, begegnen im Alltag vielen Zwängen und erleben kritische Lebensphasen. Eine qualitative Studie beleuchtet die Lebenswelten von Familien in der Mindestsicherung und deren Strategien, Armutslagen zu verarbeiten. Fachkräfte in Jobcentern beeinflussen die Lebenssituation von Familien und müssen sich auf die Lebensumstände der Familien einstellen.
weiterlesen
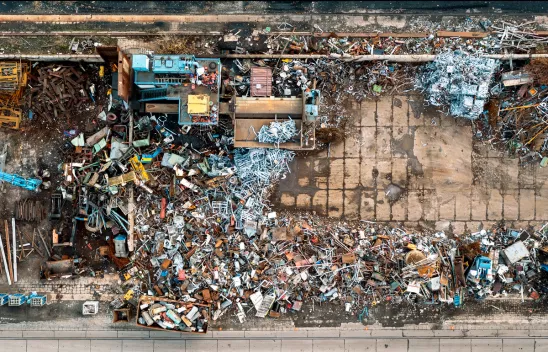
Ayodeji Stephen Akinnimi, 02.02.2024
Ohne Bleibeperspektive: Asylbewerber*innen aus Nigeria und Ghana suchen ihren Weg auf dem deutschen Arbeitsmarkt
Der Zugang von Migrant*innen zum Arbeitsmarkt wird durch ihren rechtlichen Status bestimmt. Wer keine Bleibeperspektive hat, ist auf den informellen Arbeitsmarkt angewiesen. Ohne soziale Absicherung, aber als Teil der globalen Erwerbsbevölkerung. Ethnographische Feldforschung verdeutlicht, dass es an der Zeit ist, diese Realität anzuerkennen.
weiterlesen

Kai-Uwe Hellmann, Sebastian Nessel, 25.01.2024
Verbraucherpolitik als Sozialpolitik?
Stark gestiegene Preise für Energie, Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs machen es deutlich: Verbraucher- und Sozialpolitik liegen eng beieinander. Ein Appell für eine stärkere Verschränkung beider Perspektiven in der Politik und in der Forschung.
weiterlesen
Tim Deeken, Jannis Hergesell, 18.01.2024
Wider die These vom Niedergang des Sozialstaats
Mit „Deutsches Sozialrecht nach 1945“ legt Eberhard Eichenhofer einen Rückblick auf die Geschichte des deutschen Sozialrechts vor, die interdisziplinär anschlussfähig ist. Zudem er wirft einen Blick nach vorn: Wie bleibt der Sozialstaat angesichts der Notwendigkeit einer Transformation reformfähig? Jannis Hergesell und Tim Deeken vom Forschungsnetzwerk Alterssicherung (FNA) haben das Buch gelesen und rezensiert.
weiterlesen
Frank Nullmeier, 19.12.2023
Sozialpolitik für die ökologische Frage
Mit „Soziales Klima. Der Konflikt um die Nachhaltigkeit des Sozialen“ legt Michael Opielka, Leiter des Instituts für Sozialökologie, ein persönliches Buch vor – und ein Plädoyer für einen universalen Sozialstaat, der auch das Ökologische einschließt. Frank Nullmeier hat es gelesen und rezensiert.
weiterlesen

Anne Lenze, 14.12.2023
„Wir müssen das gesellschaftliche Existenzminimum verteidigen“
Die geplante Erhöhung des Bürgergelds für 2024 kommt, darauf haben sich die Spitzen der Koalition geeinigt. Doch der Regelsatz liegt schon heute unter der existenzsichernden Grenze, sagt Prof. Anne Lenze von der Hochschule Darmstadt. Das habe nicht nur für Bürgergeldbezieher*innen Folgen, sondern für alle.
weiterlesen

Katrin Menke, 30.11.2023
Intersektionale Sozialpolitik? Eine überfällige Perspektiverweiterung
Der Sozialstaat fängt soziale Ungleichheiten nicht nur ab, sondern bringt auch selbst welche hervor. Während feministische Perspektiven auf genderbezogene Ungleichheiten längst Teil sozialpolitischer Debatten und Analysen sind, steht ein intersektionaler Blick auf Sozialpolitik in Deutschland noch am Anfang. Ein Plädoyer für mehr Komplexität und Diversität.
weiterlesen
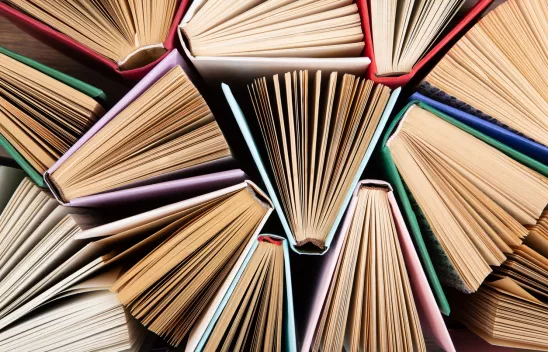
Wolfgang Schroeder, 16.11.2023
Weiter so für die Weiterbildung?
Der Bundestag hat ein Gesetz für die Reform der Weiterbildung beschlossen. Was sich dadurch für Betriebe und Beschäftigte verändert, was Interessenverbände an dem Gesetz kritisieren und ob die Reform Weiterbildung nachhaltig stärkt, diskutiert Prof. Dr. Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel.
weiterlesen

Hannah Zagel, 26.10.2023
(Keine) Kinder kriegen: Wie Staaten Reproduktion regulieren
Familienplanung wird häufig als Privatsache angesehen. Doch Prozesse um das Planen oder Vermeiden, Durchleben oder Beenden von Zeugung und Schwangerschaft werden staatlich gesteuert und sind politisch umkämpft. Dr. Hannah Zagel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung über Reproduktion als Politikfeld und eine neue, internationale Datenbank.
weiterlesen

Ulrike Ehrlich, 12.10.2023
„Die Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger ernst nehmen“
Wer Familienmitglieder oder Freund*innen pflegt, trägt hohe finanzielle und berufliche Kosten, sagt Dr. Ulrike Ehrlich vom Deutschen Zentrum für Altersfragen. Im Interview mit sozialpolitikblog spricht sie über den Vereinbarkeitskonflikt zwischen Erwerbsarbeit und Pflege und welche Maßnahmen Pflegende in Zukunft unterstützen können.
weiterlesen

Almut Peukert, 04.10.2023
Die Kürzung des Elterngelds betrifft wenige und empört viele
Die Streichung des Elterngelds für wohlhabende Eltern hat hohe Wellen in der öffentlichen Debatte geschlagen. Welche zentralen Argumentationslinien die Debatte kennzeichnen, ob sie empirisch stichhaltig sind und warum der Protest gegen die Reform breite Unterstützung bekam, analysiert Prof. Dr. Almut Peukert von der Universität Hamburg.
weiterlesen

Enzo Weber, 07.09.2023
„Die Generation Z revolutioniert die Arbeitswelt nicht“
Faul und fordernd – so wird die junge Generation und ihre Haltung zur Arbeit häufig beschrieben. Diese Zuschreibungen lassen sich nicht wissenschaftlich belegen, sagt Prof. Dr. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Was die Generation Z auf dem Arbeitsmarkt verändert und vor welchen Herausforderungen sie steht, erläutert er im Gespräch mit sozialpolitikblog.
weiterlesen

Traute Meyer, 27.07.2023
Warum Ländervergleiche für Sozialpolitik wichtig sind
Sozialpolitik ist angesichts von Krisenlagen zu schnellen Reaktionen gezwungen. Hilft in solcher Situation der Vergleich mit anderen Ländern? Ja, findet Prof. Traute Meyer von der University of Southampton. Denn davon können sozialpolitische Praktiker*innen und Forschende lernen – auch über ihr Verhältnis zueinander.
weiterlesen

Michaela Evans, Daniela Böhringer, 13.07.2023
Die doppelte Transformation und soziale Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt
Wie wirkt sich das Zusammenspiel von digitaler und ökologischer Transformation auf die soziale Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt aus? Michaela Evans (Mitglied im Rat der Arbeitswelt) und Daniela Böhringer (Geschäftsstelle des Rats der Arbeitswelt) befassen sich mit dieser Frage.
weiterlesen

Dorothea Baltruks, 29.06.2023
Lauterbachs Hitzeschutzplan: Sozialpolitik darf nicht fehlen!
Auf den Plan aus dem Bundesgesundheitsministerium haben manche gewartet wie auf den Regen nach langer Trockenzeit. Ein nationaler Hitzeaktionsplan ist sinnvoll, schreibt Dorothea Baltruks vom Center for Planetary Health Policy (CPHP). Dieser sollte Gesundheitsfachleute, Länder und Kommunen unterstützen sowie Strategien der Prävention und Klimaanpassung sinnvoll ergänzen.
weiterlesen

Hans-Peter Klös, Gerhard Naegele, 11.05.2023
Prioritätensetzung in der Sozialpolitik – eine vernachlässigte Debatte
Die Finanzierung der Sozialpolitik in Deutschland stößt schon jetzt an ihre Grenzen und wird demografisch bedingt noch voraussetzungsvoller. Daher ist eine normativ breit akzeptierte und empirisch gestützte Debatte über Prioritätensetzungen überfällig.
weiterlesen

Hans-Peter Klös, 09.03.2023
Welche Zukunft für die Sozialpolitik der EU?
Die Krisen der heutigen Zeit verlangen Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis. Hans-Peter Klös ist ehemaliger Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft am Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) und widmete sich immer wieder Aufgaben der Wissenschaftskommunikation und Politikberatung. Im sozialpolitikblog-Gespräch äußert er sich zu seiner Arbeit in verschiedenen Gremien und Kommissionen, der Notwendigkeit und den Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation, sowie zu dem Bericht der "High-Level-Group" des Expertengremiums der Europäischen Kommission mit dem Titel "The Future of Social Protection and of the Welfare State in the EU".
weiterlesen
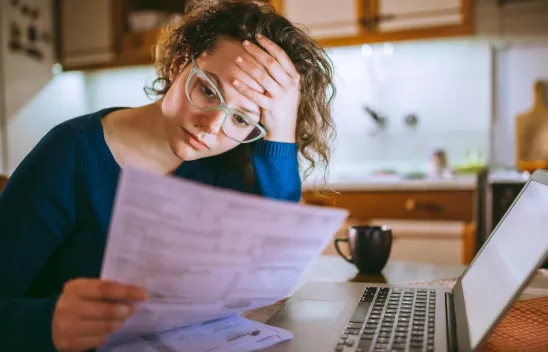
Ralph Henger, 02.02.2023
Mehr Bürokratie durch Kurzbescheide
Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz, welches zum 01.01.2023 eingeführt wurde, bekommen einkommensschwache Haushalte spürbar mehr staatliche Unterstützung. Die jetzige Reform stellt die mit Abstand größte und zugleich am schnellsten umgesetzte Wohngeldreform dar, bedeutet aber auch einen erhebliche Belastungen für die Wohngeldstellen.
weiterlesen

Wilfried Rudloff, 19.01.2023
Historische Forschungen zum deutschen Sozialstaat
Neben zweier Groß- und Langzeitprojekte zur historischen Sozialpolitikforschung in Deutschland sind weitere diesbezügliche Forschungsprojekte von Gewicht ebenfalls abgeschlossen. Der Beitrag bietet eine Zwischenbilanz und einen Ausblick auf mögliche Wege einer künftigen historischen Sozialpolitikforschung. Zusätzlich wird diskutiert, wie sich die historische Sozialstaatsforschung künftig strategisch positionieren sollte.
weiterlesen

Heinz Rothgang, Thomas Kalwitzki, 15.12.2022
Mehr Reformbedarf als zuvor? – Pflegepolitische Zwischenbilanz der Ampel-Koalition
Im November 2021 wurde der Koalitionsvertrag der Ampel veröffentlicht, der Veränderungen in der Pflege ankündigte. Wie es ein Jahr später wirklich aussieht, wird in diesem Beitrag diskutiert.
weiterlesen

Julia Gantenberg, Andreas Klee, Hendrik Schröder, 24.11.2022
100 Jahre Arbeitnehmerkammer Bremen
Arbeitnehmerkammern sind eine sozialpolitische Rarität. Es gibt sie nur in Luxemburg und Österreich sowie in den deutschen Bundesländern Saarland und Bremen. Vor 100 Jahren konnten in Bremen Arbeitnehmerkammern ihre Arbeit aufnehmen.
weiterlesen

Sabrina Schmitt, 03.11.2022
Care-Lagen – ein theoretisches Update für das sozialpolitische Konzept der Lebenslagen
Das Lebenslagenkonzept ist trotz (oder gerade wegen) seines fast 100-jährigen Bestehens nach wie vor ein zentraler Ansatz zur Beschreibung von sozialen Lagen in Deutschland – und nicht nur deshalb ist es Zeit für eine theoretische Weiterentwicklung aus einer Care-Perspektive.
weiterlesen

Julia Bringmann, 28.07.2022
„Atmende Lebensläufe“ – mehr Zeit zum richtigen Zeitpunkt
Weg von der männlich konnotierten Norm des dreigeteilten Lebenslaufs ohne Erwerbsunterbrechungen hin zu einer selbstbestimmten und sozialverträglichen Gestaltung des Berufslebens: es gibt gute Gründe für einen Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik. Was würde es brauchen, zeitlich und finanziell, um das für alle Bürger*innen möglich zu machen?
weiterlesen

Simone Scherger, 02.06.2022
Mind the gap – die geschlechtsbezogene Rentenlücke: Ursachen und politische Maßnahmen
Zwischen den Renten von Frauen und Männern klafft eine deutliche Lücke. Im Jahr 2019 erhielten westdeutsche Frauen über alle Säulen der Altersabsicherung (gesetzlich, betrieblich, privat) hinweg 55 Prozent weniger Renteneinkommen als westdeutsche Männer, in Ostdeutschland betrug diese Lücke nur 23 Prozent.
weiterlesen
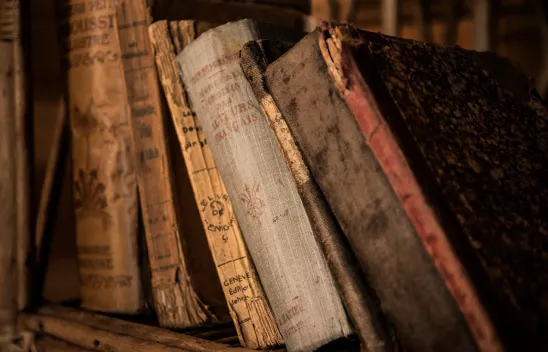
Cornelius Torp, 02.06.2022
Does History Matter? Zur Rolle der Geschichtswissenschaft in der Sozialpolitikforschung
Wenn man als Historiker – üblicherweise als einziger Vertreter seines Faches – als Referent auf sozialpolitischen Fachtagungen auftritt, hat das zuweilen den Charakter einer „Vorgruppe“ bei einem Rockkonzert, die zuständig dafür ist, den Saal auf „Temperatur“ zu bringen. Für die nachfolgenden Redner und Rednerinnen jedenfalls spielt die historische Dimension zumeist keine Rolle, sie richten ihr Augenmerk auf gegenwärtige sozialpolitische Probleme und beziehen sich in ihren Analysen auf möglichst aktuelle empirische Daten.
weiterlesen