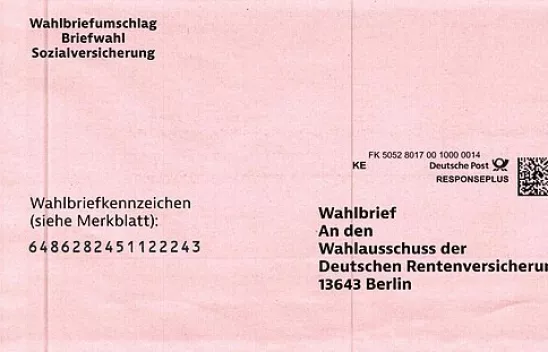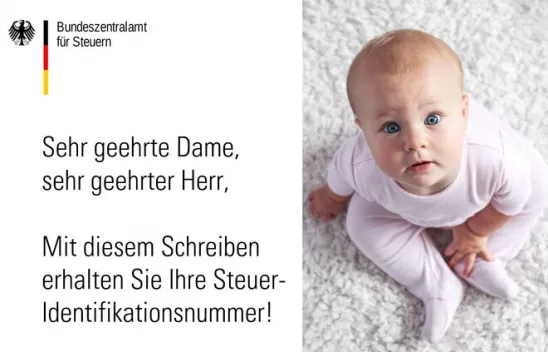SGB XIV – Das neuste Buch im Sozialgesetzbuch
Gewaltopfer sollen besser unterstützt werden. Das verspricht der Gesetzgeber mit den neuen Regelungen zum Sozialen Entschädigungsrecht. Am 1. Januar 2024 soll das SGB XIV in Kraft treten. Ob die Novellierung ihrem Anspruch gerecht wird, diskutiert Horst Bruns von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Der erste Satz der Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts (BT-Drs 19/13824) weckt hohe Erwartungen: „Opfer einer Gewalttat müssen Leistungen schneller und zielgerichteter als bisher erhalten.“ Das Kernstück dieses Artikelgesetzes, das SGB XIV - Soziale Entschädigung, wird nun nach mehreren Jahren der Vorbereitung zum 1. Januar 2024 in Kraft treten.
Die Novelle löst das bisherige Bundesversorgungsgesetz (BVG) von 1950 ab. Das Gesetz, welches auf dem Reichsversorgungsgesetz von 1920 beruhte, richtete sich anfangs an die Beschädigten beider Weltkriege einschließlich ihrer Hinterbliebenen und der zivilen Opfer. Dahinter steht der Aufopferungsanspruch des Staatshaftungsrechts, wonach Menschen Versorgung erhalten, die infolge eines besonderen Opfers einen Gesundheitsschaden erlitten haben (§ 5 SGB I).
Im Laufe der Jahre sind weitere Gesetze hinzugekommen, die auf die Leistungen des BVG verweisen und folgende Personenkreise betreffen: Soldat*innen, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, Gewaltopfer und Menschen, die durch Unrecht in der DDR geschädigt wurden. Einige Gesetze verweisen künftig auf das SGB XIV, die Soldatenentschädigung wird neu geregelt und andere Vorschriften gehen in das SGB XIV ein (Opferentschädigungsgesetz, Zivildienstgeschädigte, Impfgeschädigte).
Das BVG startete ebenfalls mit hehren Zielen. In einer Broschüre von 1952 heißt es: „Es war der Wille der Bundesregierung, zunächst die Kriegsopfer als erste aus dem sozialen Chaos herauszuheben und zu diesem Zweck ein Versorgungsgesetz zu schaffen, das[s] … die soziale Lage der Kriegsopfer entscheidend verbesserte.“ (Bundespresseamt (1952)
Warum bestand Reformbedarf?
Jedoch musste das BVG in den letzten Jahren viel Kritik einstecken: zu langsam, zu kompliziert, nicht mehr zeitgemäß… „Das neue Recht“ hingegen, so weiter die Begründung zum SGB XIV, „soll einen bürgernahen Zugang zu den Leistungen der Sozialen Entschädigung eröffnen und damit auch bekannter werden.“
Es ist bedenklich, wenn von den Gewaltbetroffenen in Deutschland nur ein kleiner Anteil einen Antrag auf Opferentschädigung stellt. Im Jahr 2022 standen 235.820 Gewaltopfern nur 15.021 Anträge gegenüber, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Statistik des Weißen Rings e. V. hervorgeht. Hinzu kommt, dass das BVG mittlerweile ein kompliziertes Regelwerk beinhaltet, das eher auf die Versorgung als auf eine schnelle Wiedereingliederung setzt. Der Plan für ein neues Gesetz lag schon mehrere Jahre in einer Schublade des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Die Erkenntnisse aus dem Runden Tisch Sexueller Kindesmissbrauch und der Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016 öffneten das Gelegenheitsfenster für die Reform.
Was den Bekanntheitsgrad angeht, schaffte es das neue Gesetz bislang nur in die Presse, weil es nicht das 13. Sozialgesetzbuch werden sollte. Es gebe viele Betroffene, die bei der Zahl 13 „ein ungutes Gefühl haben“, begründete Hubertus Heil damals die Entscheidung. Vielleicht weckt die Veranstaltung des BMAS zur Einführung des SGB XIV am 13. (sic!) November in Berlin mehr Aufmerksamkeit.
Was ändert sich durch das neue Sozialgesetzbuch?
Das wichtigste Ziel stellt die Erweiterung des Gewaltbegriffs dar. Bislang löste nur körperliche Gewalt einen Anspruch aus, wodurch unter anderem Opfer von Stalking ausgeschlossen waren. Auf die Grenzen des Tatbestands im Opferentschädigungsgesetz wies das Bundessozialgericht in seiner Rechtsprechung regelmäßig hin. Künftig erhalten Betroffene psychischer Gewalt ebenfalls eine Entschädigung. Jedoch gilt dies erst für Taten ab dem 01.01.2024.
Darüber hinaus werden Kinder, die von ihren Eltern erheblich vernachlässigt wurden, Gewaltopfern gleichgestellt. Doch ist hier noch vieles ungeklärt. Eine Befragung von Jugend- und Versorgungsämtern, die ich vor kurzem durchgeführt habe, zeigt, dass zwar eine hohe Übereinstimmung beim Begriff der Vernachlässigung besteht, doch die Auffassungen, in welchen Fällen diese auch erheblich sei, gehen weit auseinander.
Andererseits wahrt das SGB XIV zum BVG Kontinuität. Noch immer steht der Gesundheitsschaden im Vordergrund. Deshalb müssen die schädigenden Tatbestände im neuen Recht ebenfalls voll bewiesen sein, und die gesundheitlichen Schäden müssen sich kausal hierauf zurückführen lassen.
Gerade diese beiden Prüfschritte führen zu den oft langen Antragsverfahren von über einem Jahr. Aus meiner Erfahrung sind gerade Sexualdelikte in der Sachverhaltsermittlung am aufwändigsten, denn wenn Tatzeugen fehlen, muss die Versorgungsbehörde die Tatvorgänge selbst ermitteln und Befragungen durchführen. Schließlich kommen Betroffene mit psychischen Beeinträchtigungen meist an einer Begutachtung nicht vorbei, weil mögliche Schädigungsfolgen von anderen Erkrankungen abgegrenzt werden müssen. Hier ändert sich durch das neue Sozialgesetzbuch wenig. Immerhin gilt künftig eine Rechtsvermutung für den kausalen Zusammenhang, wenn sich andere Ursachen für die Gesundheitsstörung ausschließen lassen.
Mit den sogenannten Schnellen Hilfen im Kapitel 4 des SGB XIV wird eine Neuerung geschaffen. Diese sind schon vor einer abschließenden Entscheidung über einen Antrag zugänglich. Der Anspruch auf eine Behandlung in einer Traumaambulanz besteht bereits seit 2021 und knüpfte an die bislang freiwillige Leistung in mehreren Bundesländern an. Das Fallmanagement, welches Betroffene im Antragsverfahren begleiten und unterstützen soll, müssen die Träger der Sozialen Entschädigung ab 2024 anbieten. In einigen Bundesländern befindet sich dies noch im Aufbau. Ob die Länder die Möglichkeit der Kooperationsvereinbarungen für externe Beratungs- und Begleitangebote nutzen werden, ist noch ungewiss.
Das Leistungsrecht ist weiterhin davon geprägt, dass grundsätzlich nur für einen schädigungsbedingten Bedarf geleistet wird. Das erfordert für Maßnahmen zur Rehabilitation und Teilhabe (z. B. Psychotherapie) stets die Prüfung, ob diese nicht aus anderen Gründen erforderlich sind. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Leistungen im Auftrag durch die Kranken-, Unfall- und Pflegekassen erbracht werden. Daraus werden sich im Einzelfall Abgrenzungsprobleme ergeben.
Momentan stellt die größte Herausforderung das Wahlrecht für anerkannte Fälle dar. Wer bereits über einen Entschädigungsanspruch verfügt, kann innerhalb einer Jahresfrist entscheiden, ob dieser nach dem alten Recht fortgesetzt oder in das neue Recht überführt werden soll. Hier ist mit einem hohem Beratungsbedarf zu rechnen.
Gab es für den Gesetzgeber Alternativen?
Die Begründung zum SGB XIV verneint das, doch tatsächlich wurde in der Vergangenheit der Vorschlag gemacht, das Soziale Entschädigungsrecht in das Recht der Gesetzlichen Unfallversicherung zu überführen. In der einfachsten Variante hätte man das SGB VII nur um weitere Tatbestände ergänzen müssen, während im Übrigen die umfassenden Leistungen der Unfallversicherungen greifen würden. Andere Staaten wiederum sehen beispielsweise einen Fonds für Betroffene von bestimmten Straftaten vor (Frankreich), gewähren eine Einmalzahlung statt dauerhafter Renten (Österreich) oder setzen die Entschädigung im Rahmen des Strafverfahrens fest (Italien, Spanien).
Vor diesem Hintergrund war es der unausgesprochene gesetzgeberische Wille, weiterhin ein eigenständiges Leistungsrecht vorzusehen, das Menschen, die ein besonderes Opfer tragen, unabhängig von Straf- und Zivilverfahren Unterstützung zu bietet.
Ob das Ziel von schnellen und zielgerichteten Leistungen erreicht wird, kann nur mit Einschränkungen bejaht werden. Die Anerkennungsverfahren werden voraussichtlich genauso lange dauern wie im alten Recht. Und die Zielgenauigkeit hängt von der Qualität des Fallmanagements und der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Sozialleistungsträgern ab. Wenn der strategische Wechsel von der Versorgung zur Teilhabe gelingt, dann kann das SGB XIV ein Erfolg werden.
Literatur
Bundespresseamt (1952): Die Versorgung der Kriegsopfer in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn.
Horst Bruns 2023, SGB XIV – Das neuste Buch im Sozialgesetzbuch, in: sozialpolitikblog, 09.11.2023, https://difis.org/blog/sgb-xiv-das-neuste-buch-im-sozialgesetzbuch-85 Zurück zur Übersicht

Horst Bruns ist Dozent für Sozialrecht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW am Studienort Hagen. Zuvor war er im Sozialen Entschädigungsrecht tätig. An der Universität Göttingen studierte er Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Fragen zu Fallmanagement und Hilfeplanung im Sozialrecht. Aktuell berät und schult er Behörden zum SGB XIV.
Bildnachweis: privat