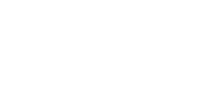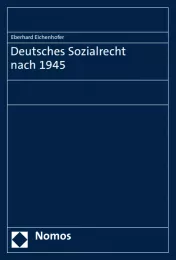Zurück in der Leistungsgesellschaft?
Die Leistungsdebatte ist im öffentlichen Diskurs wieder allgegenwärtig. Doch die Frage, was als Leistung gilt und wie sie gemessen wird, bleibt umstritten – insbesondere, wenn es um existenzsichernde soziale und sozialversicherungs-
rechtliche Ansprüche geht. Eine kritische Neubewertung im öffentlichen Recht ist nötig.
In der Debatte zur Regierungserklärung am 13.11.2024 war viel von Leistung, Leistungsträgern und Leistungsgerechtigkeit die Rede. Doch schon bevor sich der Wahlkampf abzeichnete, beklagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der Wohlfahrtsstaat sei so weit ausgeufert, dass Leistung und Eigenverantwortung keine Rolle mehr spielen würden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht fordert in seinem Programm eine „faire Leistungsgesellschaft“. Auch die Debatte um die Reform der Bundesjugendspiele trägt zum Eindruck einer Wiederkehr der späten 1960er bei.
Zu dieser Zeit war die Debatte vor allem von linken Intellektuellen wie Herbert Marcuse (1958, 1970) und dem Kreis der 68er-Bewegung angestoßen worden. Sie beklagten eine zu starke Ausrichtung auf das Leistungsprinzip unter Vernachlässigung anderer Belange wie Mitbestimmung oder auch Umweltschutz. Zugespitzt handelte es sich um die Kritik eines allein auf Erwerbsarbeit und Konsum ausgerichteten Lebensentwurfs.
Zum Teil gab es dagegen heftige Widerstände, etwa von Helmut Schelsky (1971). Im Archiv der FAZ finden sich von Anfang der 1970er Beiträge mit Titeln wie „Vom Denunzieren einer freien Wirtschaft“ oder „Ist Leistung unanständig?“. Gleichwohl ist auffällig, dass auch die Kritik am Leistungsgedanken durchaus aufgenommen wurde. In der CDU wurde das Konzept einer „humanen Leistungsgesellschaft“ entwickelt, das Rainer Barzel in seiner Rede im Bundestag 1973 aufgriff. Bei derselben Bundestagssitzung sagte auch FDP-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Mischnick, der Umstand, dass Heinrich Böll das Leistungsprinzip als das bezeichnet habe, was ihm am meisten Sorgen bereite, müsse einen zum Nachdenken bewegen.
Unterschiede zwischen damals und heute
Im Gegensatz dazu ist die aktuelle Hinwendung zum Thema der Leistung keine unmittelbare Reaktion auf einen gesellschaftlichen Anstoß, über das Leistungsprinzip nachzudenken. Stattdessen scheint es im Kern darum zu gehen, im Angesicht volkswirtschaftlicher Herausforderungen eine Neiddebatte zu befeuern, in der „die arbeitende Bevölkerung“ gegen andere aufgewiegelt wird. Im Kern wird die neue Debatte doch gegen Bürgergeldempfänger*innen geführt. Hier wurde ein weit verbreiteter Missbrauch und eine zu nachlässige Kontrolle behauptet und stärkere Sanktionen zum Erzwingen von Mitwirkung (Leistung) gefordert. Schlussendlich wurde das Bürgergeld wieder verschärft und damit faktisch die mit seiner Einführung einhergehenden Reformen rückgängig gemacht. Zugleich warf die Debatte über die Verknüpfung mit dem Bürgergeldbezug geflohener Ukrainer*innen und der Arbeitspflicht für Geflüchtete bereits die Schatten der sich gegenwärtig normalisierenden Ausländer*innen- und Migrationsfeindlichkeit voraus.
Leistung als Differenzierungsmerkmal
Leistung ist stets ein problematisches Kriterium, macht Nina Verheyen (2018) in „Die Erfindung der Leistung“ deutlich. Zum einen, weil – wie Claus Offe (1970) gezeigt hat – Leistung unbestimmbar ist: Geht es um den Aufwand? Geht es um die Effizienz? Oder geht es allein um den Ertrag? Und wie messen und vergleichen wir diese Kriterien? Zum anderen, weil ein Blick in die Disability Studies die soziale Konstruktion von Leistung noch einmal unterstreicht. Zudem wird dort klar, dass eine Differenzierung allein oder vor allem anhand von Leistung letztlich dem Grundgedanken der Menschenwürde zuwiderläuft. Leistung oder Nützlichkeit dürfen keine Vorbedingung für Wertschätzung, Anerkennung und Teilhabe sein (Würkert 2024).
Wenn Leistung herangezogen wird, um zu entscheiden, wer zum Beispiel den Studienplatz, die Beamt*innenstelle oder die Beförderung bekommen soll, dann kommen diese Probleme zum Tragen. Dann geht es darum, ob das, was als Leistungsgerechtigkeit bezeichnet wird, tatsächlich so gerecht ist.
Umso schwerer wiegen die Probleme, wenn Leistung als Kriterium herangezogen wird, um über den Ausschluss von existenzsichernden staatlichen Leistungen zu befinden; wenn Leistung über Arbeitspflichten oder Sanktionen staatlich erzwungen werden soll. Deshalb ist eine Sensibilisierung für die Unbestimmtheit des Begriffs und für seine trügerische Objektivität wichtig.
Leistung und öffentliches Recht
Die beschriebenen politischen Positionen und Forderungen erlangen ihre Wirksamkeit, wenn sie es schaffen, in die technische Sprache von Gesetzestexten übersetzt zu werden. Interessanterweise verschwindet dabei häufig der Begriff der Leistung. Der Grundgedanke bleibt jedoch erhalten. Die Entscheidung über Sanktionen erfolgt ebenso aufgrund von Rechtstexten, wie die mögliche Überprüfung dieser Entscheidung vor Gericht. Vor diesem Hintergrund sollte gerade in diesem Kontext mehr Sensibilität für die Tücken des Leistungsbegriffs existieren.
Doch das Gegenteil ist der Fall. Im öffentlichen Recht besteht geradezu ein Glaube an die Objektivität von Leistung. Liest man etwa die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Zeugnisvermerken zur Legasthenie von Absolvent*innen, die Ende 2023 ergangen ist, könnte man meinen, es gebe nichts Objektiveres, als die Differenzierung anhand von Abiturzeugnissen. Dort wird diese Differenzierung letztlich gleichbedeutend mit Gerechtigkeit. Auch wenn dieser Themenkomplex vom hier eigentlich behandelten weiter entfernt ist, verdeutlicht er doch eine Grundhaltung. Diese lässt sich auch dadurch erklären, dass man Ende der 1960er und Anfang der 1970er die Debatte um die Leistungsgesellschaft auch in der Rechtswissenschaft wahrgenommen hatte (Häberle 1972), sie aber letztlich bis heute, mit ganz wenigen Ausnahmen, keinen Eingang in die Disziplin gefunden hat.
Gegenbeispiel: Leistung und sozialversicherungsrechtliche Ansprüche
Dabei kann man im öffentlichen Recht selbst sehen, wie sehr die Frage, was als Leistung verstanden wird, gesellschaftlichem Wandel unterliegt. Ein Beispiel dafür ist der verfassungsrechtliche Schutz sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche. Vor 1980 wurden sozialrechtliche Ansprüche, egal ob Sozialhilfe oder Rente, nicht als Eigentum im Sinne von Art. 14 GG geschützt. Aber 1980 änderte das Bundesverfassungsgericht seine Meinung jedenfalls für versicherungsbasierte Ansprüche. Dabei kam der individuellen Leistung eine wichtige Funktion zu. Sie sollte ein Kriterium sein, um zu erklären, wieso Rentenansprüche geschützt sind, aber etwa Sozialhilfe nicht. Die Unterstellung unter den Schutz des Eigentums bedeutete eine Begrenzung staatlicher Gestaltungsmöglichkeiten. Weil etwa Rentenansprüche auf individueller Leistung beruhen sollen, lastet eine deutlich höhere Rechtfertigungslast auf staatlichen Eingriffen, als etwa bei Sozialhilfe oder BAföG, weil diese demnach nicht auf Leistung beruhen.
1980 ging es darum zu klären, ob der Versorgungsausgleich, also untechnisch gesprochen die Aufteilung von Rentenansprüchen nach der Scheidung, verfassungsgemäß war. Das Gericht bestätigte, dass die Rentenansprüche des Ehemanns als Eigentum geschützt waren, weil sie auf seiner Leistung beruhten. Die Aufteilung im Scheidungsfall sei aber gerechtfertigt. Als einen Grund führte das Gericht schon damals an, dass die Ehefrau im Haushalt und der Kindererziehung gearbeitet habe. Es dauerte bis 2020, bis das Gericht herausstellte, dass auch diese Care-Arbeit eine Leistung darstellt und daher auch der Anspruch auf Versorgungsausgleich als Eigentum geschützt ist.
Fazit: Vorsicht bei der Leistung
Dieses Beispiel zeigt, wie die Frage, was als Leistung anerkannt wird und was „nur“ vermeintlich biologisch determinierte Geschlechterrollenerfüllung ist, dem gesellschaftlichen Wandel unterliegt. Dabei reicht dieser Wandel in das Recht hinein und wird dort mitgeprägt. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich auch im öffentlichen Recht, den Glauben an Leistung als objektives und natürliches Kriterium zu hinterfragen und weiter zu untersuchen. Wieso etwa die Bewältigung der psychischen Folgen von Arbeitslosigkeit und den Herausforderungen des Job-Centers keine Leistung sein sollten, ist genauso wenig offensichtlich wie die Frage, warum sich Leistung primär auf Erwerbsarbeit beziehen sollte. In jedem Fall sollte die Neuauflage der Leistungsdebatte über die Fachdisziplinen hinweg wissenschaftlich kritisch begleitet werden.
Literatur
Marcuse, H.(1957): Eros und Kultur, Stuttgart.
Marcuse, H. (1970): Der Eindimensionale Mensch, Darmstadt.
Schelsky, H. (1975): Die Arbeit tun die anderen, Wiesbaden.
Verheyen, N. (2018): Die Erfindung der Leistung, München.
Offe, C. (1970): Leistungsprinzip und industrielle Arbeit, Hamburg.
Würkert, F. (2024): Zum Begriff der Leistung: Das öffentliche Recht und die Leistungsgesellschaft, in: Bahmer et al. (Hrsg.), Interaktionen: Internationalität, Intra-
und Interdisziplinarität, Baden-Baden, 23-44.
Häberle, P. (1972): Grundrechte im Leistungsstaat, VVDStRL 30 (1972), 43-140.
Felix Würkert 2024, Zurück in der Leistungsgesellschaft?, in: sozialpolitikblog, 21.11.2024, https://difis.org/blog/zurueck-in-der-leistungsgesellschaft-141 Zurück zur Übersicht

Dr. Felix Würkert ist Post-Doc am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europarecht der Universität Hamburg. In seinem Habilitationsprojekt beschäftigt er sich mit dem Leistungsbegriff im öffentlichen Recht. Er wurde an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) mit einer Arbeit zu „Rechtsnormen und Legitimität in der Friedensmediation“ promoviert. Er hat an der Universität in Frankfurt (Oder), der Helmut-Schmidt Universität in Hamburg und als Referent beim Auswärtigen Amt gearbeitet.