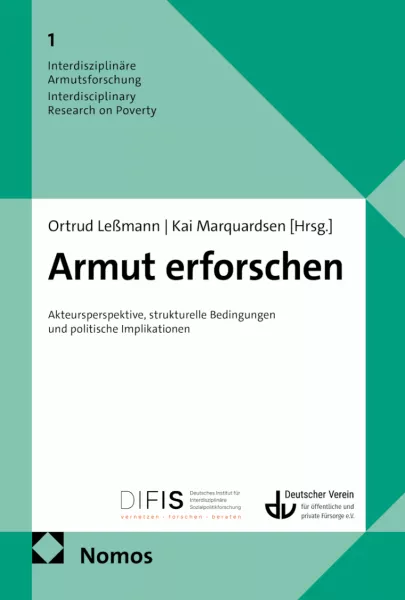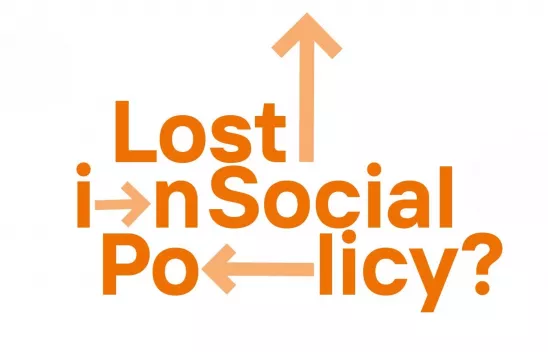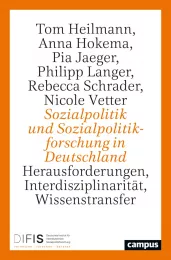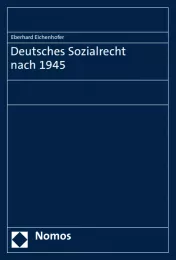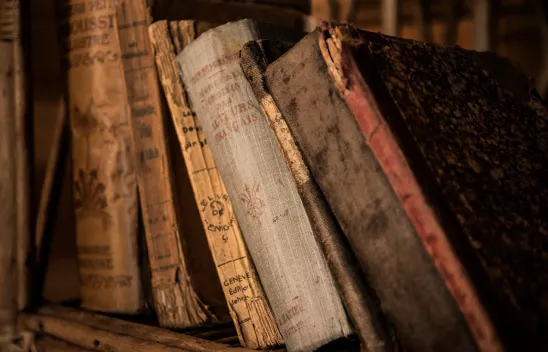Reproduktionspolitiken als neues Feld der Sozialpolitikforschung
Inwiefern ist und sollte der Sozialstaat in Fragen der menschlichen Fortpflanzung involviert sein? Dieser Frage geht der Sammelband „Reproduction Policy in the Twenty-First Century“ nach, der von Hannah Zagel herausgegeben wurde. Zwölf Kapitel liefern Analysen der Reproduktionspolitiken etwa von Deutschland, Polen, den USA, Südkorea oder Uganda – und damit erste Einsichten in ein noch junges, globales Forschungsfeld der Sozialpolitikforschung. Katrin Menke hat den Band gelesen und für sozialpolitikblog rezensiert.
Reproduktionspolitiken, dies vorweggenommen, standen historisch betrachtet immer wieder im Mittelpunkt politischer Machtkämpfe und Auseinandersetzungen um Frauenrechte und Geschlechtergleichstellung, (Ideal-)Vorstellungen von Familie sowie Bevölkerungssteuerung – und tun dies bis heute. Sie waren Bestandteil der rassistischen Eugenik im deutschen Nationalsozialismus, sind Gegenstand des erst im Jahr 2022 eingeführten Abtreibungsgesetzes in Polen (eines der restriktivsten in Europa) und spiegeln sich in gesetzlichen Vorgaben zu staatlicher Kinderwunschförderung (in Deutschland nur von Ehepaaren). Die gesellschaftlichen und zugleich in der Regel moralischen Diskurse um Reproduktionspolitiken zeigen sich jederzeit und allerorts. Der vorliegende Sammelband greift diese Diskurse nicht allein auf, sondern bietet weitergehende Analysen zum Verhältnis von politischen Ideen, Zielen und Instrumenten im Bereich der Reproduktionspolitik in ganz unterschiedlichen Ländern.
Institutionelle Logiken von Reproduktionspolitiken vergleichend analysieren
Den Auftakt des Sammelbandes liefert der Beitrag von Hannah Zagel, der den analytischen Rahmen setzt, hinter dem sich die folgenden Beiträge versammeln. Zagel weist Reproduktionspolitiken als eine Forschungslücke aus, die von der Wohlfahrtsstaatsforschung lange übersehen oder nur als Ergebnis von politischen Überzeugungen betrachtet wurden. Sie schlägt demgegenüber vor, die vielfältigen institutionellen Logiken von Reproduktionspolitiken zu erforschen, die sich nicht nur aus den politischen Ideen und Zielen ableiten lassen, sondern auch durch diverse Instrumente geprägt sind. Während sie bezüglich der Ideen und Ziele zwei zentrale, historisch gewachsene Paradigmen unterscheidet – das Paradigma der Bevölkerungskontrolle und das Paradigma individueller Rechte (S. 8) –, folgt sie hinsichtlich der Instrumente einem klassisch institutionalistischen Ansatz. Hier bezieht sie die Anspruchsberechtigungen und Leistungen, die Leistungsformen (etwa finanzielle Unterstützung und Beratungen) und deren Generosität und Finanzierungsform sowie die Organisation von Reproduktionspolitiken (welche Akteure auf welchem Level) in die Analyse mit ein (S. 6). Die so entstehenden vielfältigen institutionellen Logiken von Reproduktionspolitiken verknüpft Zagel mit der Methode des systematischen Vergleichs: dem Vergleich von Zielen mit Instrumenten, dem Vergleich von Instrumenten über Ländergrenzen hinweg oder von institutionellen Logiken im historischen Verlauf. Derart entfaltet sie eine ganze Bandbreite an möglichen zukünftigen Forschungsthemen des noch jungen Feldes der Sozialpolitikforschung, derer sich die folgenden Beiträge erstmals annehmen.
Wie reguliert der Staat menschliche Fortpflanzung in unterschiedlichen Teilen der Welt?
Im Folgenden bietet der Sammelband Analysen auf unterschiedlichen Ebenen und ist in vier inhaltliche Teile gegliedert: Vergleiche zwischen und innerhalb administrativer Grenzen (Part I), klassische Cross-Country-Vergleiche (Part II), politikenübergreifende Analysen (Part III) sowie Analysen von Policy-Interaktionen (Part IV). Kapitel 12 bietet eine abschließende Diskussion durch die Herausgeberin gemeinsam mit Rene Almeling. Was die Kapitel eint ist der Fokus auf die gegenwärtigen politischen Regulationen menschlicher Fortpflanzung in unterschiedlichen Teilen der Welt. Aus der Perspektive international vergleichender Wohlfahrtsstaatsforschung – mit seinem gewohnten Blick auf europäische Staaten – stechen die vielen Analysen von Ländern aus dem globalen Süden sowie untypisch anmutende Ländervergleiche hervor. So beleuchtet der Beitrag des Autor*innen-Teams um Olena Ivanova die Sexualerziehung im Libanon, Mexico und Uganda und arbeitet die Bedeutung von sozialen und kulturell-religiösen Aspekten für deren Implementierung heraus. Ein intraregionaler Vergleich von Staaten im asiatischen Pazifikraum (Südkorea, Taiwan, Singapur, Hong Kong, Thailand und Vietnam) analysiert die nationalen Familienplanungsprogramme und deren Konstruktionen einer ‚idealen‘ Familiengröße nicht nur mit Blick auf das individuelle (primär weibliche) Wohlbefinden, sondern auch im Hinblick auf eine politisch gewünschte demographische und wirtschaftliche Staatenentwicklung. Herausstechen zudem der historische Blick auf die Entwicklung der widersprüchlichen Politiken im post-sowjetischen Polen von Monika Ewa Kaminska und die darin eingelassene Rolle der katholischen Kirche sowie die Analyse Tania Penovics zum Einfluss der U.S.-amerikanischen Anti-Abtreibungsbewegung auf die Reproduktionspolitiken Australiens. Erhellend ist weiterhin die Analyse von Anna Kluge zur Rolle des Föderalismus in Deutschland für Bestimmungen über Inhalte und Verantwortlichkeiten der schulischen Sexualerziehung (Spoiler: keine gute). Insgesamt machen alle Beiträge deutlich: Die Regulierung von gewünschter gegenüber unerwünschter menschlicher Fortpflanzung sind eingelassen in vielfältige Reproduktionspolitiken weltweit, sind eng verbunden mit idealisierten politischen Vorstellungen von Nation und Nationalstaatlichkeit und finden über die Kontrolle des weiblichen Körpers statt.
Was kann Sozialpolitikforschung davon lernen?
Der Mehrwert des Buches liegt nicht nur darin, ein bisher neues Themenfeld als Teil von Wohlfahrtsstaatlichkeit auszuweisen und dessen vielfältige institutionelle Logiken vergleichend und global nachzuzeichnen. Überzeugend ist auch, dass durch die Fokussierung auf Reproduktionspolitiken bisher untypische Wohlfahrtsarenen in den Blick geraten, etwa spezifische Bereiche der (mit Blick auf Abtreibungen, Schwangerschaft und künstliche Befruchtungen) oder Schulen als Orte der Sexualerziehung. Darüber hinaus verweisen die Beiträge auf die Notwendigkeit, Sozialpolitiken auch als Ergebnis aktivistischer Bewegungen zu verstehen. Diese Perspektive auf Wohlfahrt ‚von unten‘, ausgehend von inter- oder transnationalen sozialen Bewegungen – seien es religiöse Abtreibungsgegner oder Frauenrechtler*innen – ist überzeugend und zugleich inspirierend auch für andere Felder der Sozialpolitikforschung.
Nicht liefern kann das Buch jedoch eine Perspektive auf diejenigen Menschen, die von den jeweiligen Reproduktionspolitiken unmittelbar betroffen sind: die einzelnen Männer und Frauen. Diese Leerstelle sollte zukünftige Forschung unbedingt bearbeiten. Auch die Rolle von transnationaler Mobilität von Eltern oder Migrationsverhältnissen für einzelne Themen, etwa Leihmutterschaft, bleiben noch unterbelichtet. Wenig überraschend bleibt also noch viel zu tun für dieses neu entworfene Feld der Sozialpolitikforschung.
Insgesamt erscheint es mir vielversprechend, dass mit Reproduktionspolitiken ein Thema Eingang in die Sozialpolitikforschung findet, das die Grenzen zwischen ‚Privatheit‘ und ‚Öffentlichkeit‘ verwischt, soziale Bewegungen als politische Akteure ernst nimmt, ungewöhnliche globale und transnationale Perspektiven einübt und auch moralische Fragen nicht scheut.
Katrin Menke 2025, Reproduktionspolitiken als neues Feld der Sozialpolitikforschung, in: sozialpolitikblog, 03.07.2025, https://difis.org/blog/reproduktionspolitiken-als-neues-feld-der-sozialpolitikforschung-169 Zurück zur Übersicht

Dr. Katrin Menke ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Soziologie – Transnationalisierung, Migration und Arbeit an der Ruhr-Universität Bochum. Zuvor war Sie Mitglied in der Forschungsgruppe "Migration und Sozialpolitik" am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, die Teil des Fördernetzwerk Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (FIS) war. Sie forscht, schreibt und lehrt schwerpunktmäßig zu Sozialstaatlichkeit im Wandel im Bereich Arbeit, Migration und Gender, intersektionalen Ungleichheiten sowie qualitativer Sozialforschung.
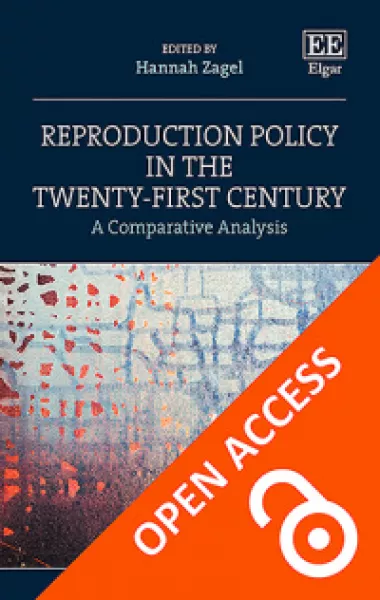
Hannah Zagel (Hrsg.)
Reproduction Policy in the Twenty-First Century
Edward Elgar Publishing
Zum Buch