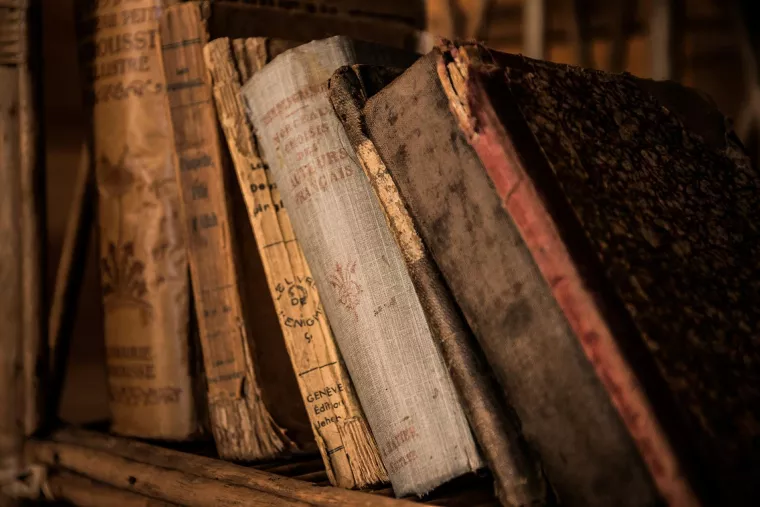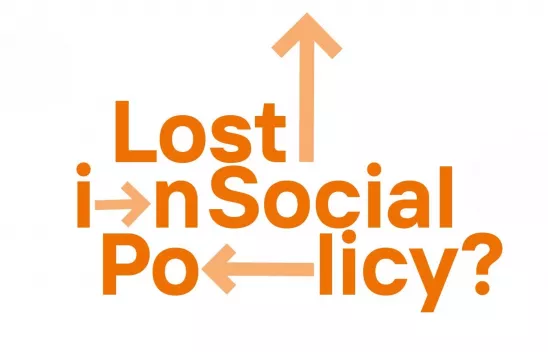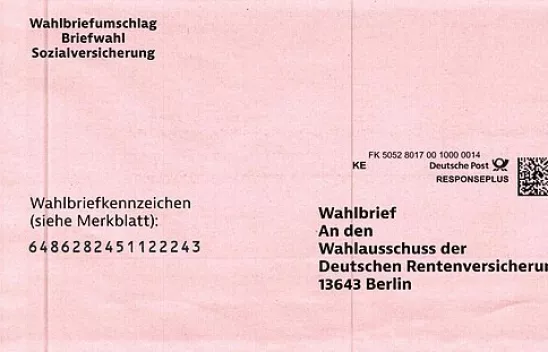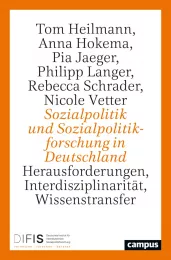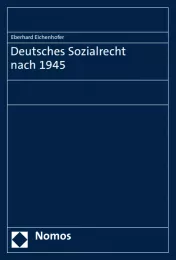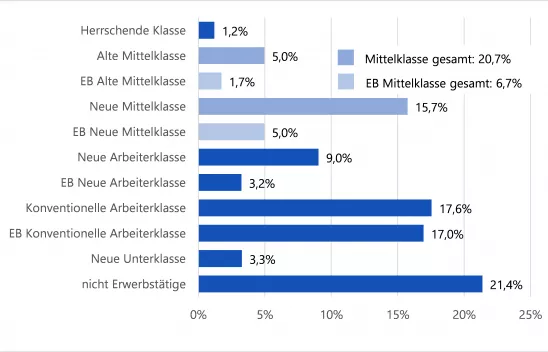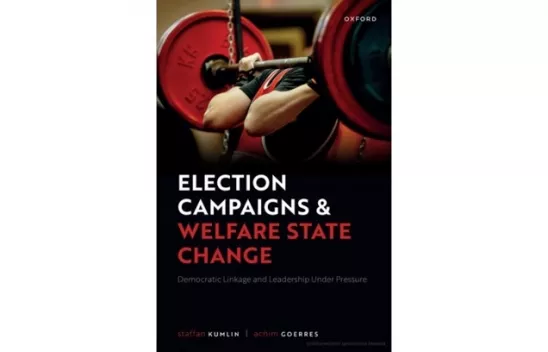Does History Matter? Zur Rolle der Geschichtswissenschaft in der Sozialpolitikforschung
Wenn man als Historiker – üblicherweise als einziger Vertreter seines Faches – als Referent auf sozialpolitischen Fachtagungen auftritt, hat das zuweilen den Charakter einer „Vorgruppe“ bei einem Rockkonzert, die zuständig dafür ist, den Saal auf „Temperatur“ zu bringen. Für die nachfolgenden Redner und Rednerinnen jedenfalls spielt die historische Dimension zumeist keine Rolle, sie richten ihr Augenmerk auf gegenwärtige sozialpolitische Probleme und beziehen sich in ihren Analysen auf möglichst aktuelle empirische Daten.
Hat die geschichtswissenschaftliche Perspektive – das ist die Frage, die sich angesichts dessen stellt – mehr beizutragen als den historischen „Vorspann“ für die eigentlich im Zentrum der Debatte stehende Auseinandersetzung mit den drängenden sozialpolitischen Themen der Gegenwart? Ist sie mehr als ein „Nice to have“ der Wohlfahrtsstaatsforschung, ein schmückendes Beiwerk, auf das man im Zweifel auch verzichten kann? Bevor ich versuche, hierauf eine vorsichtig positive Antwort zu geben, möchte ich kurz auf die bisherigen Leistungen der historischen Sozialpolitikforschung und auch ihre aktuelle Lage eingehen, um eine Vorstellung davon zu vermitteln, was realistischerweise von ihr zu erwarten ist. Dabei soll der deutsche Forschungskontext im Vordergrund stehen.
Die geschichtswissenschaftliche Forschung zur Entwicklung der Sozialpolitik besitzt in Deutschland eine lange und reiche Tradition, welche die finanzielle und gesellschaftliche Bedeutung des deutschen Sozialstaats und seine internationale Pionierrolle im ausgehenden 19. Jahrhundert widerspiegelt. Während anfangs Formen der vorstaatlichen Sozialpolitik und die Gründungsphase des deutschen Sozialstaats im Zentrum der historischen Forschung standen, richtete sich das Augenmerk später auf seine Indienstnahme durch den Nationalsozialismus und die frühen Weichenstellungen in der Bundesrepublik, bis schließlich in den letzten Jahren verstärkt die wohlfahrtsstaatlichen Umbauprozesse seit den 1970er Jahren in den Blick gerieten (souveräner Forschungsüberblick: Süß 2017). Auch die verschiedenen Bereiche des deutschen Wohlfahrtsstaats können in ihrer historischen Dimension als insgesamt gut ausgeleuchtet gelten: von der Armutspolitik (Sachße/Tennstedt 1998 ff.; Raphael 2016) über die Geschichte der Sozialversicherung (Ritter 1983) mit ihren verschiedenen Zweigen (Hockerts 1980; Torp 2015) bis hin zur Familienpolitik (Kuller 2004) und zum Zusammenhang von Sozialpolitik und Arbeitsbeziehungen (Raphael 2019). Aus dem Meer an Publikationen der deutschen historischen Sozialpolitikforschung, die insgesamt einen politik- und institutionengeschichtlichen Fokus privilegiert und die Frage der sozialen Auswirkungen wohlfahrtsstaatlicher Eingriffe dagegen eher abgeschattet hat, ragen zwei monumentale Massive hervor: die in einem über Jahrzehnte andauernden Editionsvorhaben erarbeitete, inzwischen abgeschlossene und nun auch digital verfügbare „Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914“ und die 2008 zum Abschluss gelangte Gesamtdarstellung der „Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945“ in elf Bänden, die sich auf beide deutsche Staaten erstreckt und so etwas wie eine Leistungsschau der deutschen geschichtswissenschaftlichen Sozialstaatsforschung um die Jahrtausendwende darstellt.
Leider ist die Fortführung dieser wichtigen geschichtswissenschaftlichen Traditionslinie durch die Entwicklungen der letzten Jahre äußerst bedroht. Das liegt in erster Linie daran, dass die historische Sozialpolitikforschung weder in außeruniversitären Forschungsinstituten noch in Gestalt eigens auf sie zugeschnittener Universitätsprofessuren institutionell verankert ist. Ihr Rückgrat bildete bislang das Forschungsinteresse einzelner Wissenschaftler (tatsächlich handelte es sich ganz überwiegend um Männer), die im Rahmen ihrer allgemein denominierten Epochenprofessuren ihren Schwerpunkt bei der Geschichte des Sozialstaats setzten. Das hatte zur Folge, dass sich der Generationswechsel auf den Neuzeitlehrstühlen der letzten Jahrzehnte, der sich mit einer stärkeren Hinwendung des Faches zur Kulturgeschichte verband, in einer deutlichen Reduzierung von einschlägig besetzen Stellen niederschlug. An immer weniger Orten wurde nun zur Geschichte des Wohlfahrtsstaats geforscht; gleichzeitig verkümmerten die interdisziplinären Brücken vor allem zur Sozial- und Politikwissenschaft. Hinzu kommt, dass Großprojekte wie die erwähnte „Quellensammlung“ oder die „Geschichte der Sozialpolitik“, die sozialpolitisch interessierten Fachhistorikern und -historikerinnen eine Perspektive bieten könnten, nicht in Sicht sind. Zwar ist es ein Lichtblick, dass politik- und sozialwissenschaftliche Wohlfahrtsstaatsforscher und -forscherinnen sich immer wieder historischen Problemen widmen (Obinger u.a. 2021; Schmitt 2020). Doch vermag das am Bild der prekären Verankerung der Sozialpolitikforschung im Herzen der historischen Fachdisziplin und des damit einhergehenden Mangels an einschlägig qualifiziertem Nachwuchs wenig zu ändern.
Eine solche institutionell verfestige Etablierung einer geschichtswissenschaftlichen Sozialpolitikforschung aber wäre dringend zu wünschen, da die historische Perspektive auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Wohlfahrtsstaat leisten kann. Ich möchte insbesondere fünf Punkte hervorheben:
- Häufig lassen sich gegenwärtige sozialpolitische Problemkonstellationen tatsächlich in ihrer ganzen Komplexität nur im historischen Zugriff erklären. Ein adäquates Verständnis des deutschen Sozialstaats mit seinen zuweilen eigenartigen Verteilungswirkungen, seinen Brüchen und Reformblockaden kann nur auf der Grundlage der Rekonstruktion seiner Genese gelingen. Wie etwa ließen sich die bis heute andauernden Probleme, der deutschen Alterssicherung ein wirksames Instrument der Armutsprävention zu implementieren, anders verstehen als durch den Rekurs auf die Erfolgsgeschichte des 1957 eingeführten Rentensystems und die damit zusammenhängende Dominanz von Gerechtigkeitsvorstellungen, die am Leistungsprinzip orientiert sind und die jedem Eindringen von Fürsorgeelementen im Wege stehen (Torp 2019)?
- Die Auseinandersetzung mit Entwicklungen im Verlauf der Zeit und die Frage nach Kontinuität und Wandel bilden den Kern historischen Arbeitens. Daher hat die Geschichtswissenschaft eine Menge zu jenem Forschungsprogramm beizutragen, dass Paul Pierson den Sozial- und Politikwissenschaften seit den 1990er Jahren immer wieder unter dem Banner „History Matters“ ins Stammbuch geschrieben hat (Pierson 2004): zur Erforschung von Pfadabhängigkeiten und positiven Feedback-Schleifen, der Bedeutung von Timing und Sequence und zur Analyse von sich über lange Dauer entfaltenden Prozessen. Nur so gerät auch in den Blick, in welchem Ausmaß die Expansion des Wohlfahrtsstaats nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundbedingungen politischen Handelns verändert hat, da seither jeder Versuch seines Um- oder Rückbaus auf Widerstände trifft, die er selbst erst hervorgebracht hat – in Form von Eigentumsrechten und Anwartschaften, von Interessengruppen, Akteurskonstellationen und Erwartungshaltungen.
- Die für historische Studien typische Konzentration auf einen einzigen Fall oder ganz wenige Fälle, die dann in ihrer ganzen Komplexität ausgeleuchtet werden, erlaubt Einblicke in kausale Wirkungsmechanismen, die in der quantitativ angelegten und mit großen Ländersamples operierenden Sozialpolitikforschung zumeist ausgeblendet sind. Die Einsichten in die kausale Verkettung der verschiedenen intervenierenden Variablen, die nur im Rahmen derartiger qualitativer Tiefenbohrungen zu gewinnen sind, können als wichtiges Korrektiv gegenüber den im Rahmen allgemeiner Modelle oder Gesetzmäßigkeiten unterstellten Wirkungsannahmen fungieren. Gleichzeitig können sie – gewissermaßen bottom up – als Grundlage für die Identifizierung von kausalen Mechanismen dienen, die in der Sozialpolitik raum- und zeitübergreifend immer wieder wirksam werden (Nullmeier 2021) – jedenfalls dann, wenn Historiker und Historikerinnen nicht der im Fach leider ausgeprägten historistischen Tendenz nachgeben, den eigenen Gegenstand als vollständig einzigartig zu begreifen.
- Geschichtswissenschaftliche Forschung kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, sozialwissenschaftliche Daten in ihren Entstehungskontext einzuordnen und sie auf diese Weise zu historisieren. Unterbleibt die Einbettung des historischen Datenmaterials in den wissenschaftlichen und sozialpolitischen Zusammenhang ihrer Genese und wird es stattdessen als „wahre“ Abbildung der historischen Realität begriffen, besteht die Gefahr, dass sein Aussagegehalt fehlerhaft eingeschätzt wird. So konnten Wirtschaftshistoriker beispielsweise überzeugend herausarbeiten, dass die berühmte dritte York-Studie des englischen Armutsforschers Seebohm Rowntree kurz nach dem Zweiten Weltkrieg den Rückgang der Armut gegenüber der Zwischenkriegszeit und damit auch die Erfolgsbilanz des gerade neu ins Leben getretenen britischen Wohlfahrtsstaats aufgrund des Zusammenspiels einer Reihe von methodischen Fehlern quantitativ deutlich überzeichnete (Hatton/Bailey 2000).
- Schließlich kann die Sozialpolitikforschung davon profitieren, dass die Geschichtswissenschaft in den letzten beiden Jahrzehnten eine weitreichende Öffnung hin zur Globalgeschichte und zu transnationalen Ansätzen vollzogen hat. In der Wohlfahrtsstaatsforschung – gleich, ob sie auf ein Land fokussiert oder vergleichend vorgeht – gilt der Nationalstaat bis heute zumeist als die selbstverständliche Analyseeinheit; dem korrespondiert ein endogenes Entwicklungsmodell, das Kontinuität und Wandel auf Faktoren und Konfliktlagen im Innern der nationalen Gesellschaften zurückführt. Die florierende Globalgeschichte dagegen lenkt den Blick auf transnationale Verflechtungen und Wechselwirkungen, auf grenzüberschreitende Transfers von Menschen und Ideen, die auch in der Entwicklung der modernen Sozialstaaten eine entscheidende Rolle gespielt, bislang aber viel zu wenig Berücksichtigung gefunden haben.
Angesichts dieses vielfältigen Potentials einer historischen Sozialpolitikforschung gibt es m.E. gute Argumente dafür, sie institutionell zu stärken und mehr als bisher in die allgemeine Forschung zum Wohlfahrtsstaat zu integrieren. Was spricht überhaupt dagegen, der historischen „Vor-Band“ einmal eine Chance zu geben und sie gleichberechtigt im multidisziplinären Konzert der Wohlfahrtsstaatsforschung mitspielen zu lassen? Vielleicht würde ja der Klang insgesamt profitieren.
Literatur
Hatton, Timothy J./Bailey, Roy E. (2000): Seebohm Rowntree and the Postwar Poverty Puzzle, in: Economic History Review 52, S. 517-543.
Hockerts, Hans Günter (1980): Sozialpolitische Entscheidungen im Nachkriegsdeutschland. Alliierte und deutsche Sozialversicherungspolitik 1945-1957, Stuttgart: Klett-Cotta.
Kuller, Christiane (2004): Familienpolitik im föderativen Sozialstaat. Die Formierung eines Politikfeldes in der Bundesrepublik 1949-1975, München: Oldenbourg.
Nullmeier, Frank (2021): Kausale Mechanismen und Process Tracing: Perspektiven der interpretativen Politikforschung, Frankfurt: Campus.
Obinger, Herbert, u.a. (2021): Der deutsche Arbeiter wird in 10 Jahren besser aussehen als heute ein englischer Lord. Deutsche und britische Sozialstaatspropaganda in beiden Weltkriegen, in: Leviathan – Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft 49, S. 386-425.
Pierson, Paul (2004): Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton: Princeton University Press.
Raphael, Lutz (2019): Jenseits von Kohle und Stahl. Eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom, Berlin: Suhrkamp.
Raphael, Lutz (Hg.) (2016): Poverty and Welfare in Modern German History, New York: Berghahn.
Ritter, Gerhard A. (1983): Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich, München: C. H. Beck.
Sachße, Christoph/Tennstedt, Florian (1998 ff.): Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, 4 Bde., Stuttgart: Kohlhammer.
Schmitt, Carina (2020): The Warfare-Welfare Nexus in French African Colonies in the Course of the First and Second World War, in: Historical Social Research 45, S. 217-238.
Süß, Winfried (2017): Die Geschichte der Sozialpolitik als Teil der Neueren und Neuesten Geschichte / Zeitgeschichte, in: Deutsche Rentenversicherung 2/2017, S. 224-236.
Torp, Cornelius (2015): Gerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat: Alter und Alterssicherung in Deutschland und Großbritannien von 1945 bis heute, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Torp, Cornelius (2019): Mindestsicherungselemente in der deutschen Alterssicherung von Bismarck bis Merkel, in: Deutsche Rentenversicherung 2/2019, S. 132-149.
Cornelius Torp 2022, Does History Matter? Zur Rolle der Geschichtswissenschaft in der Sozialpolitikforschung, in: sozialpolitikblog, 02.06.2022, https://difis.org/blog/does-history-matter-zur-rolle-der-geschichtswissenschaft-in-der-sozialpolitikforschung-4 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Cornelius Torp ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Bremen und gehört zu den Gründungsmitgliedern von DIFIS. Zurzeit leitet er im SFB 1342 „Globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik“ zusammen mit Delia González de Reufels ein Teilprojekt zum Thema „Protektionismus und Sozialpolitik in den Amerikas, 1890-2020“.