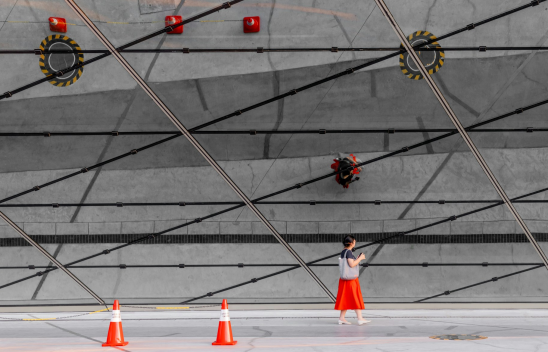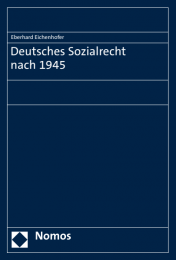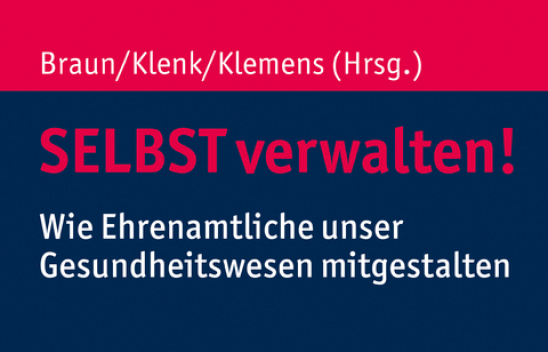Mythen in der Pflegeversicherung
In der aktuellen Legislaturperiode steht eine große Pflegereform an, die sich insbesondere mit den Finanzierungsproblemen befassen soll. Für die Erarbeitung von Reformvorschlägen bedarf es eines klaren Blicks, der nicht durch Mythen der Pflegeversicherung beeinträchtigt sein sollte, argumentiert Heinz Rothgang.
Nachdem die Langzeitpflege in der vergangenen Legislaturperiode keine große Rolle gespielt hat, hat die neue Bundesregierung im aktuellen Koalitionsvertrag eine „große Pflegereform“ angekündigt, deren Grundlagen eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf Ministerebene unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände erarbeiten soll. Was aber genau macht eine „große Pflegereform“ aus? Im Arbeitsauftrag für die Arbeitsgruppe sind sowohl Fragen der Leistungserbringung als auch der Finanzierung angesprochen. Bezüglich der Finanzierung kann dabei auf die Vorarbeiten der letzten Regierung zurückgegriffen werden, die in ihrem Bericht „Zukunftssichere Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung“ Szenarien und Stellschrauben möglicher Reformen dargestellt hat – allerdings ohne daraus einen eigenen Reformvorschlag abzuleiten. Die zentralen Probleme auf der Finanzierungsseite sind zum einen die hohen und steigenden Eigenanteile der Pflegebedürftigen in der Heimpflege und zum anderen der steigende Beitragssatz zur Pflegeversicherung. Bezüglich beider Aspekte ist die Diskussion von Mythen überlagert, die eine Beurteilung der aktuellen Situation und der Reformoptionen erschweren und daher eine nähere Betrachtung verdienen.
Mythos 1: Die Pflegeversicherung ist durch eine unvorhergesehene Ausgabenexplosion gekennzeichnet, die zu einer Kosten- und Beitragssatzexplosion führt
So gab sich der damalige Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach, im Frühjahr 2024 davon überrascht, dass „die Zahl der Pflegebedürftigen geradezu explosionsartig gestiegen“ sei, und vielfach werden Maßnahmen „gegen die Kosten-Explosion in der Pflegeversicherung“ vorgeschlagen. Dass sich die Pflegeversicherung mit „übermäßigen Kosten konfrontiert“ sieht und die „Ursachen für diese Kostenexplosion“ zu identifizieren sind, ist quasi Allgemeingut. Tatsächlich ist der Beitragssatz zur Pflegeversicherung insbesondere in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen (Abbildung 1).

Quelle: Sozialpolitik aktuell
Allerdings war ein steigender Beitragssatz bereits bei Einführung der Pflegeversicherung erwartet worden (PflegeVG-Entwurf, S. 178), und frühe Vorausberechnungen haben bei kaufkraftstabilisierender Leistungsdynamisierung für 2016 bereits einen Beitragssatz von 2,2 Prozentpunkten ermittelt (Rothgang 1997: 286) – ein Wert, der recht nahe an der tatsächlichen Entwicklung liegt und zeigt, dass die Beitragssatzentwicklung der Pflegeversicherung in ihren ersten zwanzig Jahren nicht überraschend war. Der Beitragssatzanstieg ab 2017 ist dagegen höher als ursprünglich erwartet, aber weitgehend auf zwei politische Faktoren zurückzuführen: die Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, die zu einer erheblichen Leistungsausweitung geführt hat, und steigende Pflegelöhne. Die durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ausgelöste Leistungsausweitung kann aber nicht als unerwartete „Kostenexplosion“ angesehen werden, sie ist vielmehr Folge einer bewussten politischen Entscheidung. Leistungen bei Pflegebedürftigkeit sollten auch in größerem Maß Menschen mit kognitiven Einschränkungen gewährt werden. Des Weiteren sollte das Leitbild der Langzeitpflege weg von einer „Satt-und-Sauber-Pflege“ hin auf die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe auch bei Pflegebedürftigkeit gelenkt werden – wie dies auch die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, die Deutschland 2009 ratifiziert hat. Auch die überproportionale Steigerung der Pflegelöhne (s. Rothgang & Müller 2024: S. 22ff.) war politisch intendiert, um die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen. Sie wurde zudem durch die 2022 in Kraft getretene „Tariftreueregelung“ (§ 72 Abs. 3a-3e SGB XI) gezielt befördert. Auch hier sind Ausgabensteigerungen damit Folge politischer Maßnahmen, die auf genau diese Entwicklung abzielen. Zudem ist der Beitragssatzanstieg nicht nur auf die Kostenentwicklung zurückzuführen, sondern auch auf die „strukturelle Einnahmeschwäche“ (s. Rothgang & Götze 2013) der Pflegeversicherung. Während das Bruttoinlandsprodukt von 2000 bis 2016 nominal um 50% und von 2000 bis 2024 um insgesamt 102% gestiegen ist, nahm die Beitragsbemessungsgrundlage zur sozialen Pflegeversicherung im gleichen Zeitraum nur um 34% bzw. 67% zu[1], also nur um zwei Drittel des Wachstums der ökonomischen Leistungsfähigkeit. Wäre die Bemessungsgrundlage dagegen im Gleichschritt mit dem BIP gestiegen, hätte der Beitragssatz für Kinderlose 2016 bei 2,1 und 2023 bei 2,8 Beitragssatzpunkten gelegen. Die Beitragssatzentwicklung ist damit zum einen auf bewusst herbeigeführte Leistungsverbesserungen und Lohnsteigerungen und zum anderen auf eine unzureichende Finanzierungsmechanik zurückzuführen – nicht aber auf eine unvorhergesehene „Kostenexplosion“.
Mythos 2: Hohe Eigenanteile sind kein Problem, da die Pflegeversicherung immer schon eine Teilkaskoversicherung war und kein Erbenschutzprogramm
Die Eigenanteile in der Heimpflege sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Abzüglich der von der Pflegeversicherung gewährten Leistungszuschläge zu den Eigenanteilen nach § 43c SGB XI liegen sie inzwischen bei Einzug in ein Pflegeheim bei monatlich mehr als 3.100 Euro pro Monat (Abbildung 2) und damit rund doppelt so hoch wie die Standardnettorente für eine versicherte Person mit Durchschnittsverdienst und 45 Versicherungsjahren. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Leistungsanpassungen werden diese monatlichen Eigenanteile bis 2029 auf mehr als 4.000 Euro steigen. Da die Leistungszuschläge zu den pflegebedingten Eigenanteilen gemäß § 43c SGB XI mit der Dauer des Heimaufenthaltes steigen, reduziert sich der Eigenanteil im Zeitverlauf. Im gewogenen Mittel beläuft sich der durchschnittliche Eigenanteil aber immer noch auf mehr als 2.500 Euro im Jahr 2025 bzw. mehr als 3.200 Euro im Jahr 2029.

Diese Entwicklung sei aber nicht so tragisch, da die Pflegeversicherung „kein Erbenschutzprogramm“ sei, so z.B. Karl Lauterbach in einem Interview am 2. Januar dieses Jahres oder die Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskopf-Deffaa 2023, sondern vielmehr von Anfang an als „Teilkaskoversicherung“ gedacht gewesen sei. Diese Äußerungen und die darin zum Ausdruck kommenden Einschätzungen sind aber versicherungstechnisch unzutreffend, in Bezug auf das zugrunde gelegte Altersbild hochproblematisch und historisch schlicht falsch.
Die Kaskoversicherung ist eine Versicherung gegen Schäden am Kraftfahrzeug, Flugzeug, Schiff oder Fahrrad. Dabei kann eine Selbstbeteiligung vereinbart werden – muss aber nicht. Genau um diese Selbstbeteiligung geht es, wenn der Begriff auf die Pflegeversicherung angewendet wird. Allerdings ist die Selbstbeteiligung in der Teilkaskoversicherung so ausgestaltet, dass Versicherte Schäden bis zum vereinbarten Betrag selbst zahlen, die darüberhinausgehenden Schäden dann aber von der Versicherung übernommen werden. Bei der Pflegeversicherung verhält es sich dagegen genau umgekehrt: Die Versicherung übernimmt Kosten in Höhe eines gesetzlich vorgesehenen Leistungsbetrags – alle darüber hinaus gehenden Kosten trägt die versicherte Person, bei der damit auch alle Risiken für höhere oder länger anhaltenden Kosten verbleiben. Erst im Reformmodell des Sockel-Spitze-Tausches würde der Teilkasko-Gedanke aufgegriffen. Die Anwendung des Begriffs der Teilkaskoversicherung auf die Pflegeversicherung in ihrer derzeitigen Ausgestaltung ist damit falsch. Das Bundesgesundheitsministerium spricht daher auch nur von einem „Teilleistungssystem“.
Problematisch ist die Diskreditierung der Pflegeversicherung als Erbenschutzprogramm. Pflegebedürftige werden dabei zu bloßen „Erblassern“. Die in Pflegeheimen verbrachten Jahre sind aber in der Regel die letzten Jahre des Lebens und alles, was den Betroffenen noch bleibt. Es ihnen zu ermöglichen, diese Jahre in Würde zu verbringen, muss daher Ziel der Alterspolitik sein. Dazu gehört, dass sie nicht ihr gesamtes Einkommen und Vermögen für die Pflege aufbringen müssen und damit ihrer Lebensleistung und der Freiheit beraubt werden, mit ihrem Vermögen noch die Dinge zu tun, die ihnen wichtig sind – und seien es auch z.B. Geschenke an Enkelkinder. Zudem werden bei dieser Betrachtung die Grundlagen des „konservativen Wohlfahrtsstaates“ in Deutschland verkannt. Während liberale Wohlfahrtsstaaten lediglich der Existenzsicherung verpflichtet sind und sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten Sozialleistungen als Bürgerrecht ausgestalten, wird der Anspruch auf Sozialleistungen jenseits einer Grundsicherung im konservativen Wohlfahrtsstaat durch Vorleistungen, insbesondere durch Mitgliedschaft in einer Sozialversicherung, erworben. Deren Leistungen gehen im Gegenzug aber über eine existenzsichernde Mindestsicherung hinaus und sollen den erreichten Lebensstandard gegen die Wechselfälle des Lebens sichern. Dadurch werden positive Arbeitsanreize gesetzt, und es wird soziale Sicherheit für risikoaverse Individuen geschaffen. Das Leitbild der Lebensstandardsicherung impliziert, dass niemand bei Krankheit aufgefordert wird, die Krankenhauskosten aus dem eigenen Vermögen zu zahlen – das ist selbstverständliche Aufgabe der Krankenversicherung. Entsprechendes sollte auch für die Pflegeversicherung gelten.
Genau dies war auch das Leitbild der Pflegeversicherung bei ihrer Einführung. In der Gesetzesbegründung zum Entwurf des Pflege-Versicherungsgesetzes heißt es dazu auf Seite 2: „wer sein Leben lang gearbeitet und eine durchschnittliche Rente erworben hat, soll wegen der Kosten der Pflegebedürftigkeit nicht zum Sozialamt gehen müssen“. Dazu sollen die Pflegebedürftigen zwar die Kosten der Unterkunft und Verpflegung – anders als im Krankenhaus – selbst tragen, die Pflegeversicherung aber die durchschnittlichen Pflegevergütungen im Pflegeheim vollständig abdecken. In den Worten des Ersten Berichts der Bundesregierung über die Entwicklung der Pflegeversicherung seit ihrer Einführung: „Die Pflegeversicherung … soll eine Grundversorgung sicherstellen, die im Regelfall ausreicht, die pflegebedingten Aufwendungen abzudecken.“ Entsprechend waren die Leistungen bei vollstationärer Pflege ursprünglich auch nicht als Pauschalen ausgestaltet, sondern als „bis zu …“-Leistungsbeträge, weil die in Rechnung gestellten Pflegesätze weit überwiegend unterhalb der maximalen Leistungsbeträge lagen. Dass hohe Eigenanteile bei den pflegebedingten Kosten im Pflegeheim im Sinne eines Teilleistungssystems in der Pflege „von Anfang an“ so vorgesehen waren, ist daher nichts als ein Mythos.
-----
[1] Die Beitragsbemessungsgrundlage wurde dabei durch Division der Beitragseinnahmen durch den jeweiligen Beitragssatz ermittelt. Die jeweiligen Werte entstammen diversen Jahrgängen des BARMER Pflegereports.
Literatur
Rothgang, Heinz (1997): Ziele und Wirkungen der Pflegeversicherung. Eine ökonomische Analyse. Schriften des Zentrums für Sozialpolitik, Band 7. Frankfurt: Campus.
Rothgang, Heinz / Götze, Ralf (2013): Perspektiven der solidarischen Finanzierung, in: Jacobs, Klaus / Schulze, Sabine (Hg.): Die Krankenversicherung der Zukunft – Anforderungen an ein leistungsfähiges System. Berlin: KomPart-Verlag: 127-175
Heinz Rothgang 2025, Mythen in der Pflegeversicherung, in: sozialpolitikblog, 22.05.2025, https://difis.org/blog/?blog=165 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Heinz Rothgang leitet im SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik die Abteilung Gesundheit, Pflege und Alterssicherung. Er ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen und forscht zur Pflegeversicherung in Deutschland und im internationalen Vergleich. Er hat als Mitglied in zahlreichen Expert*innengremien aktiv in der Beratung der Pflegepolitik mitgewirkt und ist Gründungsmitglied des DIFIS.
Bildnachweis: David Ausserhofer

In der Debatte um Sozialpolitik werden oft Behauptungen aufgestellt und Sachverhalte zugespitzt, die sich als verkürzt oder falsch erweisen. Die Blogreihe des WSI-Blog Work on Progress untersucht Argumentationen und Politikvorschläge und nimmt eine evidenzbasierte Einordnung vor. Dieser Beitrag ist Teil einer Kooperation mit dem WSI-Blog Work on Progress, in der wir Beiträge zu Mythen der Sozialpolitik austauschen und gemeinsam veröffentlichen.
weiterlesen