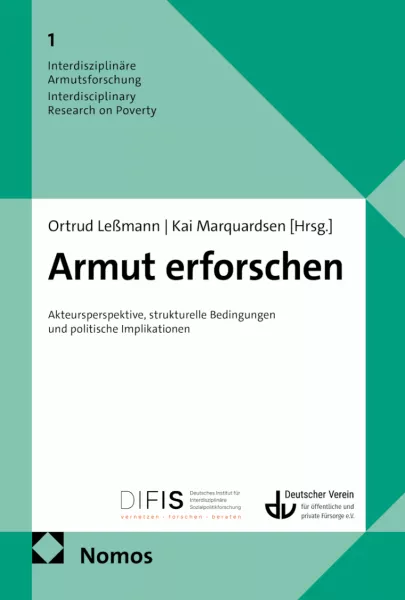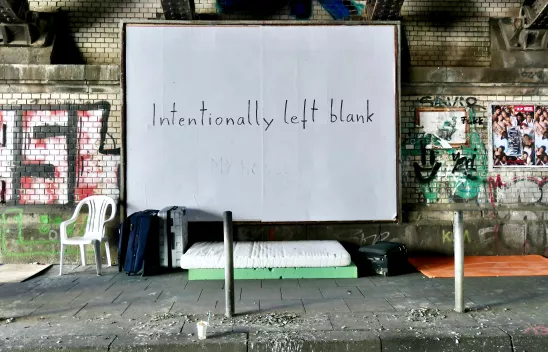"Von Armut zu sprechen ist nicht neutral"
Im DIFIS Issue Network Armutsforschung entstand ein Sammelband, der Armut in unterschiedlichen Facetten beleuchtet – von der Lebensrealität Betroffener bis zu ihren strukturellen Ursachen. Im Mittelpunkt steht die Akteursperspektive, die Menschen als handelnde Subjekte begreift. Wir sprechen mit den Herausgeber*innen über Idee und Bedeutung.
Interview: Johanna Ritter
In Ihrem Band versammeln Sie Beiträge die Armut facettenreich untersuchen. Sie alle eint die „Akteursperspektive“, wie sie am Anfang schreiben. Was genau bedeutet das?
Marquardsen: Traditionell war die Armutsforschung stark quantitativ ausgerichtet. Sie zeigt, wie viele Menschen von Armut betroffen sind, welche Gruppen besonders gefährdet sind – das ist wichtig. Was aber oft fehlt, ist die Sichtweise derjenigen, die Armut tatsächlich erleben. Wir wollten verstehen, wie sich Armut im Alltag zeigt, wie Menschen mit materiellen Engpässen, Stigmatisierung und Ausschluss umgehen und wie sie ihr Leben trotz widriger Bedingungen gestalten. Es gab in diesem Zusammenhang schon den Begriff der Subjektperspektive, aber hier wird das Handeln von Menschen eher als Anpassung an die Verhältnisse betrachtet. Oft ist in diesem Zusammenhang auch von der „Betroffenenperspektive“ die Rede. Doch dieser Begriff legt eine gewisse Passivität nahe – als wären Menschen, die in Armut leben, vor allem Opfer äußerer Umstände. Uns war wichtig, genau das zu vermeiden. Deshalb sprechen wir von einer Akteursperspektive, die betont, dass Menschen in Armut handelnde Subjekte sind: aktiv und eigensinnig in der Art, wie sie ihren Alltag bewältigen.
Leßmann: Ich finde es zentral, das hervorzuheben: Menschen in Armut handeln – manchmal auch gegen Erwartungen. Es gibt zum Beispiel gute Gründe, Sozialleistungen wie das Bürgergeld nicht in Anspruch zu nehmen, etwa aus Scham oder aus Erfahrungen mit bürokratischer Behandlung. Die Akteursperspektive macht das sichtbar und hilft, stereotype Vorstellungen zu hinterfragen.
Ihr Sammelband versammelt sehr unterschiedliche Beiträge. Wie konkretisiert sich diese Perspektive darin?
Leßmann: Viele Beiträge stammen aus qualitativer Forschung. Sie „zoomen“ gewissermaßen in den Alltag bestimmter Gruppen hinein: Familien im Hilfebezug, Menschen, die Leistungen nicht beantragen, oder Personen, die über den Begriff „Bedürftigkeit“ nachdenken. Diese Studien zeigen, wie Menschen Unterstützung interpretieren, annehmen oder ablehnen – und wie sie versuchen, ihr Leben unter schwierigen Bedingungen zu gestalten. Damit wird Armut nicht nur als Mangel verstanden, sondern als soziale Praxis: als ständiges Aushandeln von Handlungsspielräumen. Das ist der rote Faden, der die Beiträge verbindet.
Wie lässt sich die Akteursperspektive mit strukturellen Bedingungen von Armut verbinden?
Marquardsen: Das Handeln der Akteure ist immer eingebettet in soziale, ökonomische und politische Strukturen – etwa in die Institutionen des Sozialstaats oder in Arbeitsmarktpolitiken. Die Akteursperspektive heißt also nicht, nur auf das Individuum zu blicken. Sie bedeutet vielmehr, zu untersuchen, wie Menschen innerhalb dieser Strukturen ihre Handlungsfähigkeit behaupten. Auf der Mikroebene sehen wir individuelles Handeln, auf der Mesoebene Institutionen wie Jobcenter, auf der Makroebene politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Diese Ebenen bedingen einander. Gerade weil Armut Handlungsfähigkeit einschränkt, ist es interessant zu sehen, wie Menschen versuchen, sie unter diesen Bedingungen wiederherzustellen.
Leßmann: Und das gilt auch für den strukturellen Teil unseres Buches. Dort geht es etwa um sozialstaatliche Institutionen oder räumliche Dimensionen von Armut – aber immer in der Verbindung zur Wahrnehmung und Praxis der Betroffenen.
Das Issue Network ist interdisziplinär angelegt. Wie spiegelt sich das in Ihrer Arbeit wider?
Leßmann: Die Autor*innen kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen – Soziologie, Ökonomie, Sozialarbeit, Politikwissenschaft und Kulturwissenschaften. Entsprechend vielfältig sind die Perspektiven im Band. Es gibt einen Schwerpunkt auf qualitativen Methoden, aber auch quantitative Ansätze sind vertreten. Diese Kombination war uns wichtig, um Armut in ihrer ganzen Komplexität zu erfassen: als soziales, ökonomisches, kulturelles und politisches Phänomen. Auch methodisch verstehen wir Interdisziplinarität als Chance, Grenzen zwischen Forschungsansätzen zu überwinden.
Sie schreiben, Armut sei ein Forschungsgegenstand, zu dem man sich schwer neutral verhalten könne. Was meinen Sie damit?
Marquardsen: Schon die Entscheidung, von Armut zu sprechen, ist nicht neutral. Damit bezeichnet man ein gesellschaftliches Problem, das man nicht einfach hinnehmen kann. In unserem Netzwerk war schnell klar, dass wir nicht nur theoretisch und methodisch arbeiten, sondern auch die politischen Dimensionen von Armut reflektieren müssen. Dass sich derzeit so viele Forschende für Armut interessieren, liegt auch an gesellschaftlichen Entwicklungen. Armut hat in den letzten zwanzig Jahren zugenommen und sich verfestigt. Gleichzeitig richtet sich die Sozialpolitik seit den Arbeitsmarktreformen der 2000er-Jahre stärker auf das Verhalten Einzelner – auf „Aktivierung“ statt auf strukturelle Ursachen. Diese Individualisierung hat die Ungleichheit eher verschärft, statt sie zu mindern.
Leßmann: Das zeigt sich gerade in der Bürgergeld-Debatte. Der Sozialstaat will helfen, aber seine Hilfsangebote definieren erst, wer als arm gilt. Damit wird Hilfe auch zum Mechanismus sozialer Zuschreibung. Georg Simmel hat schon betont, dass jemand erst durch die Inanspruchnahme von Hilfe sozial zum „Armen“ wird. Unsere Forschung macht solche Widersprüche sichtbar. Die Akteursperspektive ist in gewisser Weise eine Reaktion auf die Individualisierung von Armut. Sie richtet den Blick auf Menschen, die unter diesen Bedingungen leben und dennoch aktiv handeln. Damit widerspricht sie dem Bild der passiven Leistungsbeziehenden und zeigt, dass Armut nicht durch Kontrolle oder Sanktionen überwunden wird, sondern durch soziale Sicherheit und echte Teilhabe.
Marquardsen: Und genau deshalb kann Forschung hier gar nicht neutral sein. Sie beschreibt nicht nur, sondern wirft Fragen auf: Wie wollen wir mit Armut umgehen? Welche Verantwortung trägt die Gesellschaft? Und welche Politik stärkt Menschen, statt sie zu beschämen? Wir brauchen eine Sozialpolitik, die auf bedingungslose Teilhabe zielt – nicht auf Verhaltenssteuerung. Denn eine Gesellschaft, die Sicherheit ständig infrage stellt, schafft Verunsicherung und öffnet Raum für populistische Tendenzen.
Wie gelingt es, solche Forschungsergebnisse in politische Prozesse einzuspeisen?
Leßmann: Das ist nicht einfach. Wir haben den Schwerpunkt zunächst auf die Forschung gelegt, aber über Konferenzen und die Publikation versuchen wir, in den Dialog mit Politik und Praxis zu treten.
Marquardsen: Der Transfer zwischen Wissenschaft und Politik ist traditionell schwierig, weil beide je eigene „Sprachen“ sprechen und sich nicht automatisch gegenseitig verstehen. Wichtig ist, Brücken zu bauen – und da kann eine Institution wie das DIFIS eine zentrale Rolle spielen. Auf kommunaler Ebene erleben wir viel Interesse am Thema Armut, weil die Probleme dort konkret sichtbar sind. Auf Bundesebene ist es schwieriger, durchzudringen – auch weil unsere Perspektive nicht immer dem politischen Mainstream entspricht. Aber genau das macht sie notwendig. In Österreich sieht man, dass das enger zusammengehen kann: Dort ist die Armutsforschung über Organisationen wie die Diakonie viel stärker mit Politik und Praxis verknüpft. Dieses Beispiel zeigt, wie solche Netzwerke langfristig wirken können.
Was sind die nächsten Schritte im Netzwerk Armutsforschung?
Leßmann: Wir arbeiten aktuell an einer Expertise zur Akteursperspektive, die bald veröffentlicht wird, und planen ein begleitendes Webinar. Auch in der Buchreihe wollen wir die Perspektive fortführen, etwa im Hinblick auf Intersektionalität – also das Zusammenspiel verschiedener Benachteiligungen wie Geschlecht, Herkunft und Armut.
Marquardsen: Darüber hinaus wollen wir den wissenschaftlichen Austausch weiter fördern. Die Akteursperspektive bietet eine begriffliche Klammer für Forschende unterschiedlicher Disziplinen, und sie öffnet Raum für neue Kooperationen. Das Netzwerk soll dafür eine Plattform bleiben – ein Ort, an dem Diskussionen über Armut, Handlungsspielräume und soziale Teilhabe fortgesetzt werden können.
Ortrud Leßmann und Kai Marquardsen 2025, "Von Armut zu sprechen ist nicht neutral", in: sozialpolitikblog, 13.11.2025, https://difis.org/blog/von-armut-zu-sprechen-ist-nicht-neutral-183 Zurück zur Übersicht

Dr. Ortrud Leßmann ist wissenschaftliche Referentin in der Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut. Sie ist verantwortlich für das Monitoring in der Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ (ServiKiD). Zusammen mit Kai Marquardsen leitet sie das Issue Network Armutsforschung am DIFIS.

Prof. Dr. phil. Kai Marquardsen ist Soziologe und Professor mit dem Lehrgebiet „Armut und soziale Ungleichheit im Kontext Sozialer Arbeit“ an der HAW Kiel. Er ist Mitbegründer des Issue Network „Armutsforschung“ im DIFIS. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Armut und Alltag, Armut und Eigensinn, Armut und soziale Netzwerke, aktivierende Sozialpolitik.