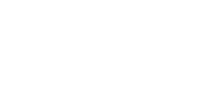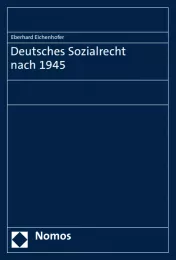Welche Zukunft für die Sozialpolitik der EU?
Die Krisen der heutigen Zeit verlangen Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis. Hans-Peter Klös ist ehemaliger Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft am Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) und widmete sich immer wieder Aufgaben der Wissenschaftskommunikation und Politikberatung. Im sozialpolitikblog-Gespräch äußert er sich zu seiner Arbeit in verschiedenen Gremien und Kommissionen, der Notwendigkeit und den Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation, sowie zu dem Bericht der "High-Level-Group" des Expertengremiums der Europäischen Kommission mit dem Titel "The Future of Social Protection and of the Welfare State in the EU".
Interview: Ute Klammer
In Ihrer langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Wissenschaft im IW Köln haben Sie sich immer wieder mit großem Engagement Aufgaben der Wissenschaftskommunikation und Politikberatung gewidmet, gerade auch rund um Themen des Arbeitsmarktes und der Sozialpolitik. Können Sie überhaupt noch sagen, in wie vielen Beiräten und Kommissionen Sie im Laufe der Zeit mitgewirkt haben?
Das waren sicherlich deutlich mehr als 10 größere Kommissionen, von Enquêtekommissionen des Landtags und des Bundestags, darunter die Enquêtekommission zur Beruflichen Bildung, der Familienbericht der Bundesregierung und zuletzt die High Level Group für die Europäische Kommission. Dazu kamen auch Kommissionen von Stiftungen und Gremien von Bundesministerien. Angefangen hat alles mit der Benchmarking-Gruppe im Bündnis für Arbeit, in der ich unserem damaligen Institutsdirektor Fels zugearbeitet habe. Dort sind wichtige Papiere entstanden zur Vorbereitung der Arbeitsmarktreformen. Das war für mich der Einstieg in die engere Form der Politikberatung. In der Summe ist das nach meiner Auffassung eine wichtige Aufgabe von Forschungsinstituten und Think Tanks, mit wissenschaftlichen Ergebnissen einer politiknahen Praxis beratend zur Seite zu stehen.
Wie wichtig die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis ist, haben wir ja nicht zuletzt im Rahmen der Corona-Pandemie gemerkt, aber seitdem auch in den weiteren Krisen, die uns gerade beschäftigten. Sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute gut genug vorbereitet auf Aufgaben der Wissenschaftskommunikation? Und umgekehrt: Müssen nicht vielleicht auch Politikerinnen und Politiker noch dazulernen, wenn es um die Kommunikation mit der Wissenschaft geht?
Ich denke, dass Wissenschaft eine Bringschuld hat, auch wenn es manchmal mühsam ist. Viele von uns sind in der privilegierten Situation, dass wir unsere Zeit, Kraft und Kompetenz in die Befunde und die Ableitung von Empfehlungen investieren können. Das sollte zu einem Selbstverständnis der Wissenschaft werden. Es gibt zudem eine Verantwortung, in den interdisziplinären Dialog mit dem Ziel einer sauberen Evidenz einzutreten. Ich bin sehr dafür, evidenzbestimmte Politikberatung immer wieder ins Zentrum zu stellen. Es gibt die Grundlagenforschung, es gibt aber auch evidenzbasierte anwendungsorientierte Forschung, die einen Beitrag zur Problemlösung leisten kann. In der Zeit von Fake News und hybrider Kriegsführung mit Desinformation sollte Wissenschaft hier einen eminenten Beitrag zur Aufklärung leisten, auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden können. Die Corona-Pandemie ist ein gutes Beispiel hierfür. Es gab Notfallpläne, aber die kannte man nicht. Man war im empirischen Blindflug, als die Pandemie über uns kam. Da war es die Aufgabe von Wissenschaft, Antworten zu finden, zunächst von Medizinern und Virologen, aber dann auch von Sozialwissenschaftlern. In der interdisziplinären Befassung, wie es zum Beispiel die Leopoldina gemacht hat, liegt ein Mehrwert für offene, demokratische Gesellschaften, so dass sie am Ende besser aus Pandemien herauskommen als autokratische Systeme.
Zuletzt waren Sie Mitglied eines hochrangigen Expertengremiums der Europäischen Kommission, einer „High-Level-Group“ aus 11 Mitgliedern unter Leitung von Anna Diamantopoulou, der früheren EU-Kommissarin für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Diese Gruppe hat ein Jahr lang, von November 2021 – 2022, gearbeitet und kürzlich ihren Bericht vorgelegt. Er trägt den bedeutungsschweren Titel „The Future of Social Protection and of the Welfare State in the EU“. Da hat sich die Kommission ja einiges vorgenommen. Wie sind Sie zum Mitglied dieses Gremiums geworden, und wie hat sich die Arbeit in dieser Kommission gestaltet?
Ich hatte irgendwann Kenntnis von der Ausschreibung bekommen und habe mich nach längerem Zögern beworben, weil ich meinte, aus der langjährigen Erfahrung eines Wirtschaftsinstituts hier einen Beitrag leisten zu können. Ich bin dann berufen worden und habe viel gelernt in dem einjährigen, intensiven Diskussionsprozess. Der war nicht immer einfach, weil es darum ging, noch während der Corona-Pandemie über die Zukunft der Sozialen Sicherung in einer längeren Perspektive zu beraten, zumal dann noch der Ukraine-Krieg dazukam, der in der Brüsseler Bubble enorme Aktivitäten ausgelöst hat. Wie wir alle wissen, ist die Zukunft unsicher. Dann noch eine eigenständige Idee zu entwickeln, die über die unzähligen Kommissionsdokumente hinausgeht, war nicht einfach. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, in einem interdisziplinären Diskurs mit Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Ländern diesen Bericht zu erarbeiten, der Anfang Februar im Beisein von EU-Kommissar Schmit in einer großen Konferenz in Brüssel mit verschiedenen Podiumsrunden vorgestellt wurde. Diese High Level Group war offenbar ein lange gehegter Plan von Kommissar Schmit. Es ging ihm wohl vor allem darum, die Europäische Säule Sozialer Rechte mit einem weiteren Papier zu fundieren. Für die 2024 anstehende belgische Ratspräsidentschaft mit dem belgischen Minister Frank Vandenbroucke soll dieses Dokument eine Grundlage für weitere sozialpolitische Vorhaben sein.
Der Bericht geht aus von vier Megatrends, denen sich die europäischen Gesellschaften gegenübersehen und auf die auch der Sozialstaat reagieren muss: demographische Veränderungen, die Klimakrise, Veränderungen auf den Arbeitsmärkten sowie die digitale Transformation. Wie hat die Kommission das Ineinandergreifen dieser Krisen diskutiert? Während wir ja den demographischen Wandel schon lange diskutieren, erhalten Zusammenhänge zwischen Klima und Sozialpolitik erst langsam mehr Aufmerksamkeit. Hat dieses Feld hier eine besondere Rolle gespielt?
Das war sicher der am wenigsten ausgereifte Part des Gutachtens. Vor allem die Energiekrise hat aber im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu enormen Folgen geführt. Wenn man sich die Effekte des Energieverbrauchs ansieht, kommt man zu dem Befund, dass einkommensschwächere Haushalte einen sehr viel größeren Anteil ihres Einkommens für Energie aufbringen müssen als wohlhabendere Haushalte. Deshalb führt die deutliche Steigerung der Energiepreise eindeutig zu einer Zunahme von gesellschaftlichem Stress. Sowohl die deutsche wie auch die europäische Politik mussten schnell reagieren, um der energiepreisgetriebenen Inflation zu begegnen. So besteht zumindest auf den zweiten Blick ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Megatrends und insbesondere auch der Dekarbonisierung mit der Verteilungs- und Sozialpolitik. Das musste im Bericht verknüpft werden. Die Demographie ist eine träge Variable, aber auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie sich reagieren lässt – sei es mit einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit, sei es mit einer Veränderung des Arbeitsvolumens oder Veränderungen der Lage der Arbeitszeit. Weniger klar ist, wie sich die Digitalisierung auf die Arbeitswelt auswirkt. Natürlich gibt es Tendenzen, dass nicht alle Tätigkeiten in die sozialen Sicherungssysteme einbezogen sind. Das war auch ein Schwerpunkt der Arbeit. Dass das Thema Dekarbonisierung auch Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt und in den Wertschöpfungsketten nach sich zieht, dass das eine sektorale, qualifikatorische, regionale Reallokation von Arbeit bedeutet, das sind Themen, zu denen in kurzer Zeit Empfehlungen entwickelt werden mussten.
Sicher keine leichte Aufgabe! Wenn wir nochmal auf den Arbeitsmarkt sehen: Da kommt der Bericht ja zu Forderungen, die nicht gerade überraschend sind. Wir sollen mehr und länger arbeiten, dennoch gesund in die Rente kommen… wir sehen aber gerade auf dem Arbeitsmarkt auch ganz andere Tendenzen. Nicht nur, dass allerorts über Fachkräftemangel geklagt wird, es scheint sich offenbar auch das Verhältnis zur Arbeit geändert zu haben – es sieht so aus, als sei die Bereitschaft, durchgängig in Vollzeit bis zur gesetzlichen Altersgrenze zu arbeiten, durch Corona, die multiplen Krisen und ein allgemeines Gefühl der Erschöpfung eher gesunken. Und Unternehmen sehen sich in einem Arbeitnehmermarkt zunehmend mit entsprechenden Wünschen von Beschäftigten auf Erwerbsunterbrechungen und Arbeitszeitanpassungen konfrontiert. Auch viele Tarifverträge sehen inzwischen mehr „Zeitrechte“ vor. Gibt der Bericht auf diese konfligierenden Vorstellungen Antworten oder Empfehlungen?
Ja, natürlich ist das ein Thema gewesen. Auch veränderte Werthaltungen waren Gegenstand der Diskussion. Aber es hat einen Konsens gegeben, dass an einer Erwerbszentrierung der Finanzierung sozialer Leistungen kein Weg vorbeiführt. Der Arbeitsmarkt ist der Lackmustest dafür, inwieweit die Finanzierung der sozialen Sicherung gelingen kann. Das war unstrittig. Strittiger wurde es bei dem Befund, welche Lücken wir bisher in der sozialstaatlichen Absicherung haben, und ob wir andere Finanzierungsquellen brauchen, um Lücken zu schließen. Hier war ich skeptisch gegenüber der Mehrheitsmeinung der Kommission. Die Mehrheit hat eine Verbreiterung der Finanzierungsgrundlage gefordert, obwohl auch konstatiert wurde, dass eine investive Sozialpolitik im Lebensverlauf auch zu Erträgen führe („life course multiplier“). Diese müssten meines Erachtens doch für die Finanzierung sozialer Leistungen genutzt werden können. Ich glaube, wir hatten in der Kommission ein Zeitinkonsistenzproblem: Wenn der life course multiplier-Effekt und die Wachstumsdividende von investiver Sozialpolitik, die „double dividend“ investiver Sozialpolitik, realistisch sind, müsste man keine Ausdehnung der Finanzierung fordern, es müsste zu einer Selbstfinanzierung investiver Sozialpolitik kommen. Allerdings fallen die Erträge investiver Sozialpolitik erst später an als die heutigen Handlungsbedarfe. Das ist vielleicht ein Ansatzpunkt, um über veränderte Finanzierungsstrukturen nachzudenken, es ist aber keine Grundlage dafür, von einer Unterfinanzierung sozialer Sicherung in Europa auszugehen. Wir haben keine generelle Unterfinanzierung von Sozialpolitik gegenüber anderen Ansprüchen an die Verwendungsseite des Sozialprodukts.
Der Bericht macht sich ja auch wieder stark für investive Sozialpolitik. Die kennen wir nicht nur aus Deutschland, gerade auch aus NRW – auch hier wurde schon das Problem des Zeitverzugs und geeigneter Indikatoren zur Messung der Wirkungen investiver Sozialpolitik diskutiert. Im Bericht wurde die Forderung nach investiver Sozialpolitik erneut damit verknüpft, die Aufnahme weiterer Schulden zu legitimieren. Ich vermute, das war nicht Ihre Position?
Das ist richtig.
Der Bericht fordert einerseits mehr investive Sozialpolitik, vor allem Investment in Kinder; andererseits aber auch ausgebaute Leistungen im Bereich der nachsorgenden Sozialpolitik. Während es ohne Zweifel einen großen Konsens in Europa bezüglich der Bedeutung von investiver, präventiver Sozialpolitik gibt, bleibt die Frage, wie weit wir auch weiterhin „nachsorgende“ oder „reparative“ Sozialpolitik benötigen, um dem Anspruch sozialer Sicherung, wie wir ihn in Deutschland im Grundgesetz verankert haben, gerecht zu werden. So fordert der Bericht ja auch adäquate Renten und den Ausbau von Angeboten für Pflegebedürftige. Das alles kostet aber Geld. Wurde denn in der Kommission auch diskutiert, in welchem Verhältnis investive und nachsorgende Sozialpolitik künftig stehen sollen? Denn das kann ja auch ein Konflikt sein.
Ich glaube, wir sind in der Kommission nicht immer zu den harten Prüfsteinen vorgestoßen. Ein Beispiel ist die im Bericht geforderte „Golden Rule“, sich auch für sozialpolitische Investitionen zu verschulden. Zwar ist die Kritik vielleicht berechtigt, dass der Konsolidierungskurs der EU in der Finanzkrise 2008 zu strikt war und dass es in der Corona-Pandemie besser gelaufen ist angesichts der großzügigen Hilfspakete. Der Bericht zeigt daher auch auf, dass es institutionelles Lernen gab. Die Golden Rule hat aber ein zentrales Problem: Wir müssten klar definieren können, was investive Sozialpolitik ist. Solange ich nicht weiß, was Investitionen und wie hoch deren Erträge sind, bleiben Ausnahmen von der Schuldenregel politökonomisch naiv. Diese Naivität zeichnet teilweise auch diesen Bericht aus. So kommt man über das Nachzeichnen dessen, was wünschbar ist, in der Verbindung mit der Golden Rule möglicherweise am Ende des Tages noch zu einer Empfehlung, dass die EU ein anderes „Level Playing Field“ für die per se nationalstaatliche Sozialpolitik bieten müsse. Die nächste Runde der Ausformulierung einer stärkeren Mandatorik sozialer Rechte in der EU wird genau in dieser Antwort liegen.
Genau hierzu wollte ich auch noch kommen. Der Bericht stellt die große Bedeutung sozialer Sicherung und des Wohlfahrtsstaats für die europäischen Gesellschaften heraus. Allerdings hat die EU bekanntlich nur sehr begrenzte Möglichkeiten, auf die Gestaltung der Sozialpolitik der Mitgliedsstaaten Einfluss zu nehmen. Es entsteht der Eindruck, dass diese nun gestärkt werden sollen. Wie sehen Sie das, was ist von diesem Bericht zu erwarten?
Da bin ich gespalten. Auf der einen Seite wünsche ich es mir nicht, dass der Bericht zu weniger Subsidiarität bei der Gestaltung von Sozialpolitik führt. Auf welcher föderalen Ebene – kommunal, Land, Bund, EU – ist welche Zuständigkeit zu verorten? Gibt es genuine, öffentliche Sozialschutzgüter, die nur auf EU-Ebene organisiert werden können? Dies wäre auch eine lohnende Debatte für das DIFIS: eine institutionenökonomische Analyse der Zuordnung von sozialpolitischen Zuständigkeiten. Das auf guter Evidenzbasis durchzudeklinieren wäre ein wichtiger Beitrag! Es würde dabei helfen zu sagen: Was ist eine genuin europäische Aufgabe und was ist eine nationalstaatliche Aufgabe? Ohne Beantwortung dieser Frage schiene mir der Bericht dann missverstanden zu sein, wenn er dazu benutzt würde, mehr europäische Kompetenzen für sozialstaatliche Verantwortung an sich zu ziehen. Was er leisten kann ist, den Lebenslaufbezug mit seinem investiven Potenzial empirisch stark zu machen. So lässt sich begründen, weshalb sozialstaatliche Investitionen auch auf europäischer Ebene angestoßen werden können. Die Verantwortung bleibt jedoch auf nationaler sozialstaatlicher Ebene. Schwierige Sache…
Und eine abschließende Frage: Kann das DIFIS etwas dazu beitragen, den Bericht bekannt zu machen und zu unterstützen?
Eine DIFIS-Lupe auf dem Bericht könnte sicher helfen, Forschungsfragen, die sich aus dem Bericht destillieren lassen, zu arrondieren. Es könnte Sinn machen, den Bericht in eine Befassung von einigen interessierten Forschenden zu geben, um in einer kleinen Veranstaltung zu klären, was ableitbare Forschungsfragen sind, mit deren Beantwortung man der berechtigten Intention des Berichts Rechnung tragen könnte.
Hans-Peter Klös 2023, Welche Zukunft für die Sozialpolitik der EU?, in: sozialpolitikblog, 09.03.2023, https://difis.org/blog/welche-zukunft-fuer-die-sozialpolitik-der-eu-53 Zurück zur Übersicht

Dr. Hans-Peter Klös ist Volkswirt und war bis August 2022 Leiter Wissenschaft des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Im Rahmen von Kommissionen, Beiräten und Beratungstätigkeiten war er verantwortlich für die Vernetzung der IW-Forschung mit Ministerien, Verbänden, Wissenschaft, Politik und NGOs. Zuletzt war er Mitglied der High Level Group der Europäischen Kommission „The Future of the Welfare State“ und ist aktuell stellvertretendes Mitglied im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss.