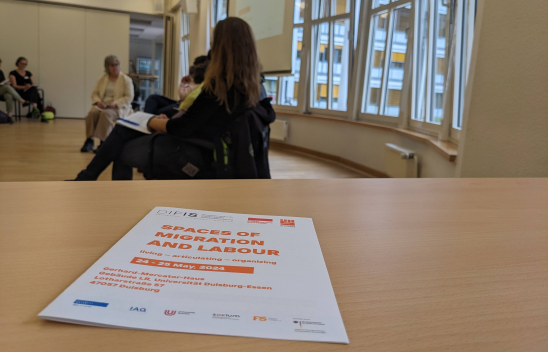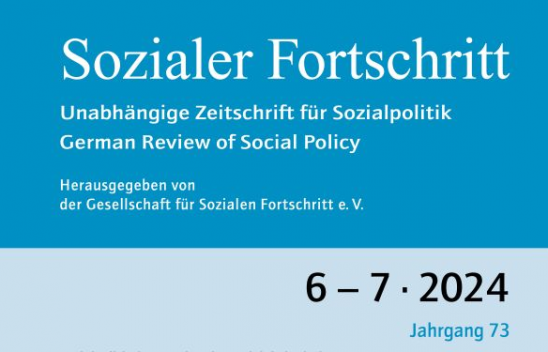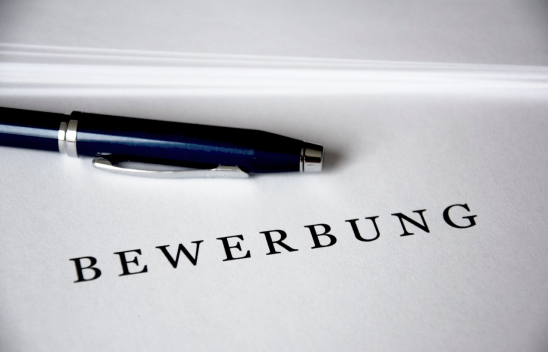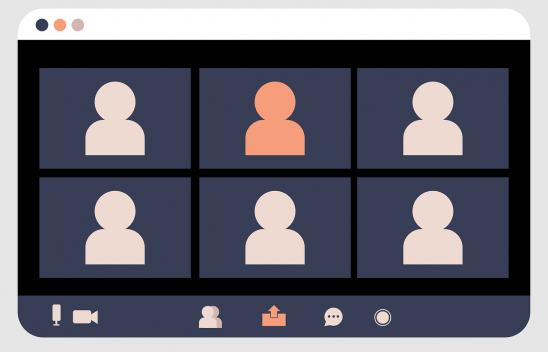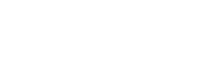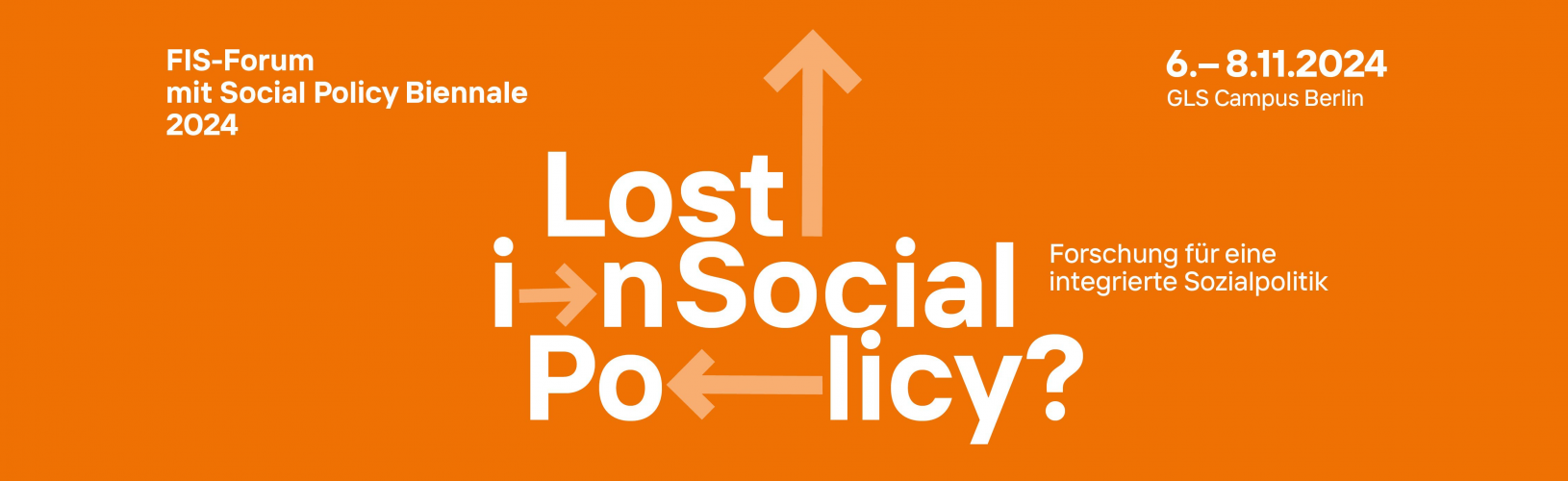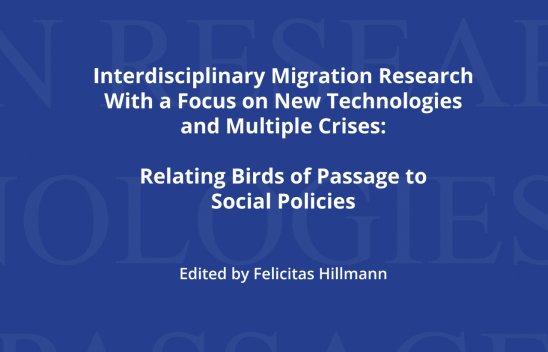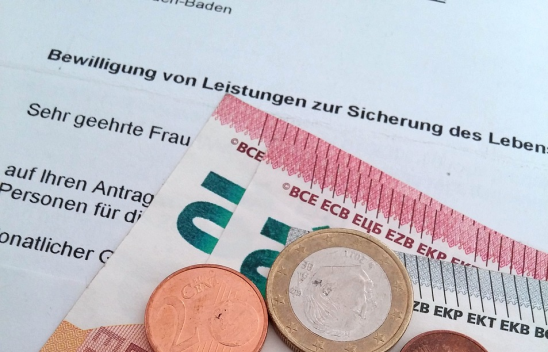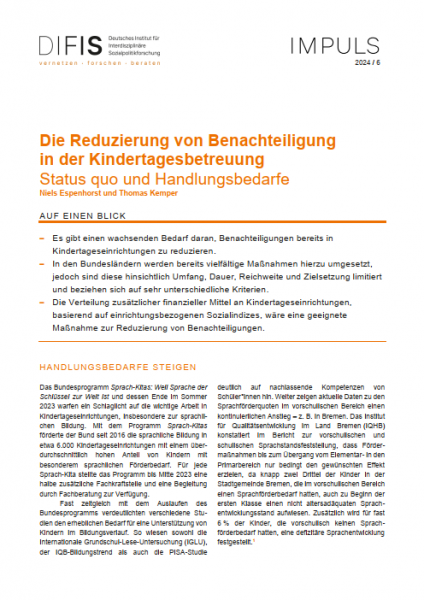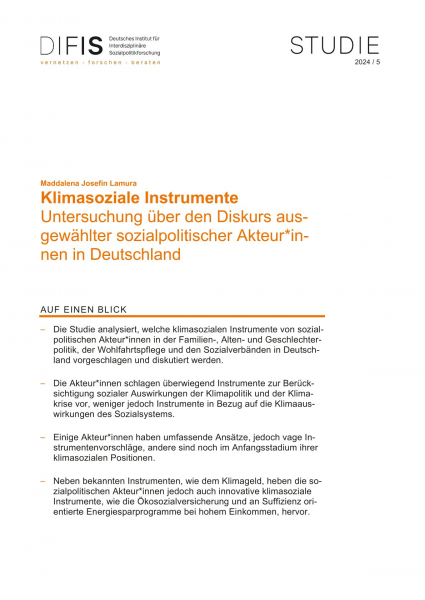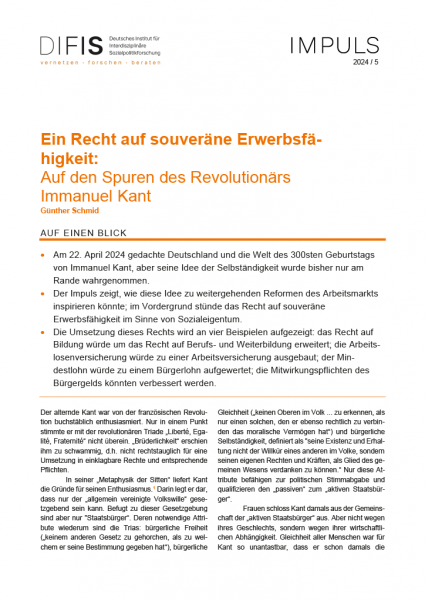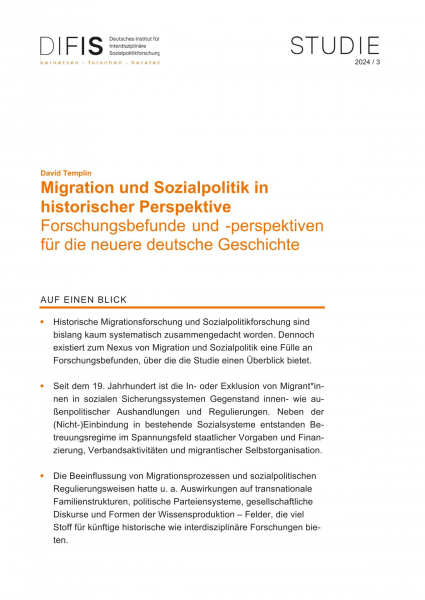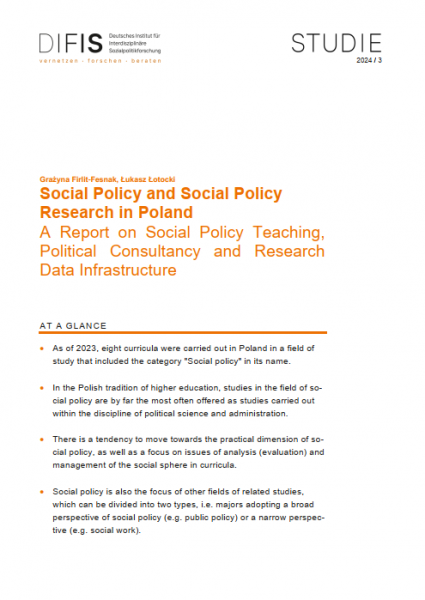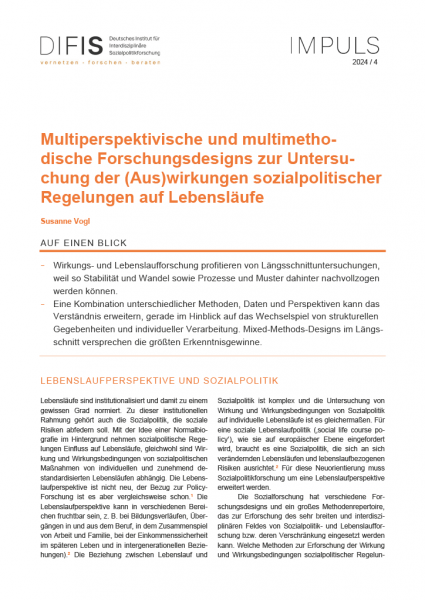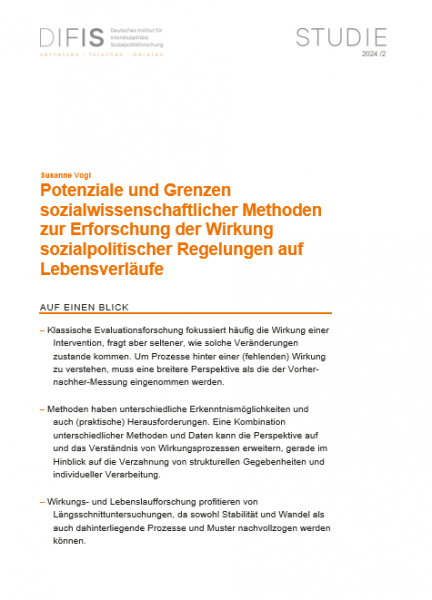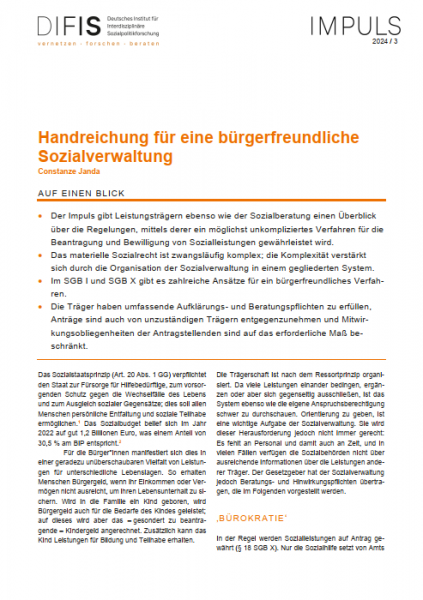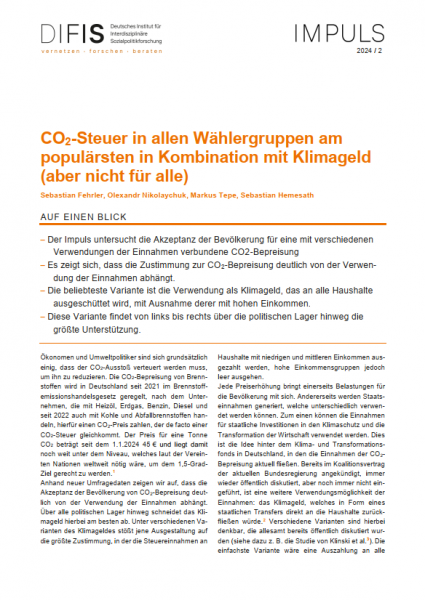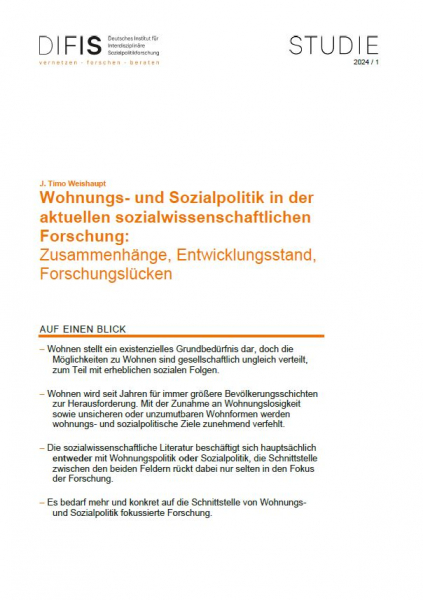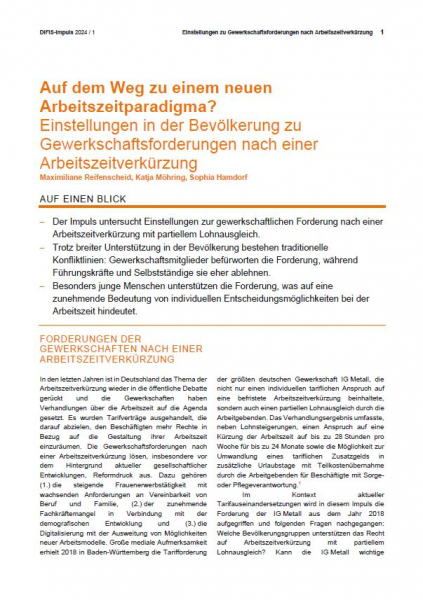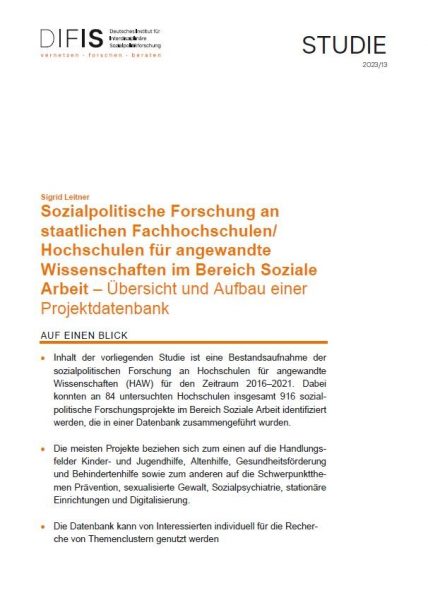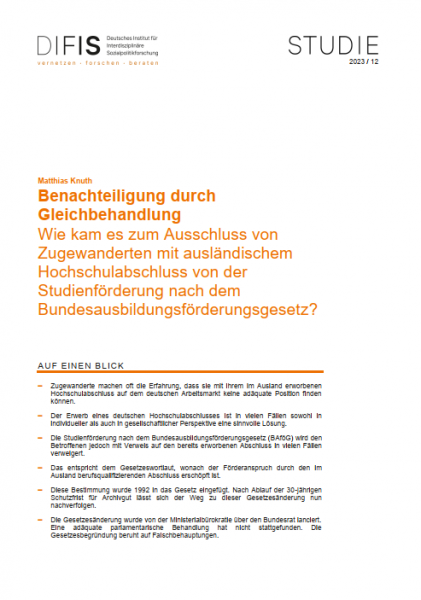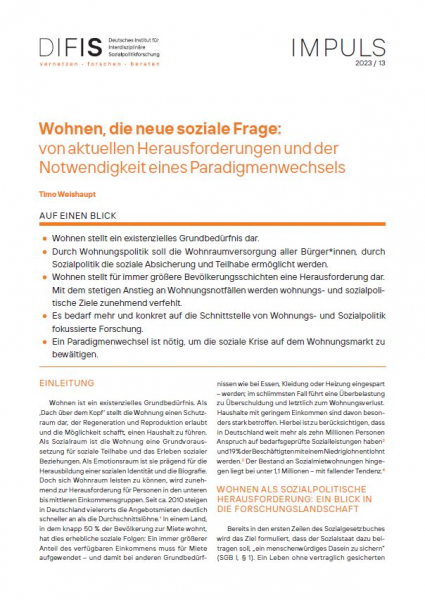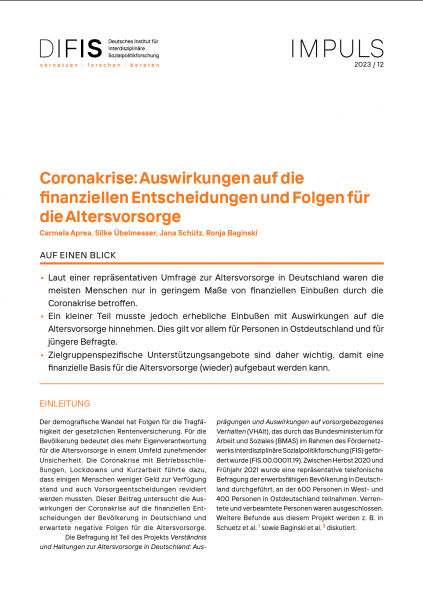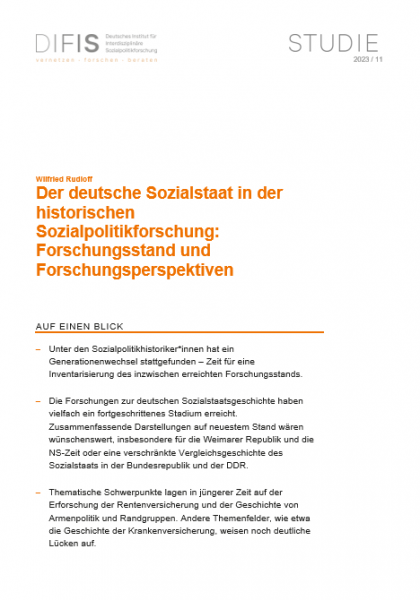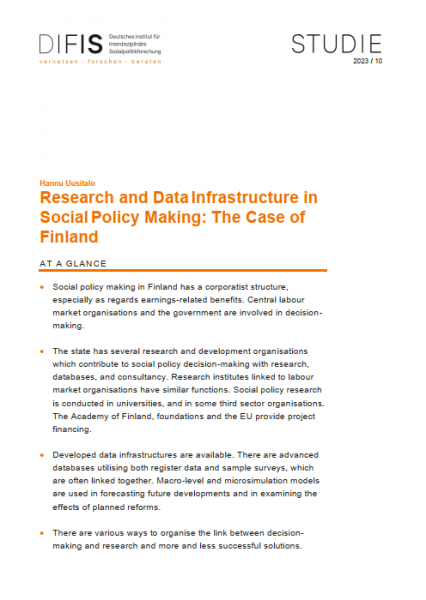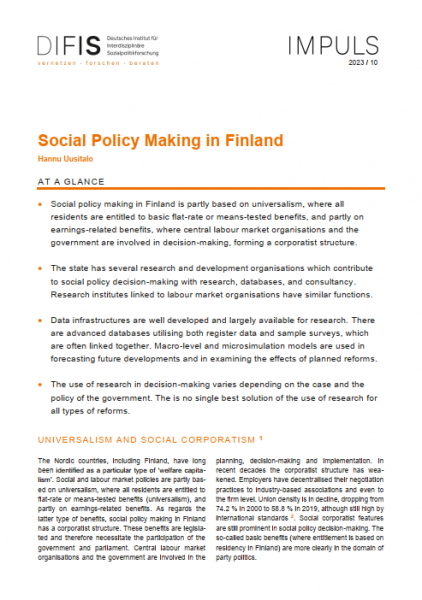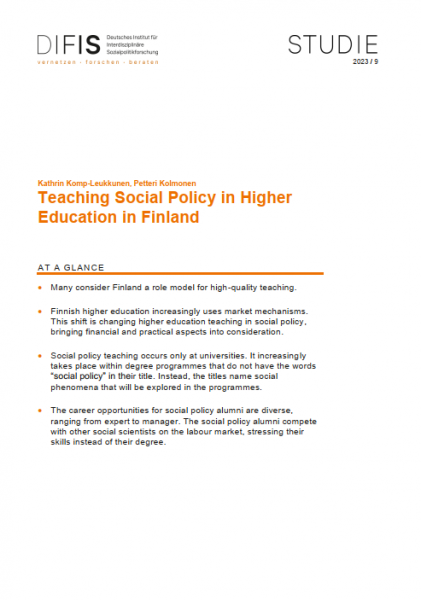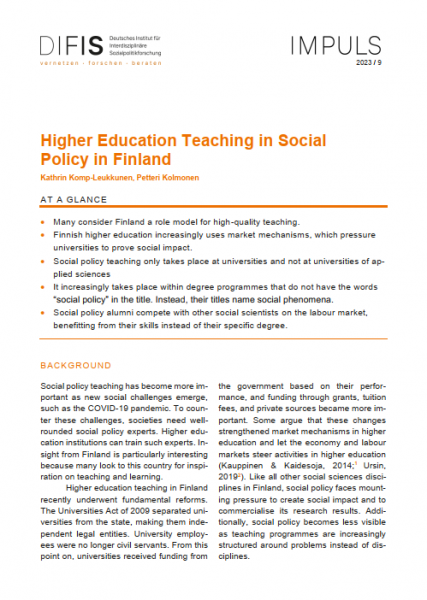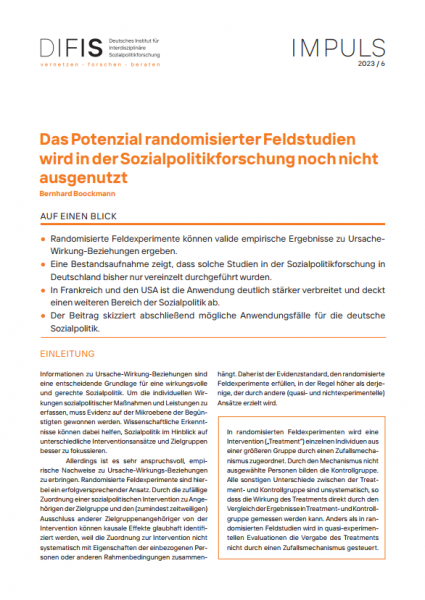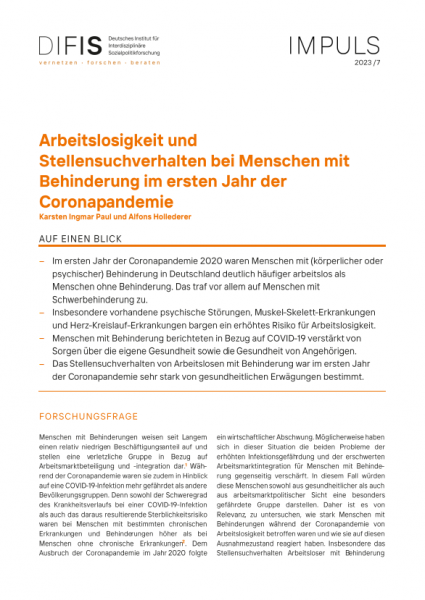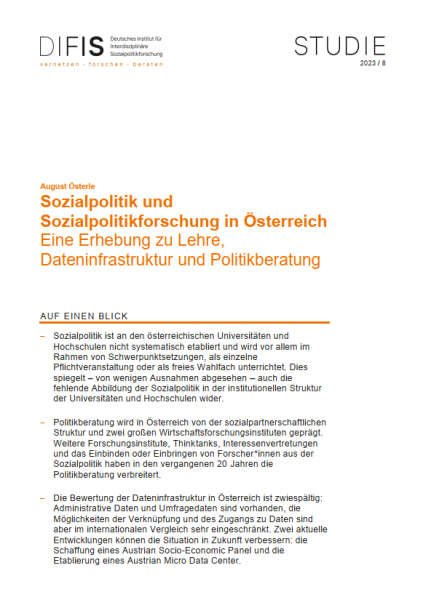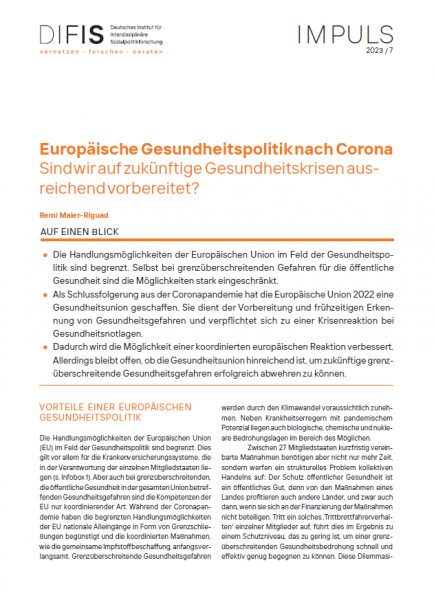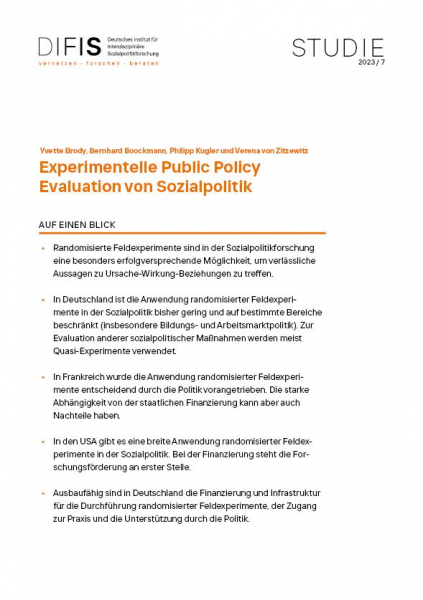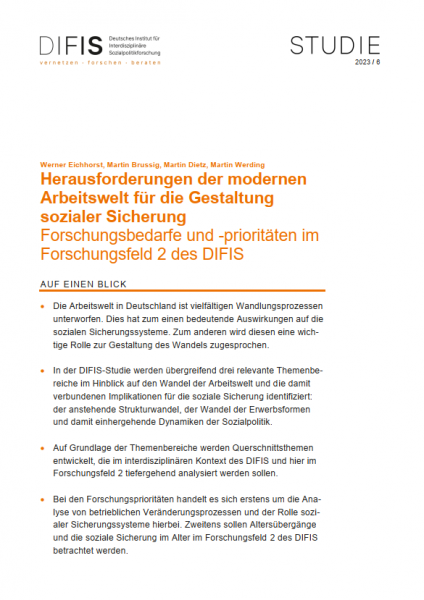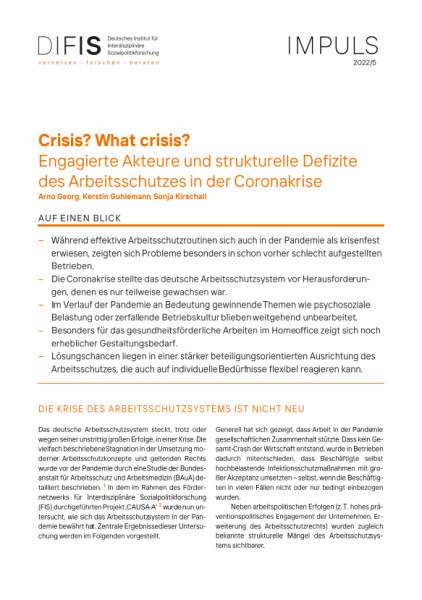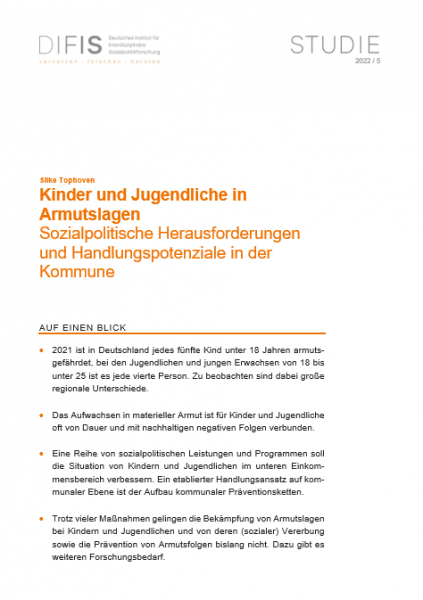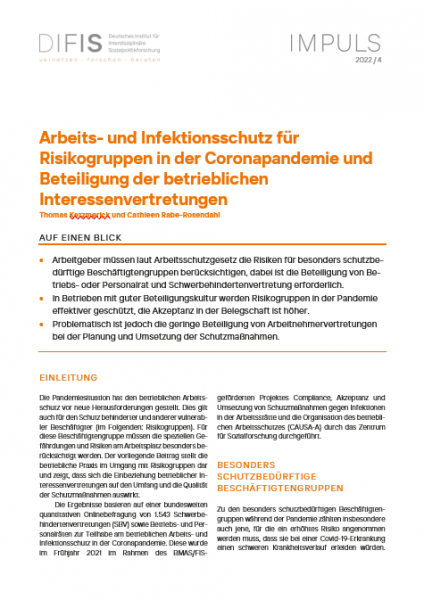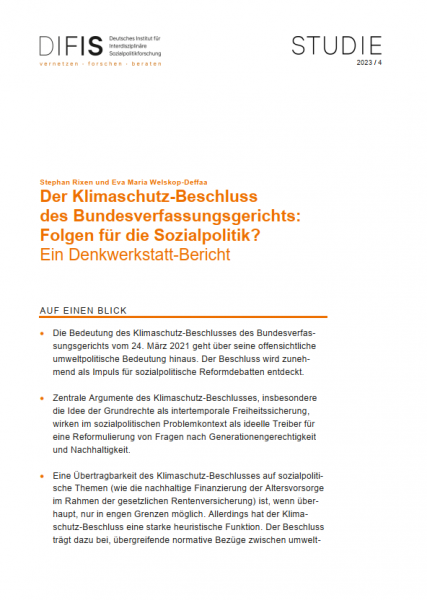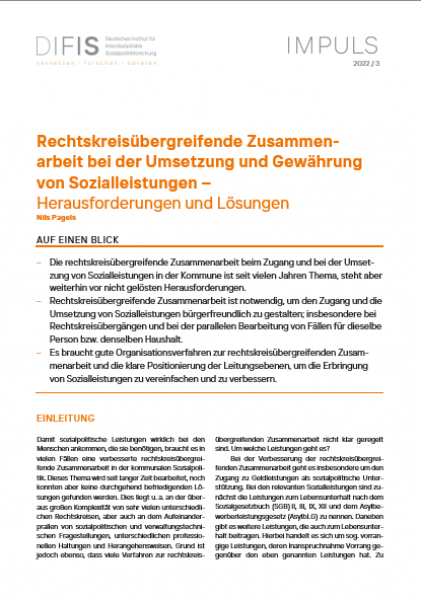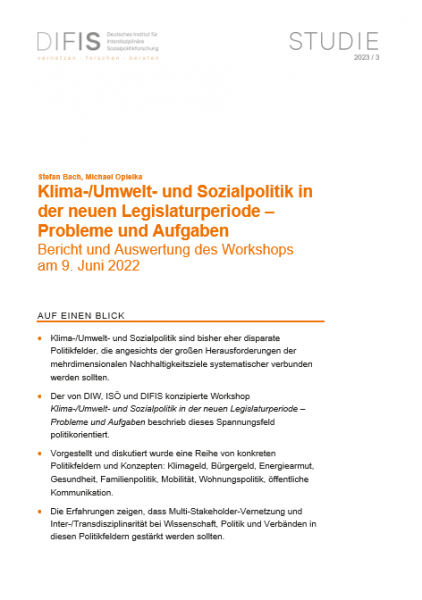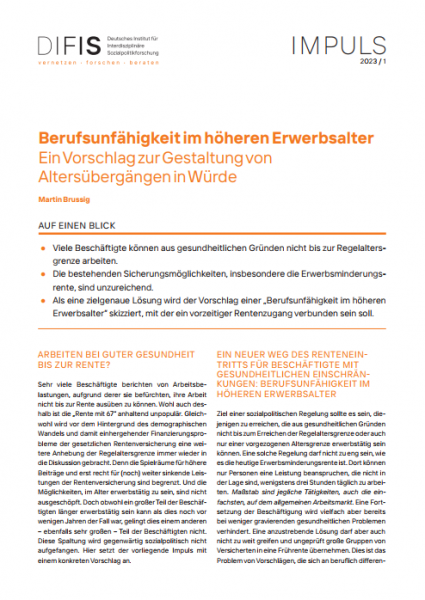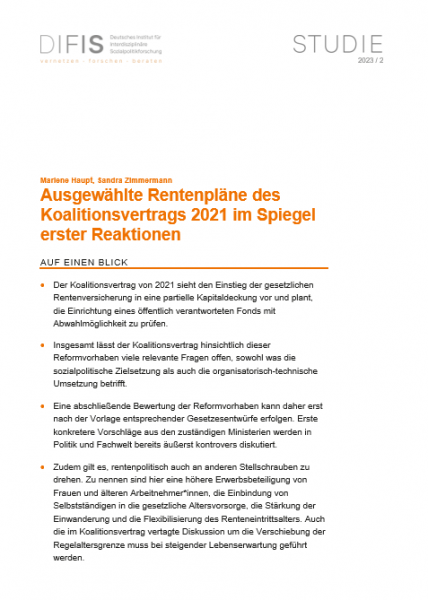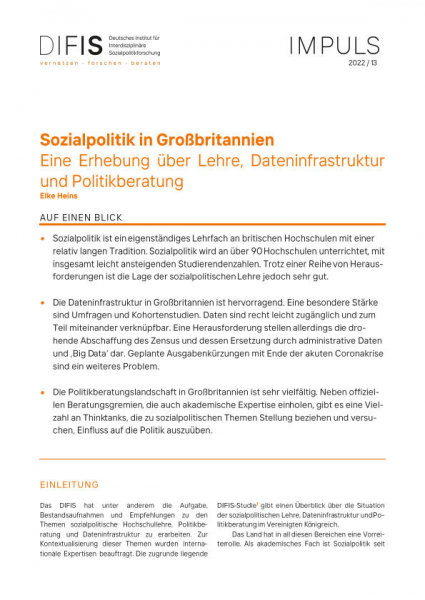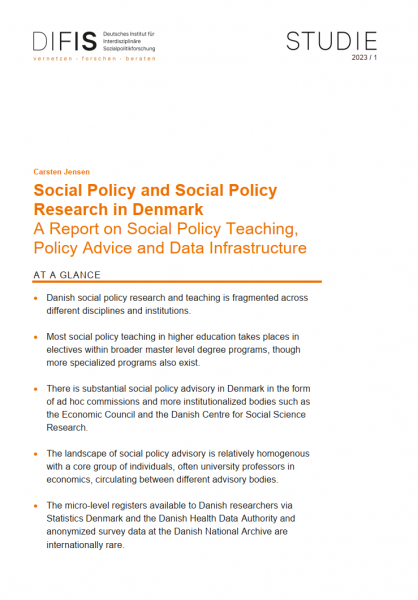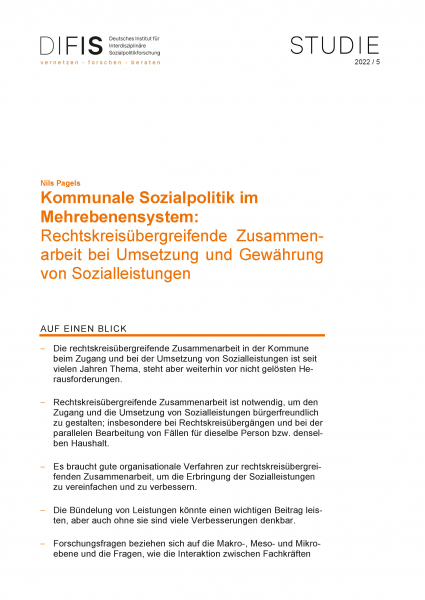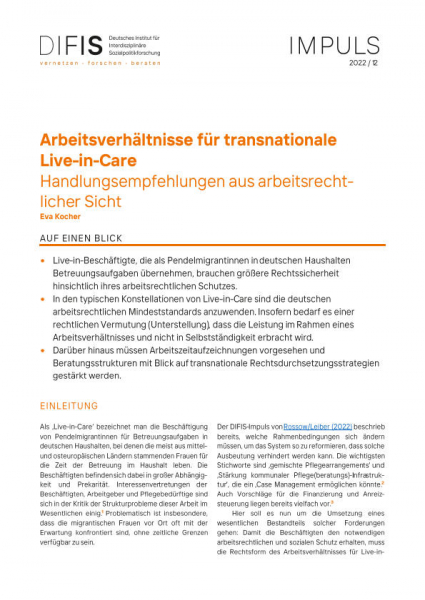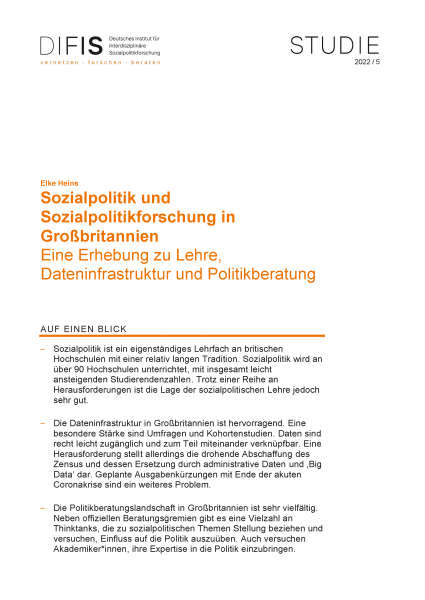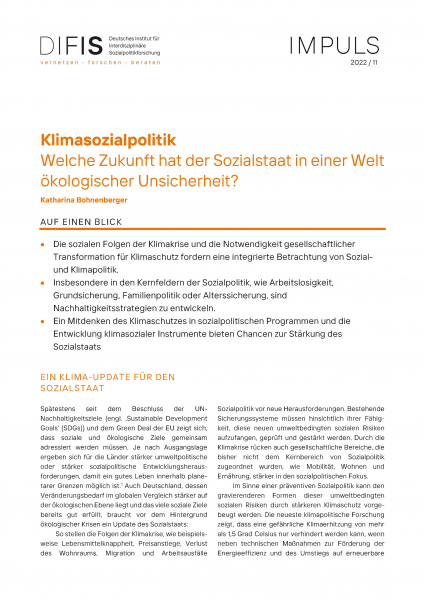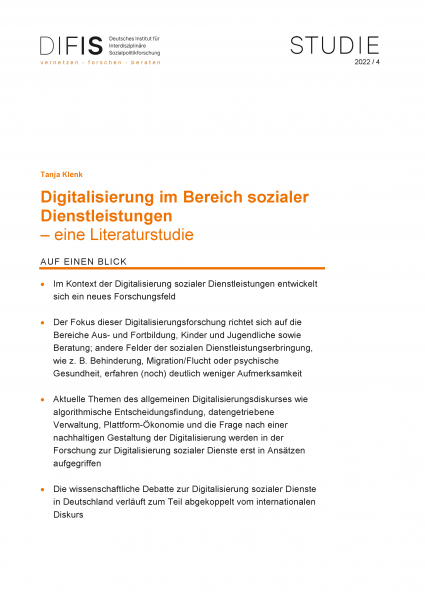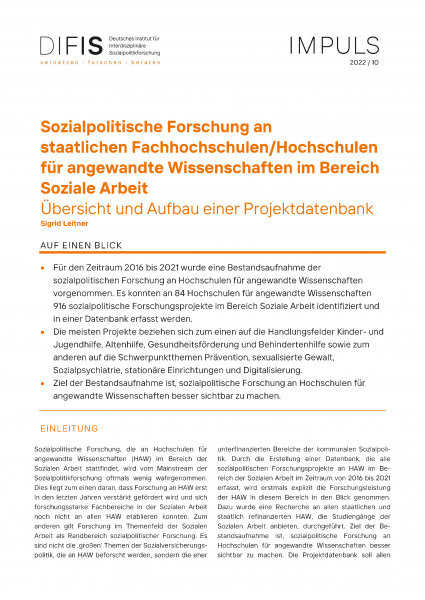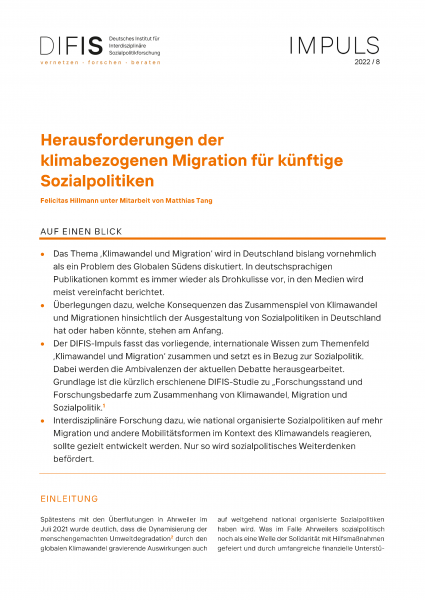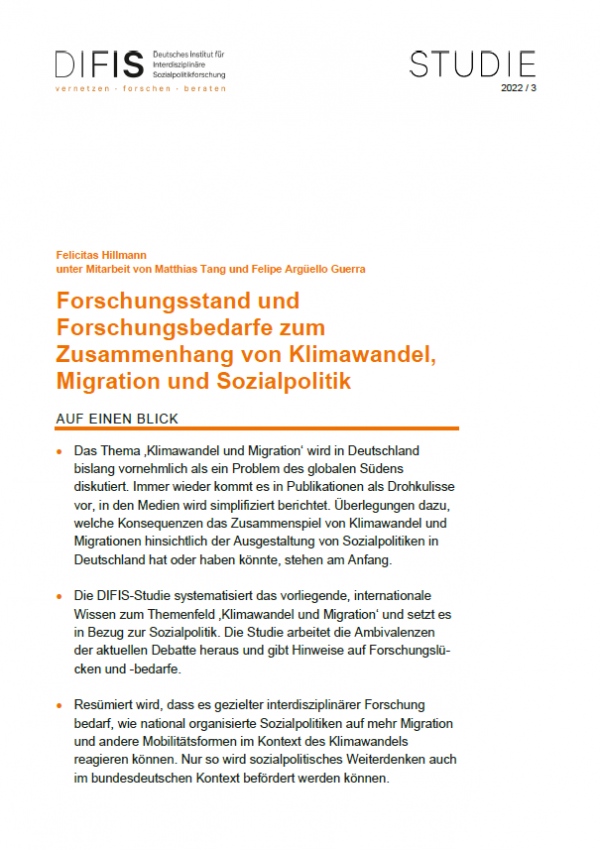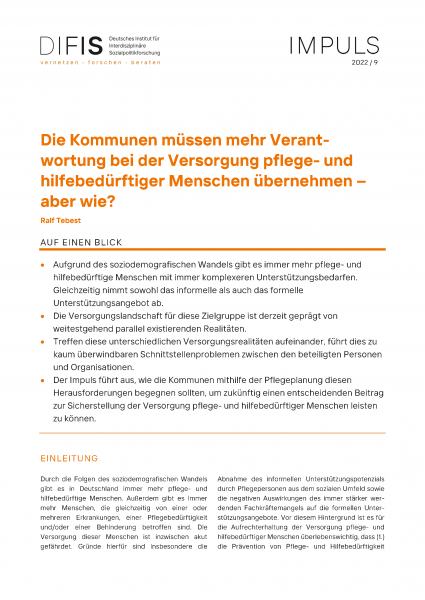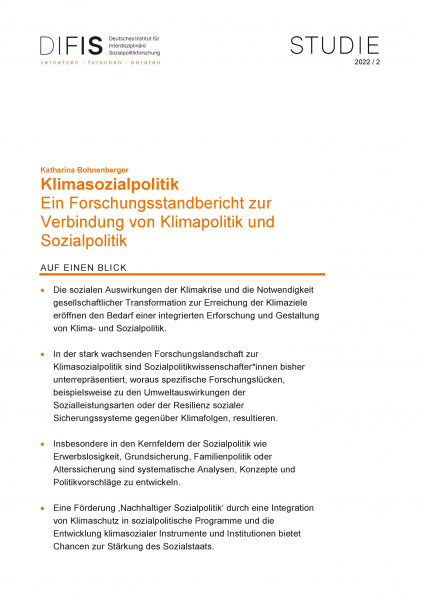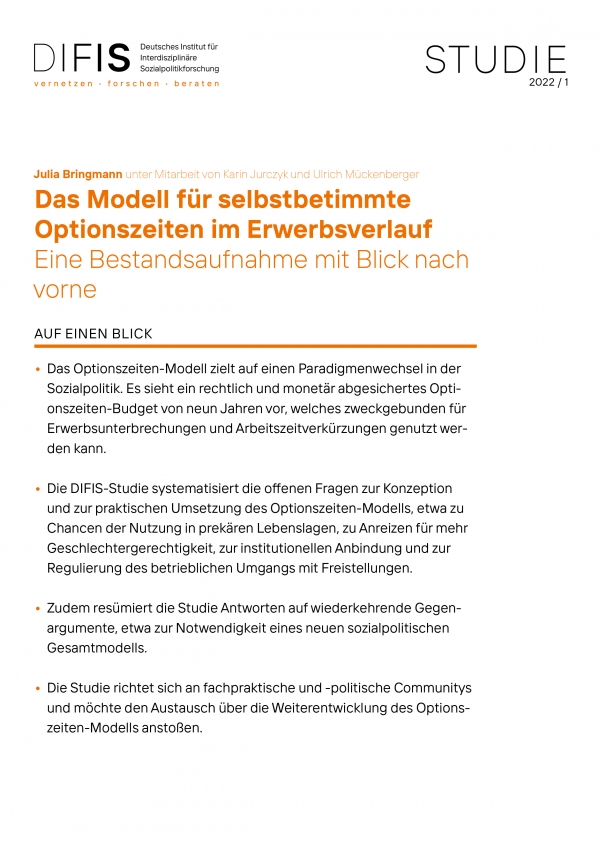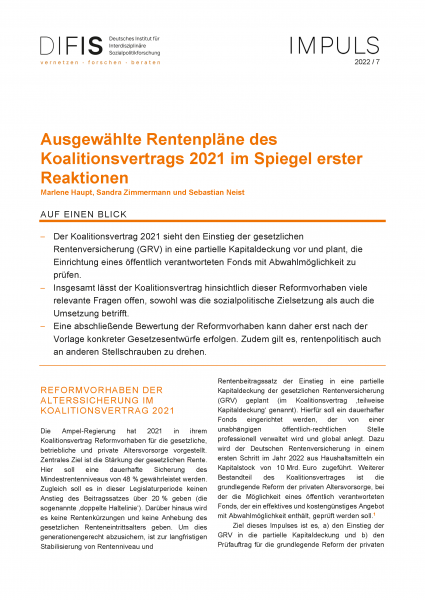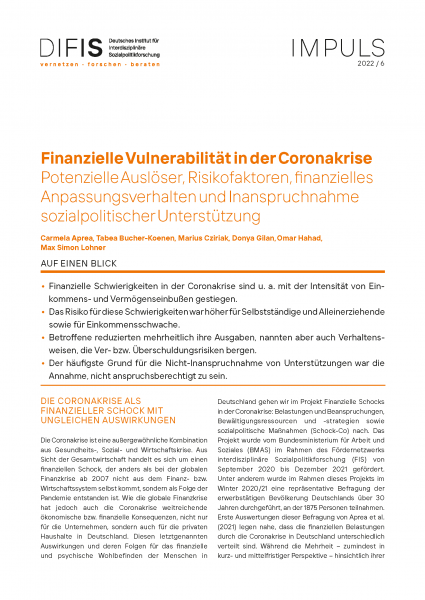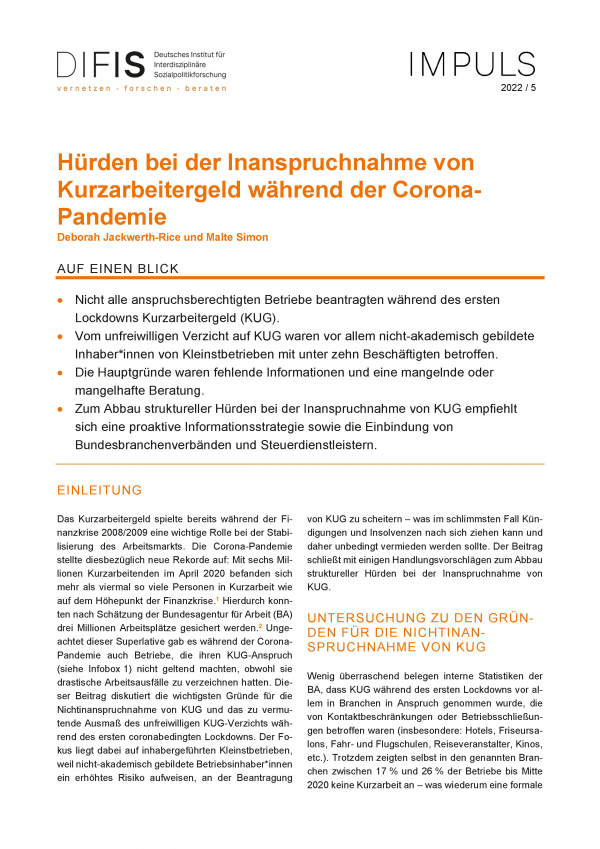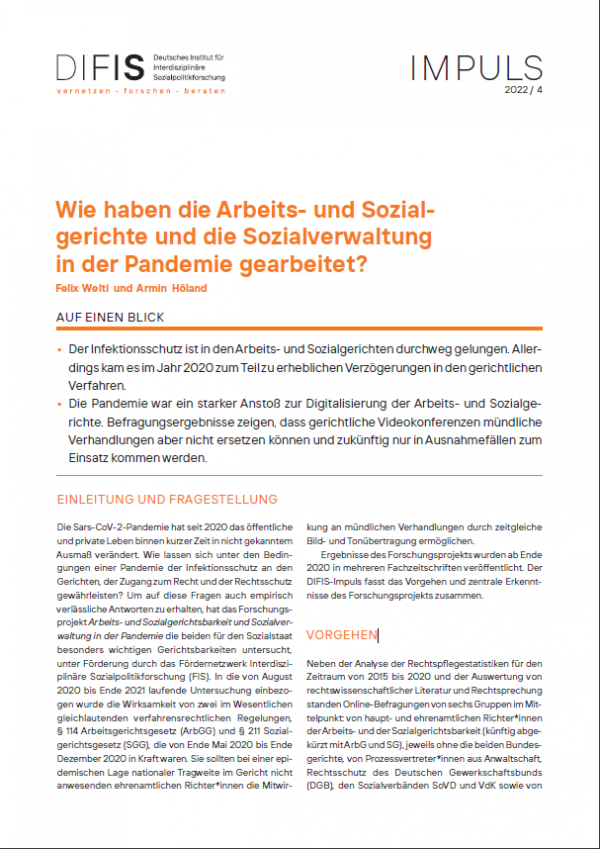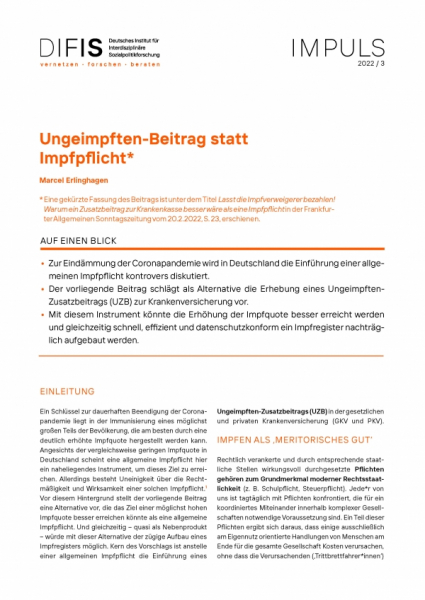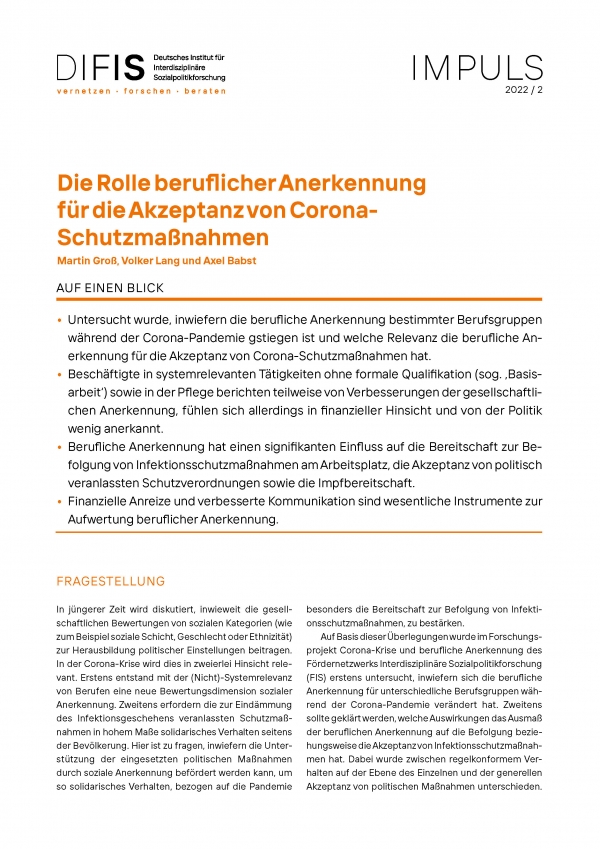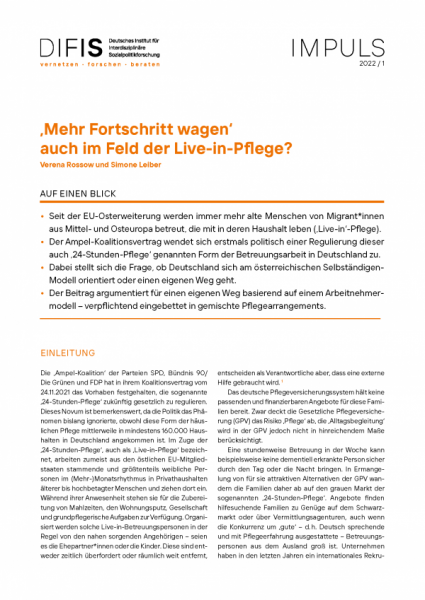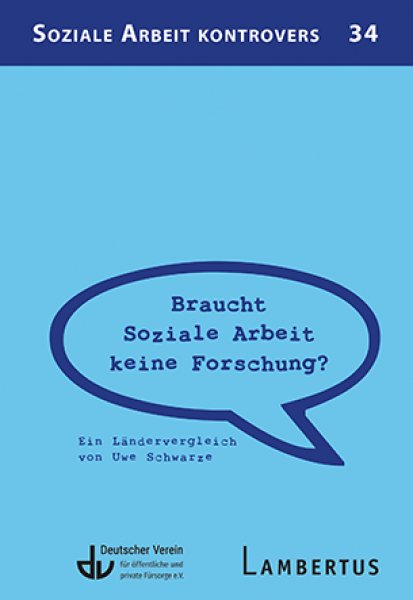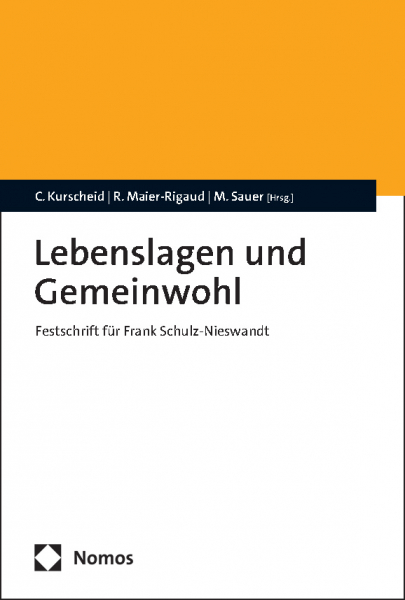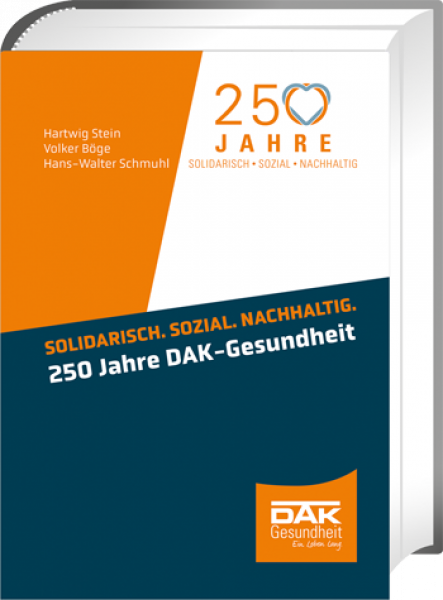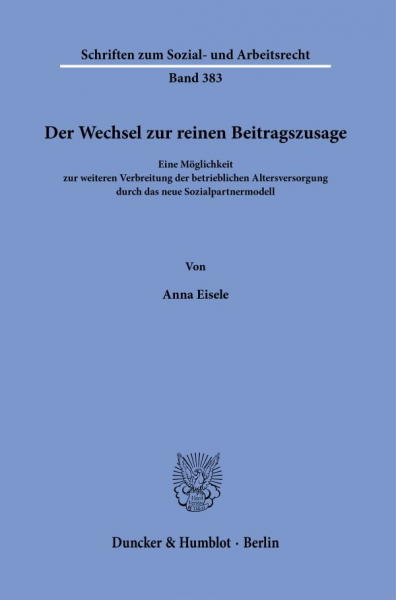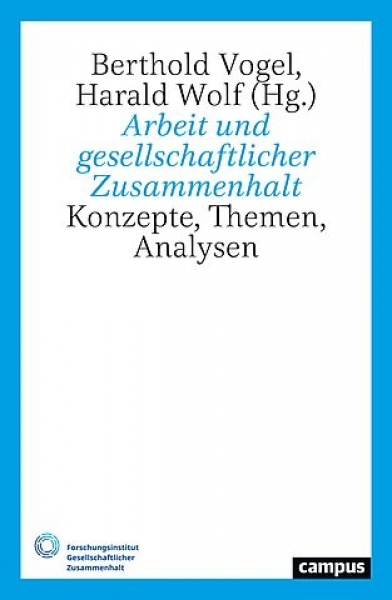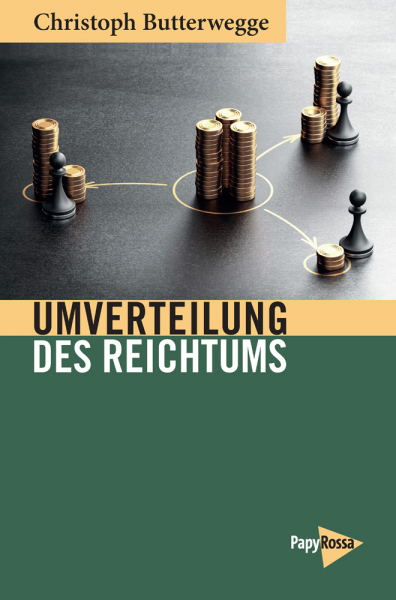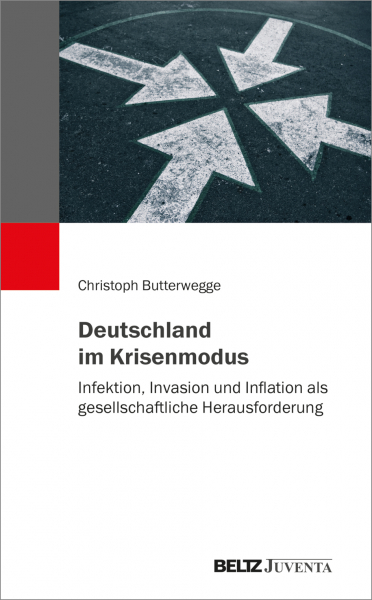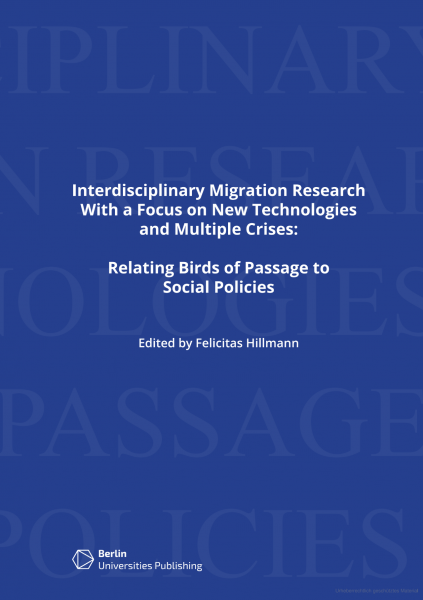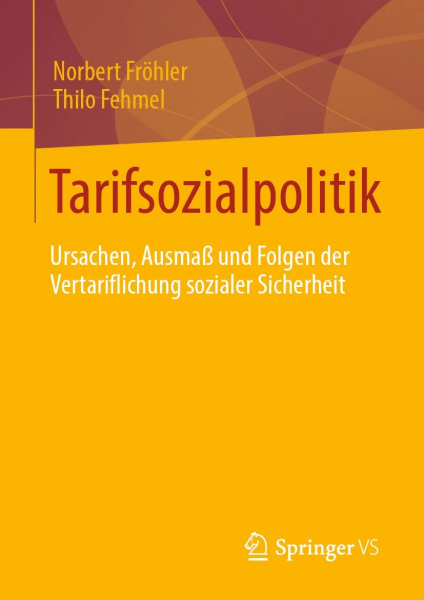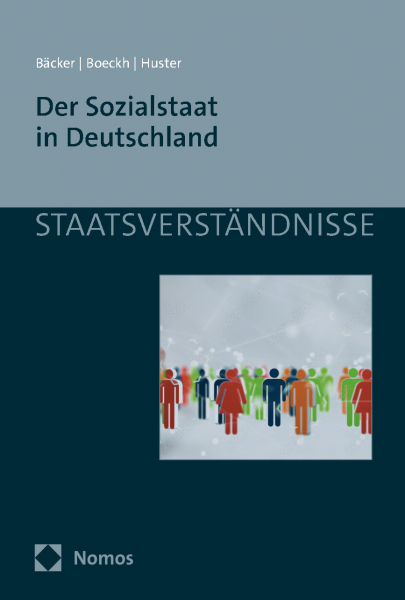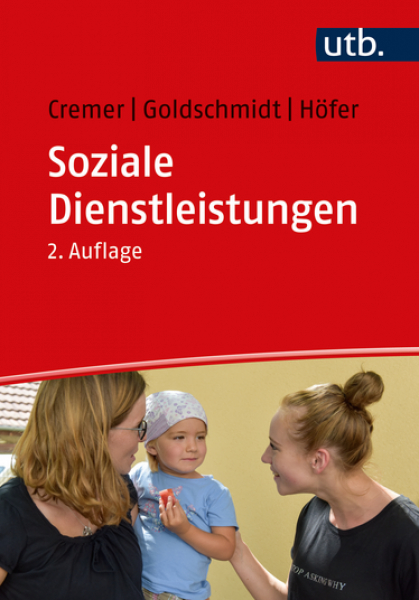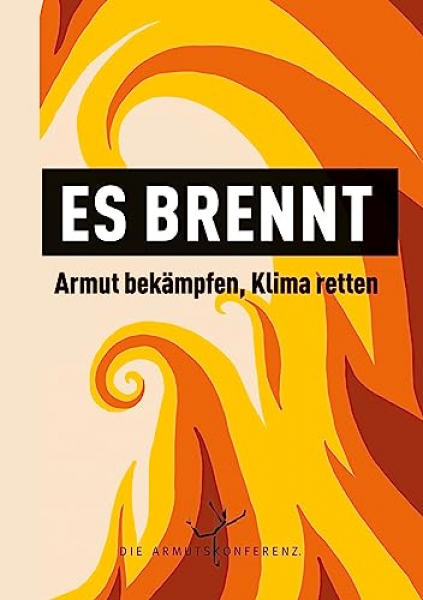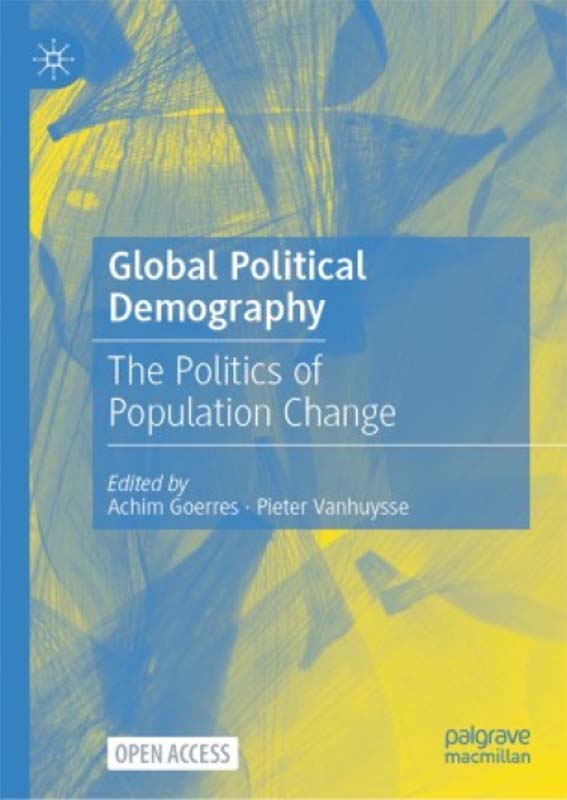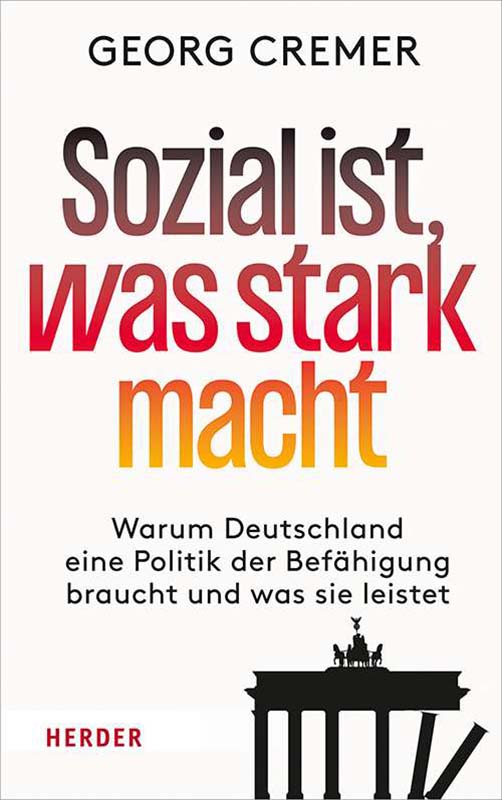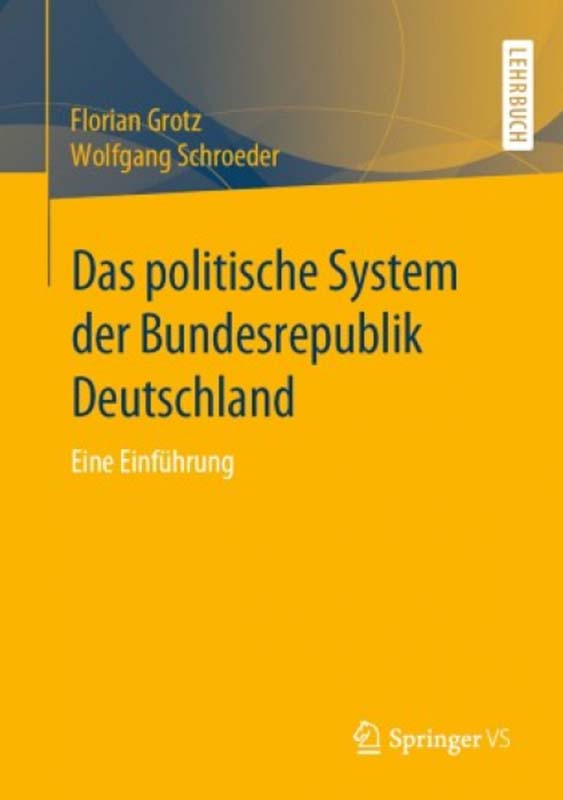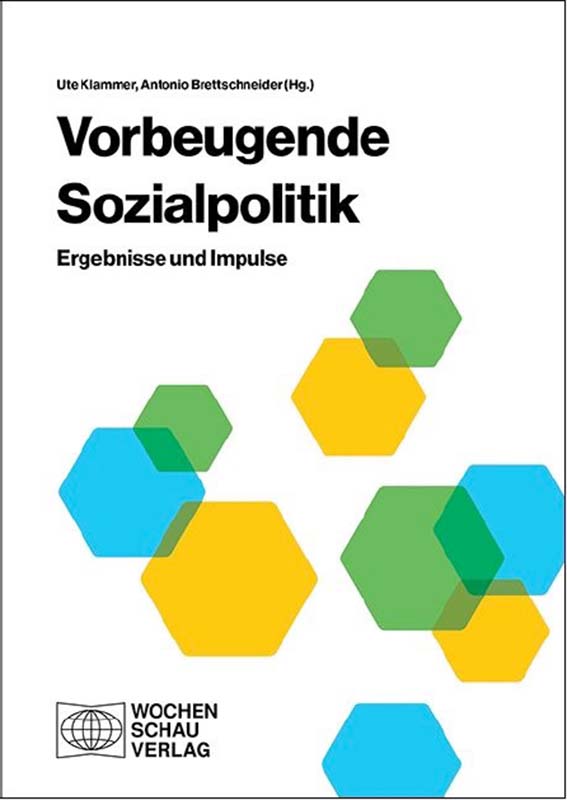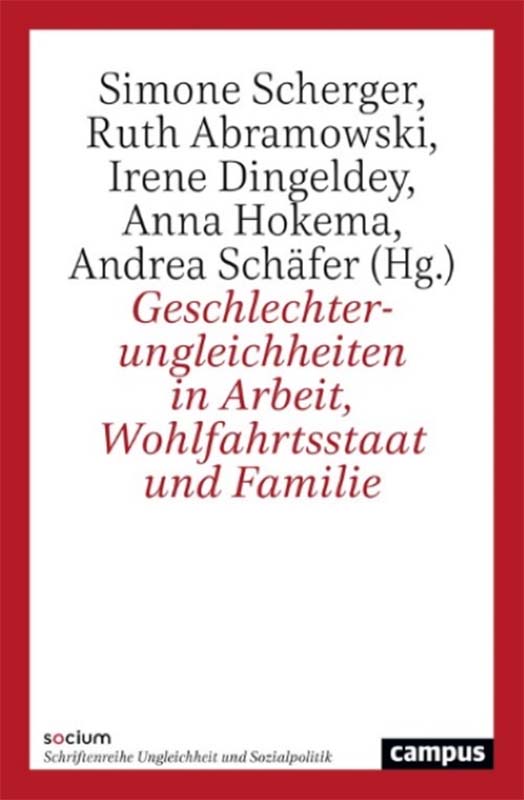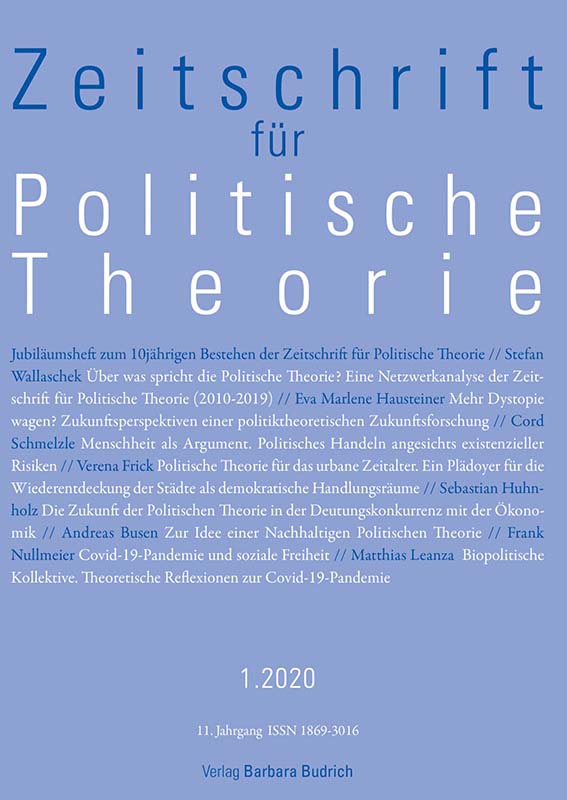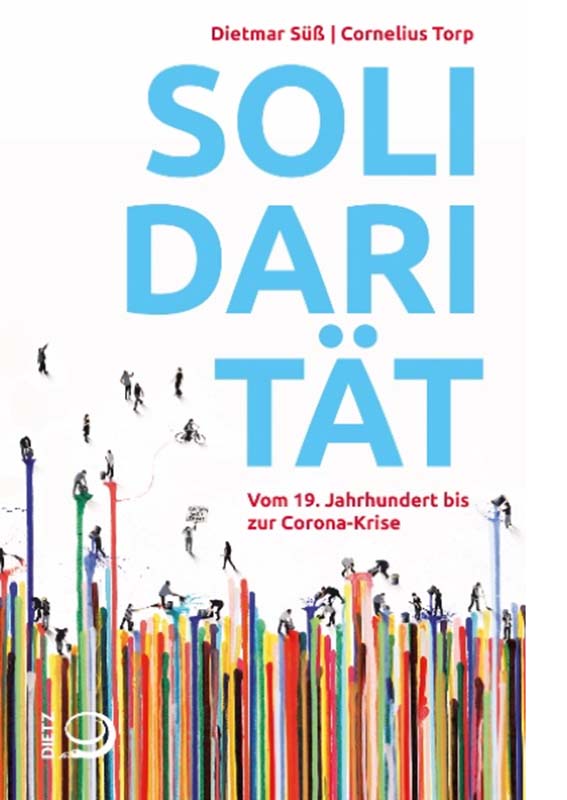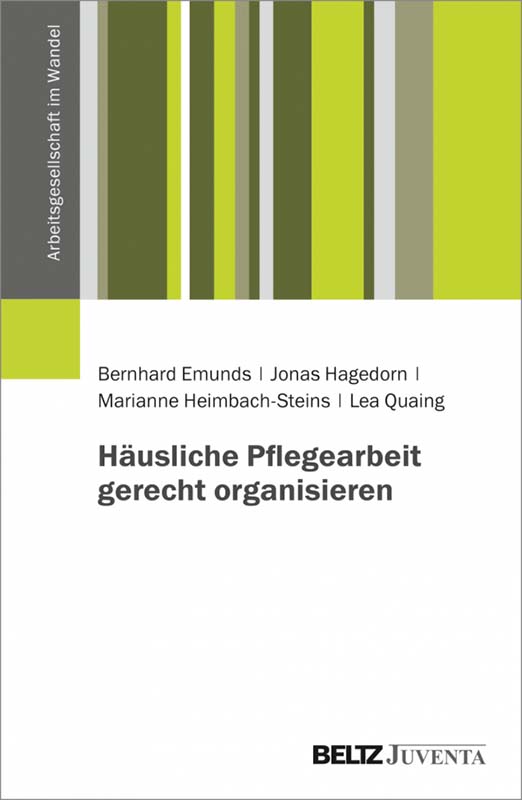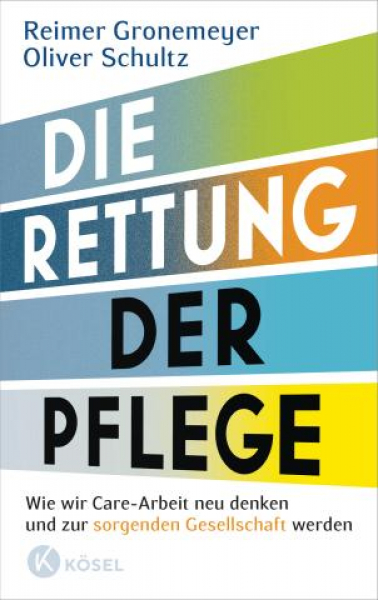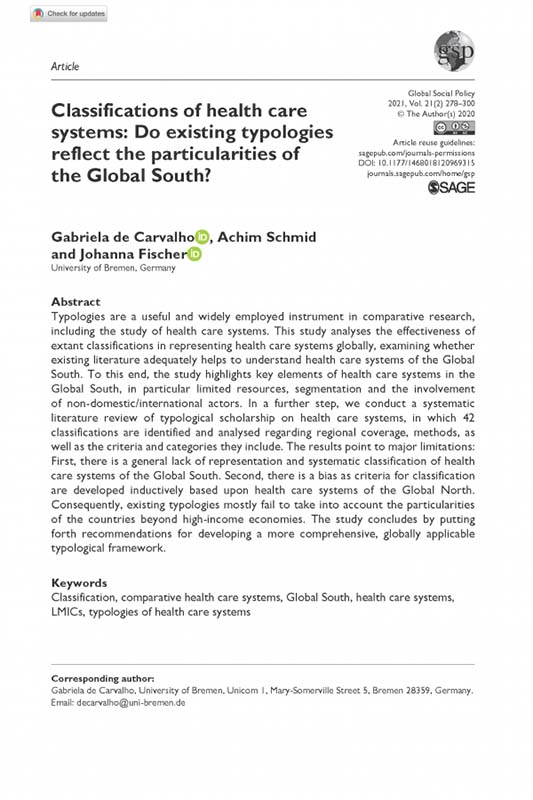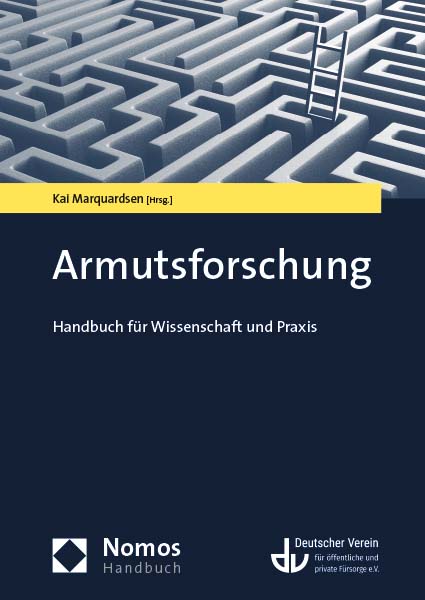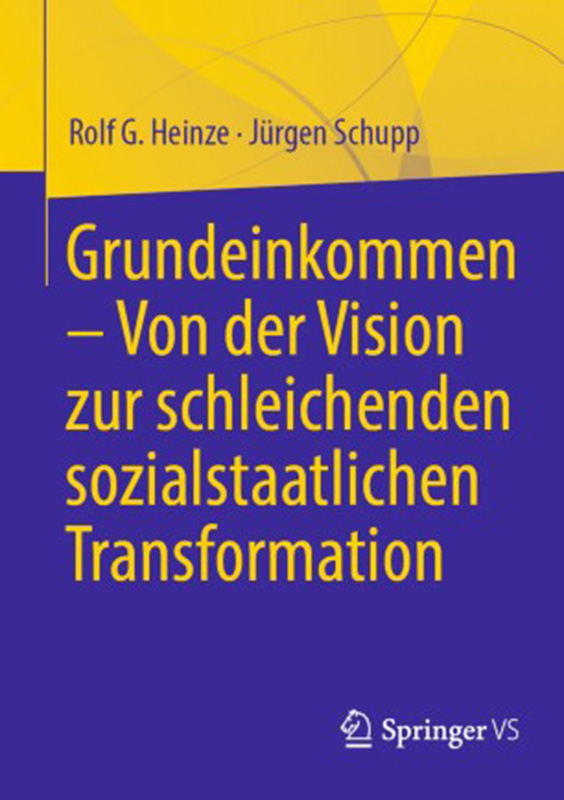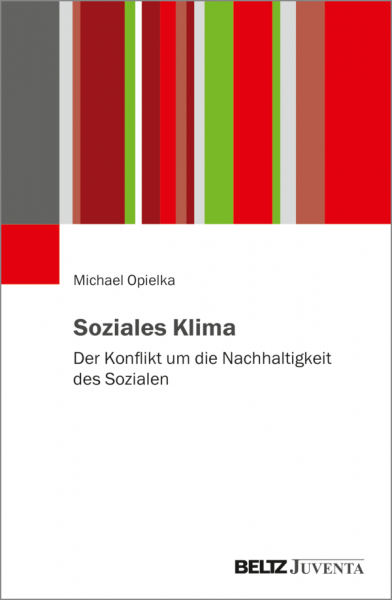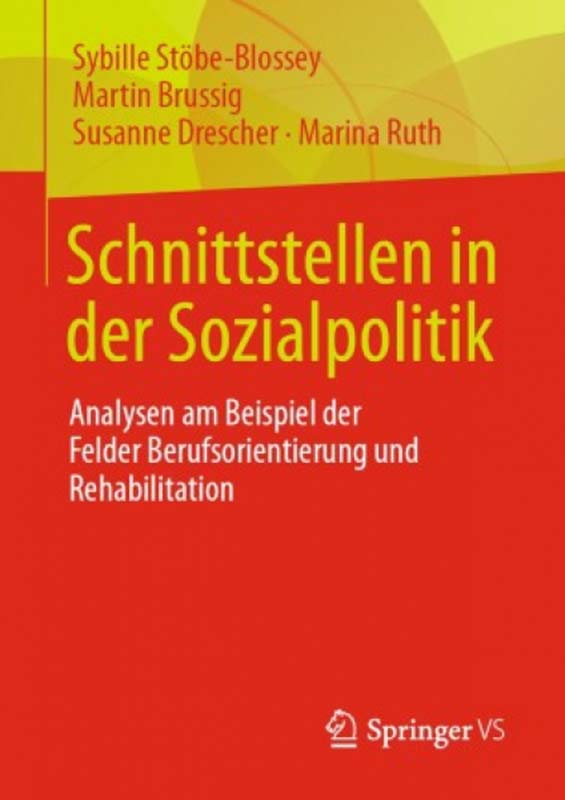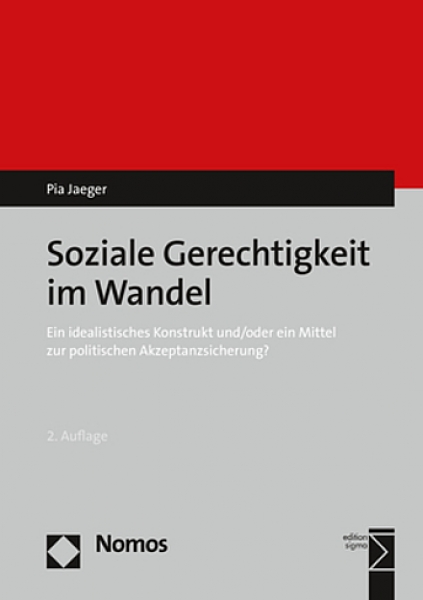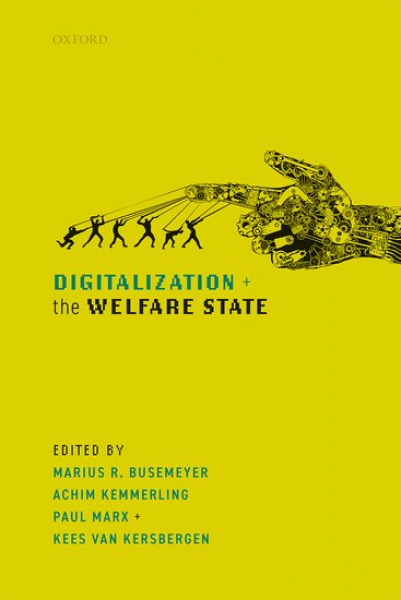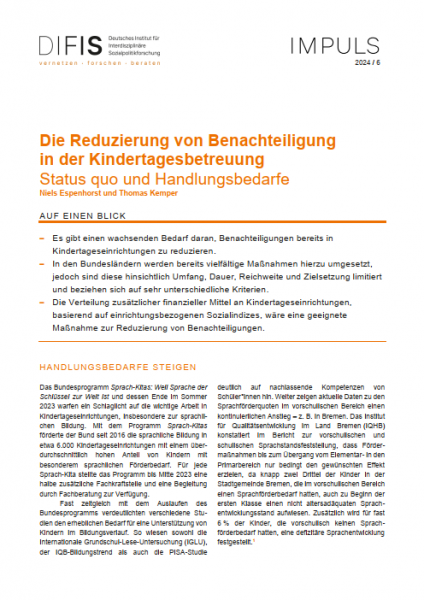
Niels Espenhorst, Thomas Kemper:
DIFIS-Impuls 2024/6: Die Reduzierung von Benachteiligung in der Kindertagesbetreuung. Status quo und Handlungsbedarfe
weiterlesen
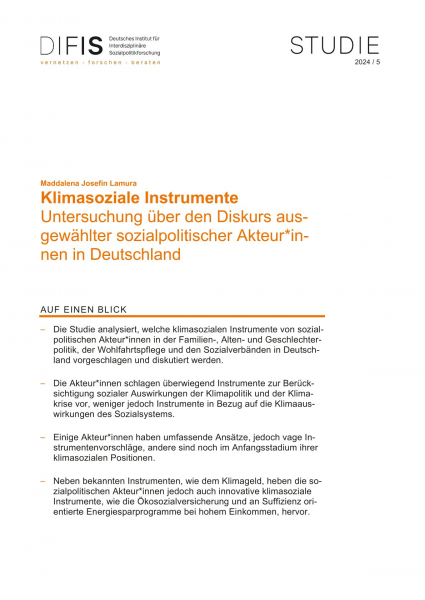
Maddalena Josefin Lamura:
DIFIS-Studie 2024/5: Klimasoziale Instrumente. Untersuchung über den Diskurs ausgewählter sozialpolitischer Akteur*innen in Deutschland
weiterlesen
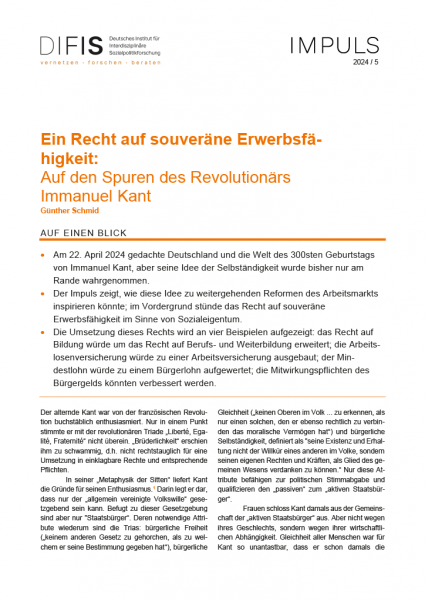
Günther Schmid:
DIFIS-Impuls 2024/5: Ein Recht auf souveräne Erwerbsfähigkeit: Auf den Spuren des Revolutionärs Immanuel Kant
weiterlesen
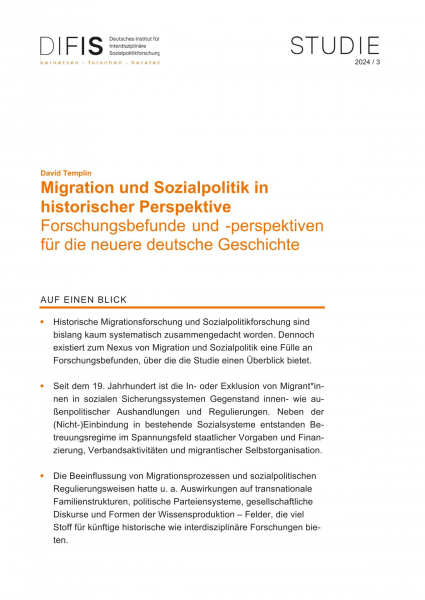
David Templin:
DIFIS-Studie 2024/4: Migration und Sozialpolitik in historischer Perspektive Forschungsbefunde und -perspektiven für die neuere deutsche Geschichte
weiterlesen
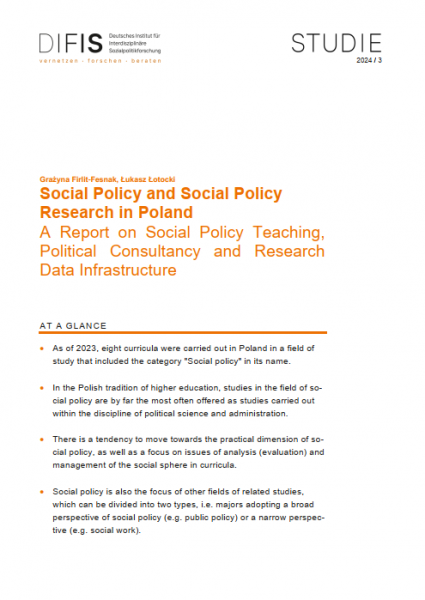
Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki:
DIFIS-Studie 2024/3: Social Policy and Social Policy Research in Poland. A Report on Social Policy Teaching, Political Consultancy and Research Data Infrastructure
weiterlesen
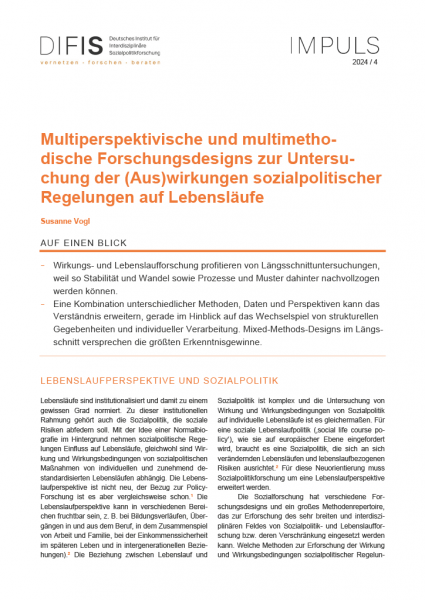
Susanne Vogl:
DIFIS-Impuls 2024/4: Multiperspektivische und multimethodische Forschungsdesigns zur Untersuchung der (Aus)wirkungen sozialpolitischer Regelungen auf Lebensläufe
weiterlesen
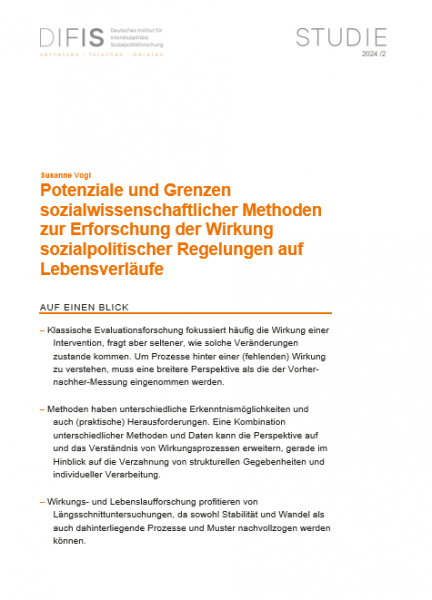
Susanne Vogl:
DIFIS-Studie 2024/2: Potenziale und Grenzen sozialwissenschaftlicher Methoden zur Erforschung der Wirkung sozialpolitischer Regelungen auf Lebensverläufe
weiterlesen
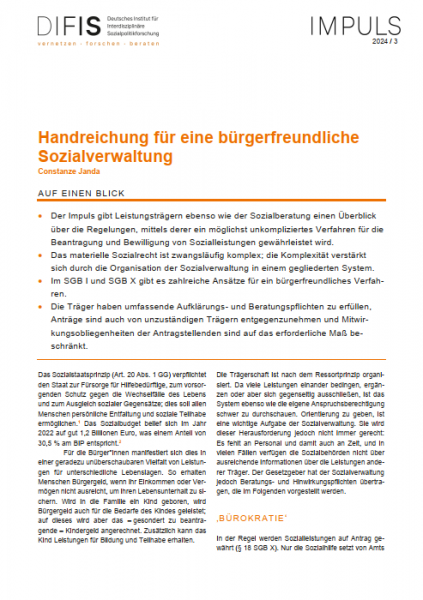
Constanze Janda:
DIFIS-Impuls 2024/3: Handreichung für eine bürgerfreundliche Sozialverwaltung
weiterlesen
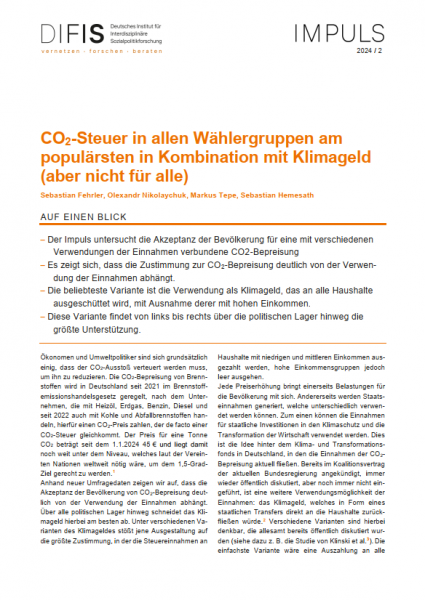
Sebastian Fehrler, Olexandr Nikolaychuk, Markus Tepe, Sebastian Hemesath:
DIFIS-Impuls 2024/2: CO2-Steuer in allen Wählergruppen am populärsten in Kombination mit Klimageld (aber nicht für alle)
weiterlesen
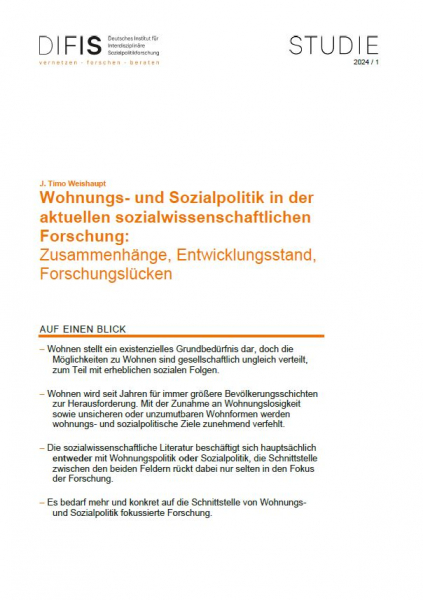
J. Timo Weishaupt:
DIFIS-Studie 2024/1: Wohnungs- und Sozialpolitik in der aktuellen sozialwissenschaftlichen Forschung
weiterlesen
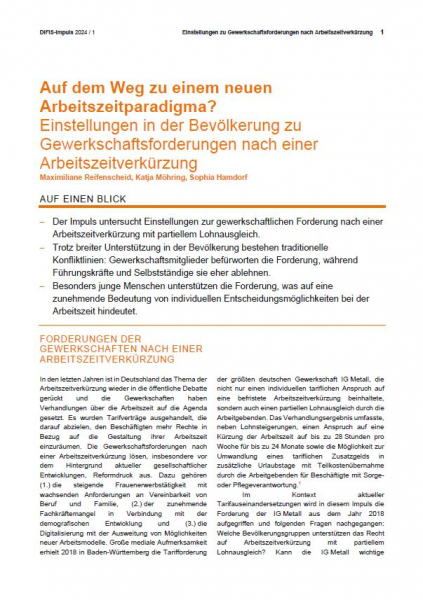
Maximiliane Reifenscheid, Katja Möhring, Sophia Hamdorf:
DIFIS-Impuls 2024/1: Auf dem Weg zu einem neuen Arbeitszeitparadigma?
weiterlesen
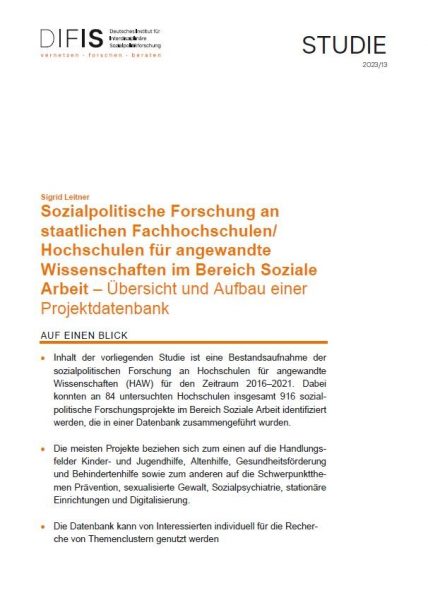
Sigrid Leitner:
DIFIS-Studie 2023/13: Sozialpolitische Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Bereich Soziale Arbeit
weiterlesen
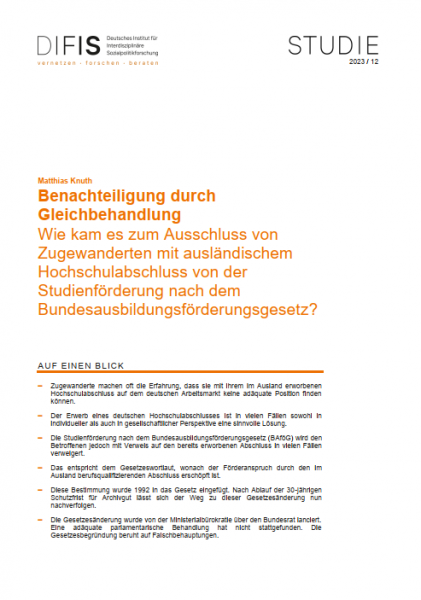
Matthias Knuth:
DIFIS-Studie 2023/12: Benachteiligung durch Gleichbehandlung. Wie kam es zum Ausschluss von Zugewanderten mit ausländischem Hochschulabschluss von der Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz?
weiterlesen
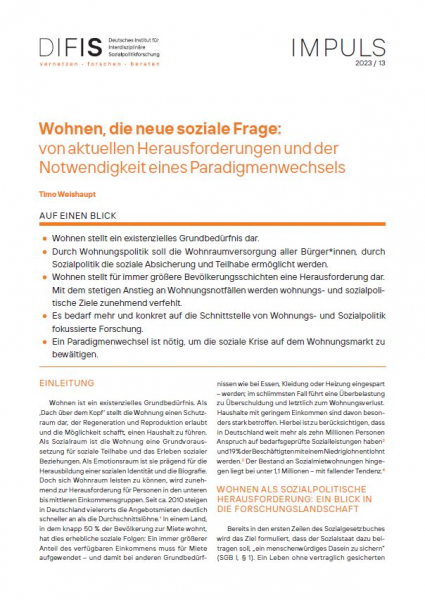
J. Timo Weishaupt:
DIFIS-Impuls 2023/12: Wohnen, die neue soziale Frage. Von aktuellen Herausforderungen und der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels
weiterlesen
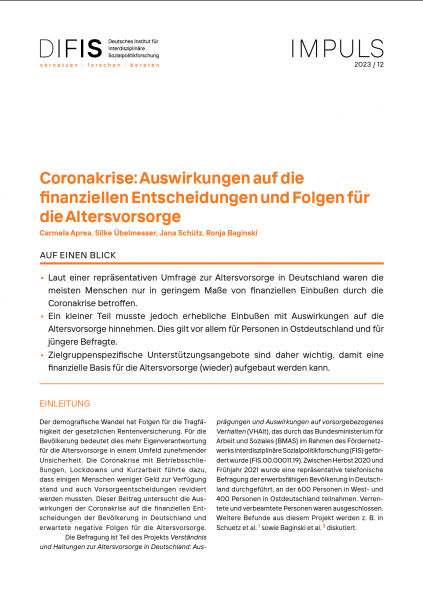
Silke Übelmesser, Jana Schütz, Ronja Baginski, Carmela Aprea:
DIFIS-Impuls 2023/11: Coronakrise: Auswirkungen auf die finanziellen Entscheidungen und Folgen für die Altersvorsorge
weiterlesen
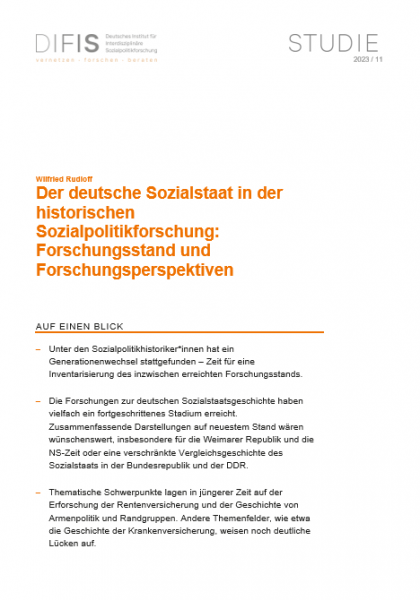
Wilfried Rudloff:
DIFIS-Studie 2023/11: Der deutsche Sozialstaat in der historischen Sozialpolitikforschung: Forschungsstand und -perspektiven
weiterlesen
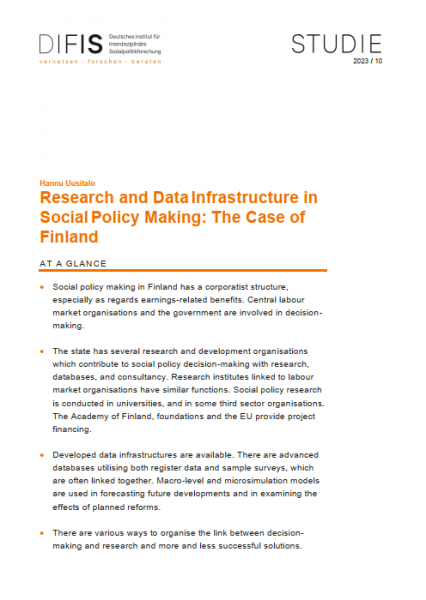
Hannu Uusitalo:
DIFIS-Studie 2023/10: Research and Data Infrastructure in Social Policy Making: The Case of Finland
weiterlesen
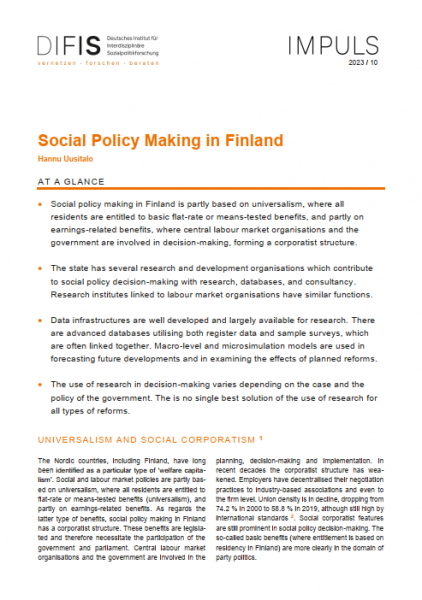
Hannu Uusitalo:
DIFIS-Impuls 2023/10: Social Policy Making in Finland
weiterlesen
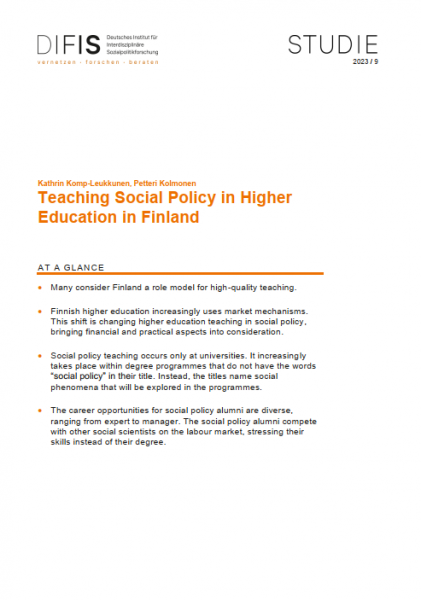
Kathrin Komp-Leukkunen, Petteri Kolmonen:
DIFIS-Studie 2023/9: Teaching Social Policy in Higher Education in Finland
weiterlesen
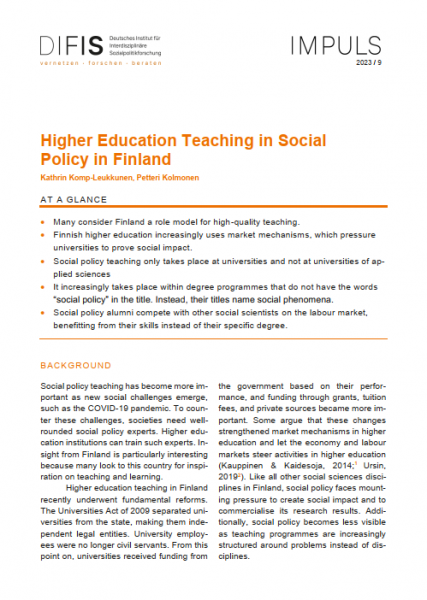
Kathrin Komp-Leukkunen, Petteri Kolmonen:
DIFIS-Impuls 2023/9: Higher Education Teaching in Social Policy in Finland
weiterlesen
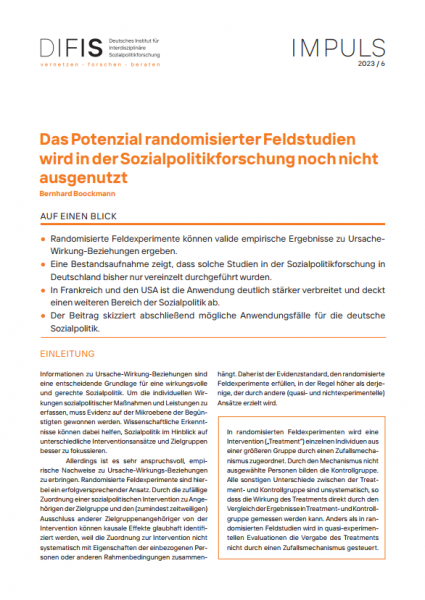
Yvette Bodry, Bernhard Boockmann, Philipp Kugler und Verena von Zitzewitz:
DIFIS-Impuls 2023/8: Das Potenzial randomisierter Feldstudien wird in der Sozialpolitikforschung noch nicht ausgenutzt
weiterlesen
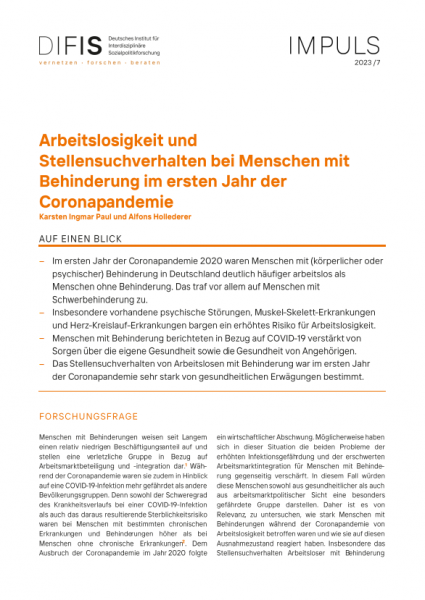
Karsten Ingmar Paul und Alfons Hollederer:
DIFIS-Impuls 2023/7: Arbeitslosigkeit und Stellensuchverhalten bei Menschen mit Behinderung im ersten Jahr der Coronapandemie
weiterlesen
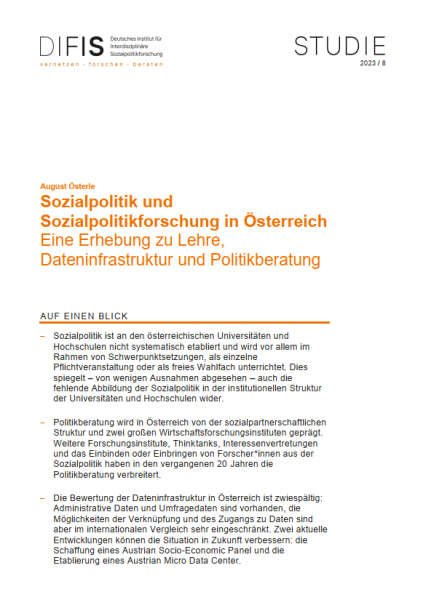
August Österle:
DIFIS-Studie 2023/8: Sozialpolitik und Sozialpolitikforschung in Österreich. Eine Erhebung zu Lehre, Dateninfrastruktur und Politikberatung
weiterlesen
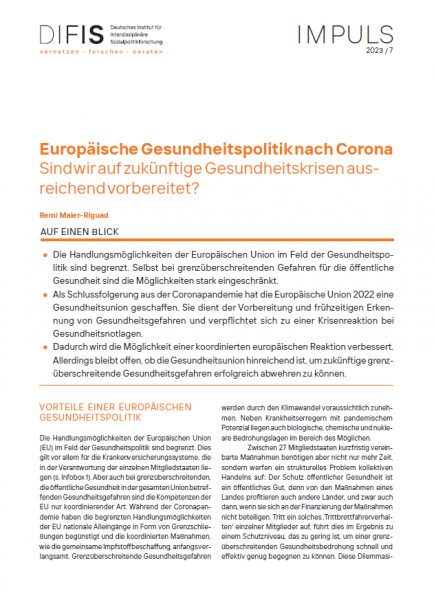
Remi Maier-Rigaud:
DIFIS-Impuls 2023/6: Europäische Gesundheitspolitik nach Corona
weiterlesen
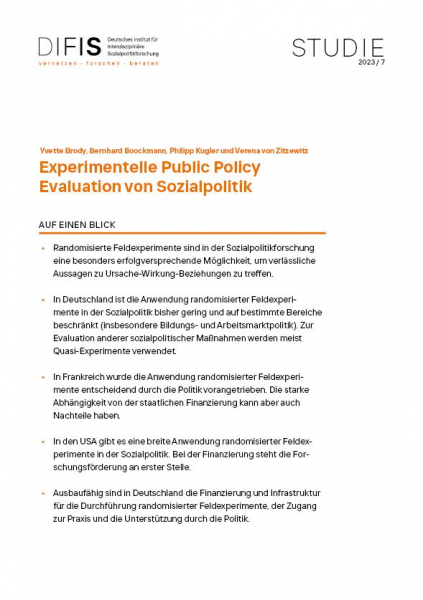
Yvette Bodry, Bernhard Boockmann, Philipp Kugler und Verena von Zitzewitz:
DIFIS-Studie 2023/7: Experimentelle Public Policy Evaluation von Sozialpolitik
weiterlesen
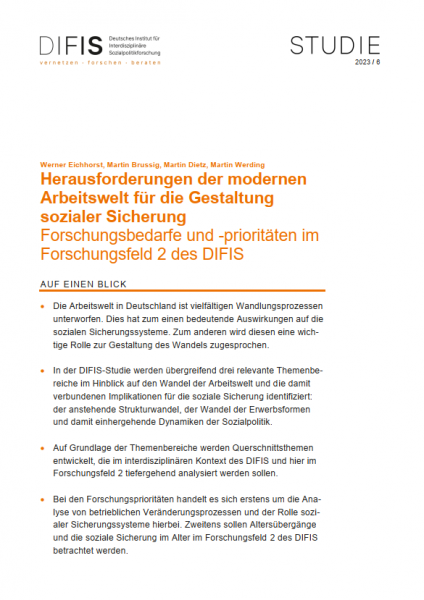
Werner Eichhorst, Martin Brussig, Martin Dietz, Martin Werding:
DIFIS-Studie 2023/6: Herausforderungen der modernen Arbeitswelt für die Gestaltung sozialer Sicherung
weiterlesen
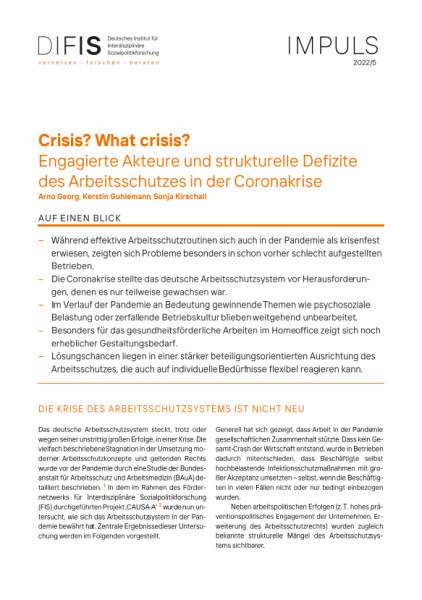
Arno Georg, Kerstin Guhlemann, Sonja Kirschall:
DIFIS-Impuls 2023/5: Crisis? What crisis? Engagierte Akteure und strukturelle Defizite des Arbeitsschutzes in der Coronakrise
weiterlesen
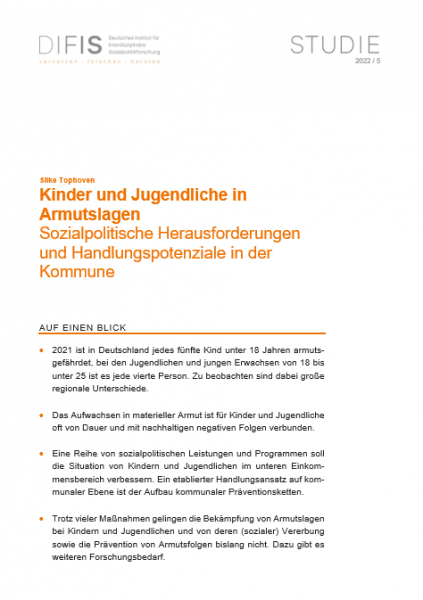
Silke Tophoven:
DIFIS-Studie 2023/5: Kinder und Jugendliche in Armutslagen. Sozialpolitische Herausforderungen in der Kommune
weiterlesen
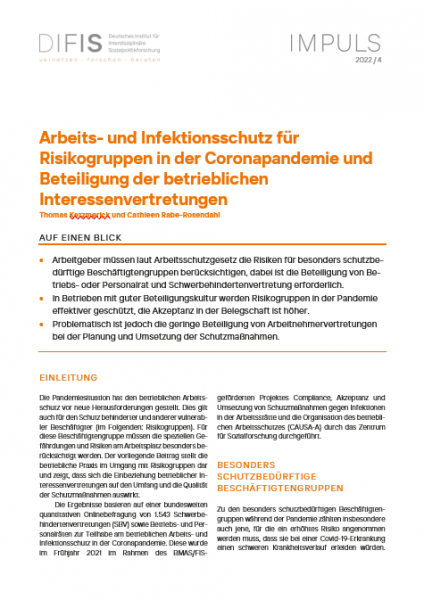
Thomas Ketzmerick, Cathleen Rabe-Rosendahl:
DIFIS-Impuls 2023/4: Arbeits- und Infektionsschutz für Risikogruppen in der Coronapandemie
weiterlesen
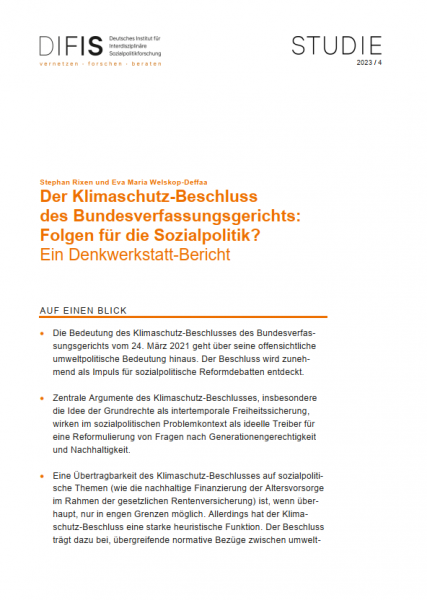
Stephan Rixen, Eva Maria Welskop-Deffaa:
DIFIS-Studie 2023/4: Der Klimaschutz-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts: Folgen für die Sozialpolitik?
weiterlesen
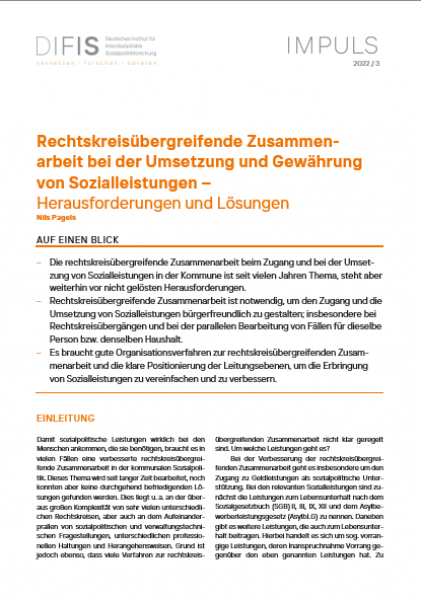
Nils Pagels:
DIFIS-Impuls 2023/3: Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit bei der Umsetzung und Gewährung von Sozialleistungen
weiterlesen
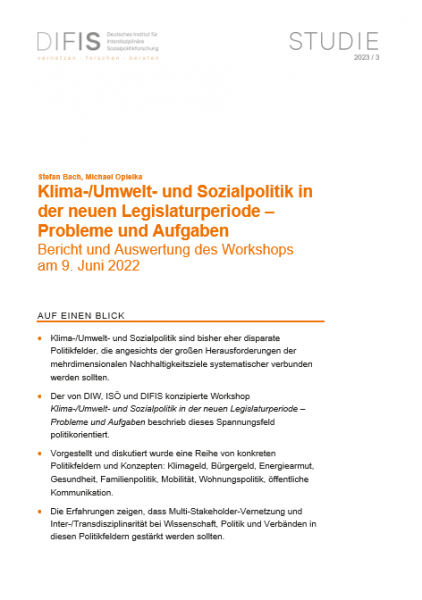
Stefan Bach und Michael Opielka:
DIFIS-Studie 2023/3: Klima-/Umwelt- und Sozialpolitik in der neuen Legislaturperiode – Probleme und Aufgaben
weiterlesen

Tanja Klenk:
DIFIS-Impuls 2023/2: Digitalisierung im Bereich sozialer Dienstleistungen
weiterlesen
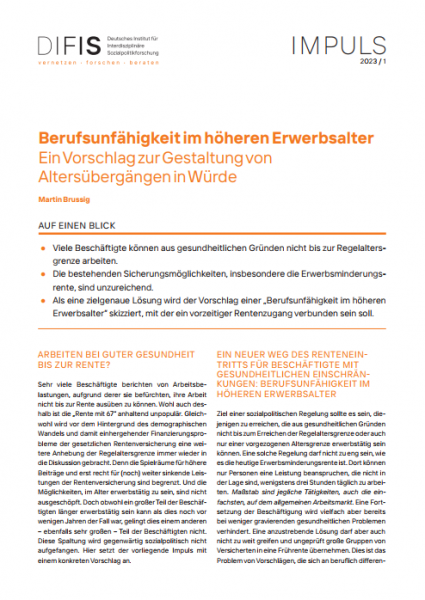
Martin Brussig:
DIFIS-Impuls 2023/1: Berufsunfähigkeit im höheren Erwerbsalter. Ein Vorschlag zur Gestaltung von Altersübergängen in Würde
weiterlesen
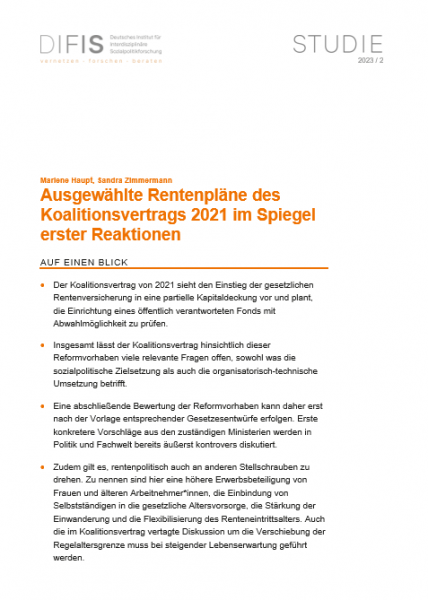
Marlene Haupt und Sandra Zimmermann:
DIFIS-Studie 2023/2: Ausgewählte Rentenpläne des Koalitionsvertrags 2021 im Spiegel erster Reaktionen
weiterlesen
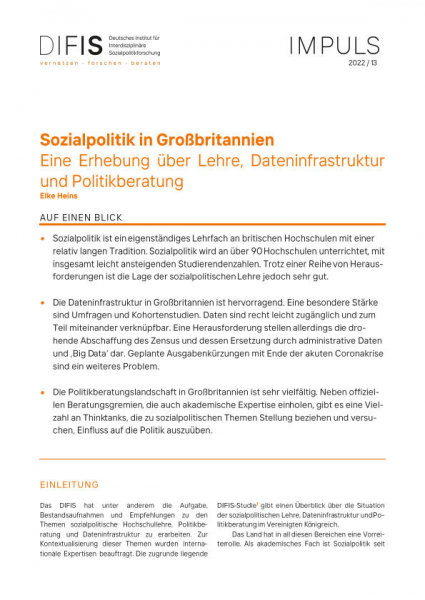
Elke Heins:
DIFIS-Impuls 2022/13: Sozialpolitik und Sozialpolitikforschung in Großbritannien: Lehre, Dateninfrastruktur und Politikberatung
weiterlesen
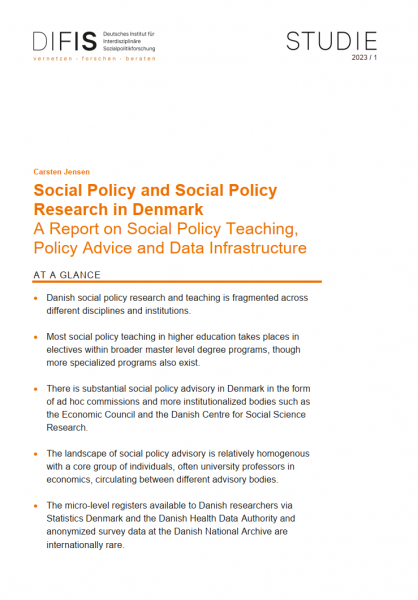
Carsten Jensen:
DIFIS-Studie 2023/1: Social Policy and Social Policy Research in Denmark
weiterlesen
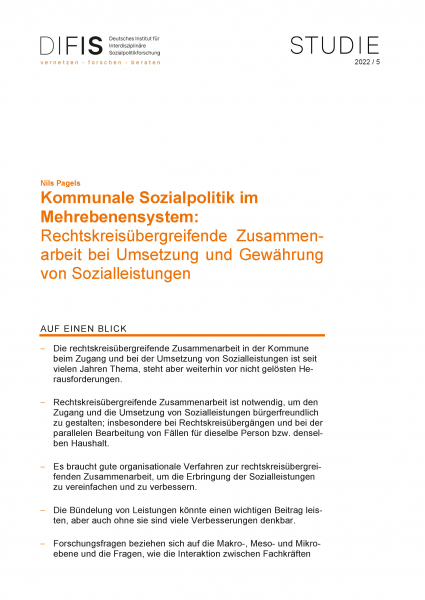
Nils Pagels:
DIFIS-Studie 2022/6: Kommunale Sozialpolitik im Mehrebenensystem
weiterlesen
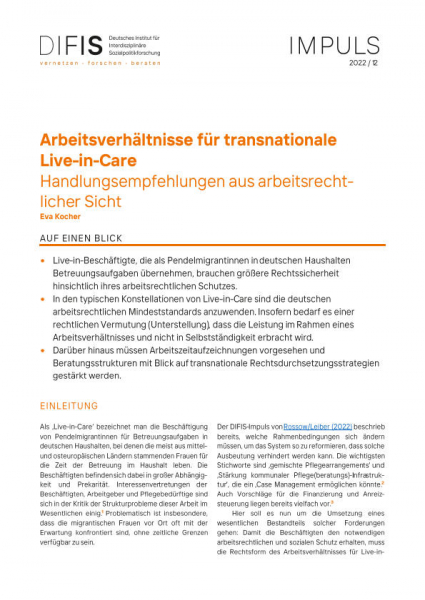
Eva Kocher:
DIFIS-Impuls 2022/12: Arbeitsverhältnisse für transnationale Live-in-Care. Handlungsempfehlungen aus arbeitsrechtlicher Sicht
weiterlesen
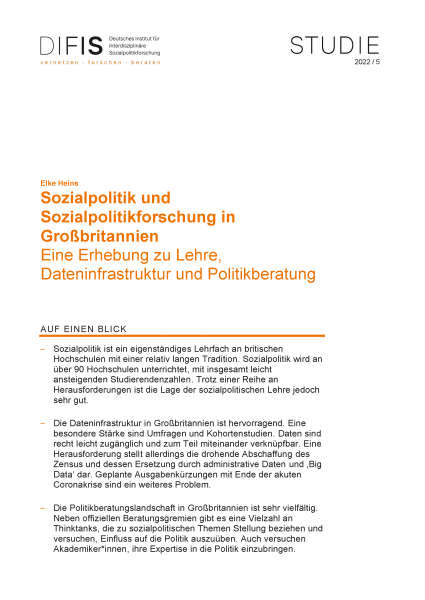
Elke Heins:
DIFIS-Studie 2022/5: Sozialpolitik und Sozialpolitikforschung in Großbritannien: Lehre, Dateninfrastruktur und Politikberatung
weiterlesen
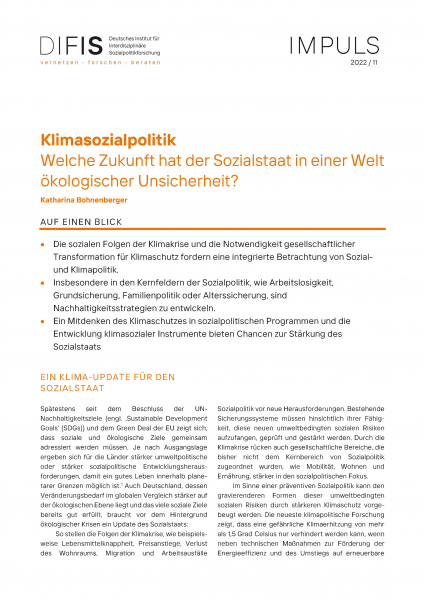
Katharina Bohnenberger:
DIFIS-Impuls 2022/11: Klimasozialpolitik Welche Zukunft hat der Sozialstaat in einer Welt ökologischer Unsicherheit?
weiterlesen
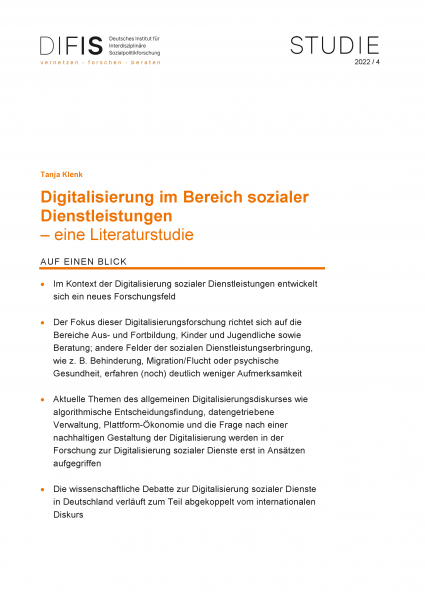
Tanja Klenk:
DIFIS-Studie 2022/4: Digitalisierung im Bereich sozialer Dienstleistungen – eine Literaturstudie
weiterlesen
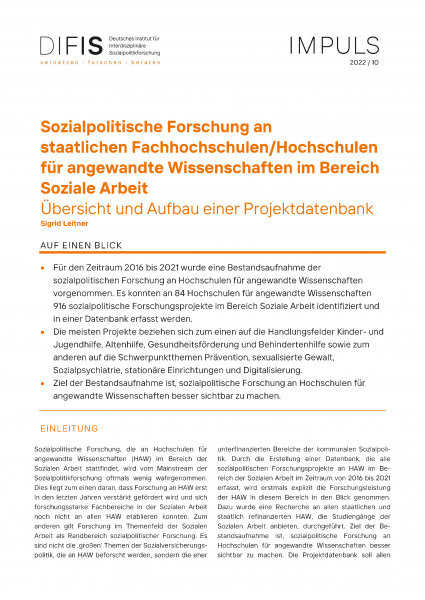
Sigrid Leitner:
DIFIS-Impuls 2022/10: Sozialpolitische Forschung an staatlichen Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften
weiterlesen
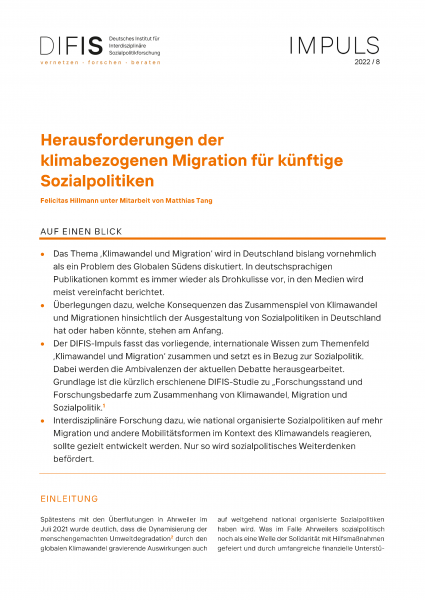
Felicitas Hillmann:
DIFIS-Impuls 2022/8: Herausforderungen der klimabezogenen Migration für künftige Sozialpolitiken
weiterlesen
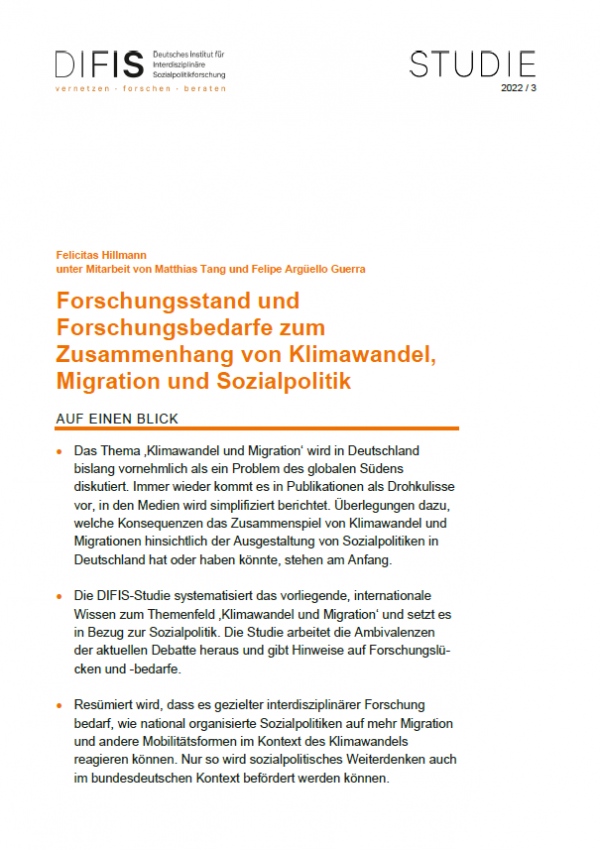
Felicitas Hillmann unter Mitarbeit von Matthias Tang und Felipe Argüello Guerra:
DIFIS-Studie 2022/3: Forschungsstand und Forschungsbedarfe zum Zusammenhang von Klimawandel, Migration und Sozialpolitik
weiterlesen
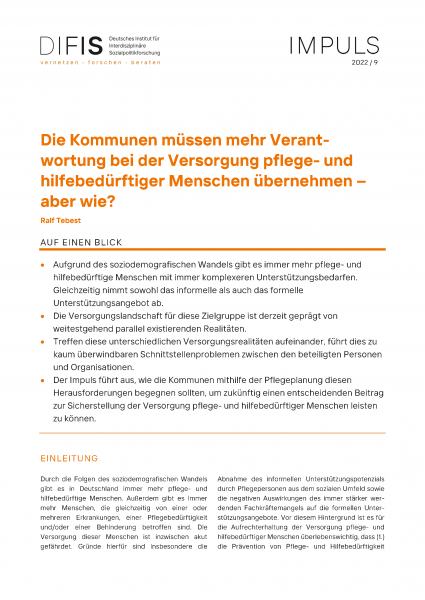
Ralf Tebest:
DIFIS-Impuls 2022/9: Die Kommunen müssen mehr Verantwortung bei der Versorgung pflege- und hilfebedürftiger Menschen übernehmen – aber wie?
weiterlesen
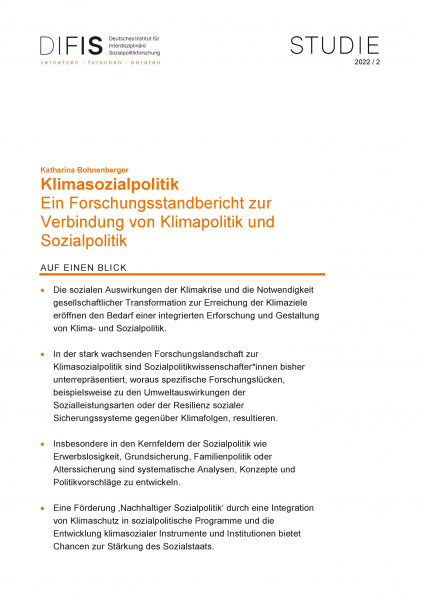
Katharina Bohnenberger:
DIFIS-Studie 2022/2: Klimasozialpolitik. Ein Forschungsstandbericht zur Verbindung von Klimapolitik und Sozialpolitik
weiterlesen
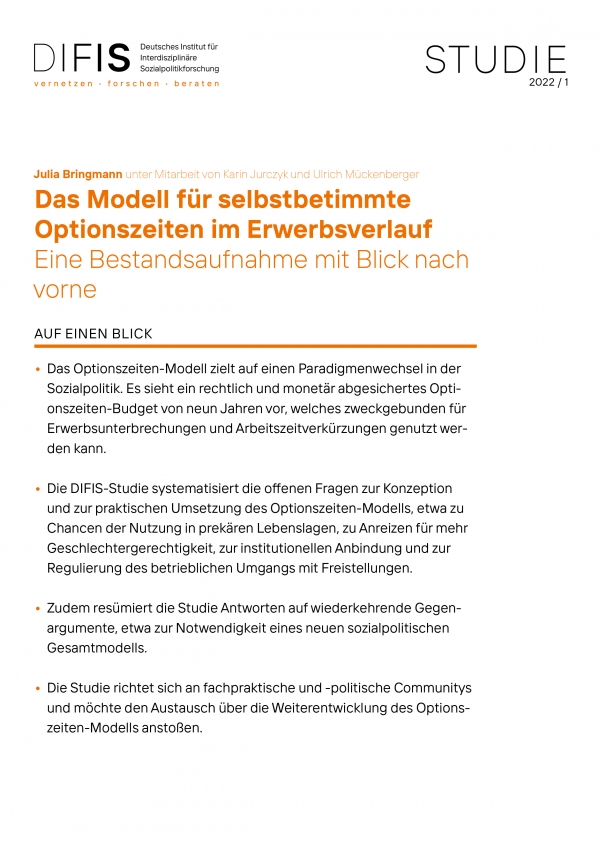
Julia Bringmann:
DIFIS-Studie 2022/1: Das Modell für selbstbestimmte Optionszeiten im Erwerbsverlauf. Eine Bestandsaufnahme mit Blick nach vorne
weiterlesen
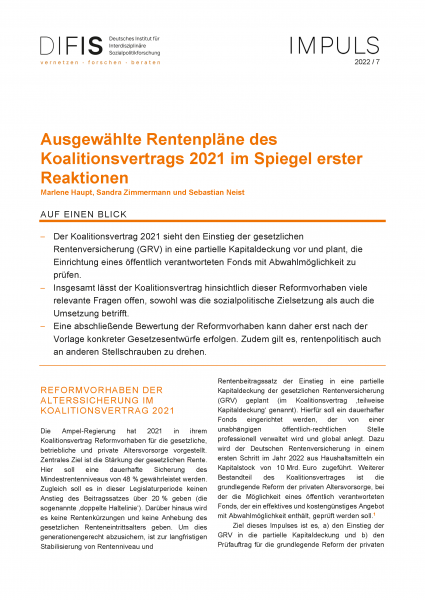
Marlene Haupt, Sandra Zimmermann und Sebastian Neist:
DIFIS-Impuls 2022/7: Ausgewählte Rentenpläne des Koalitionsvertrags 2021 im Spiegel erster Reaktionen
weiterlesen
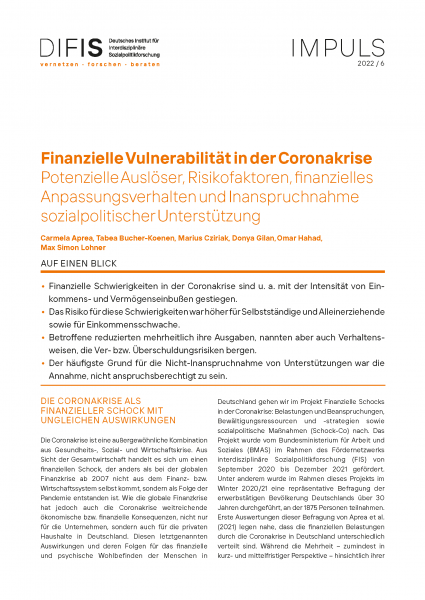
Carmela Aprea, Tabea Bucher-Koenen, Marius Cziriak, Donya Gilan, Omar Hahad, Max Simon Lohner:
DIFIS-Impuls 2022/6: Finanzielle Vulnerabilität in der Coronakrise
weiterlesen
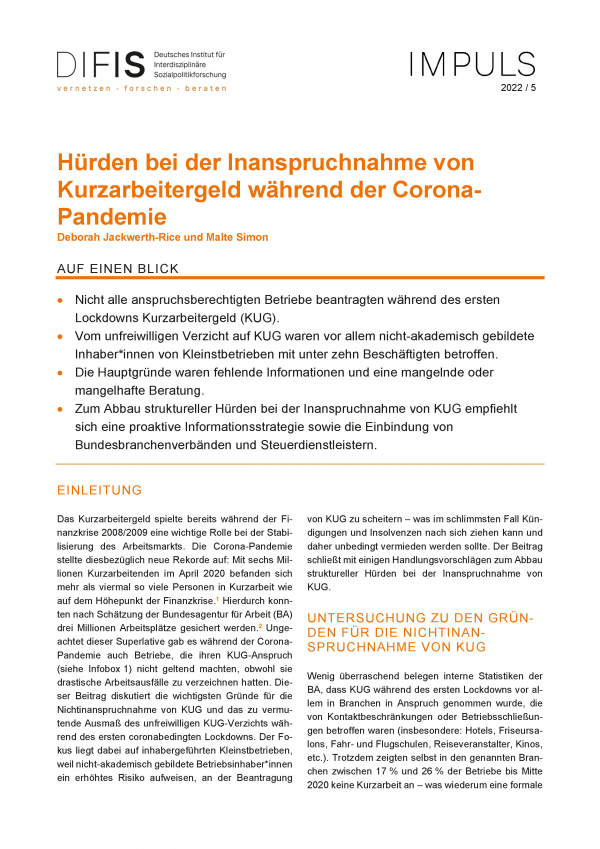
Deborah Jackwerth-Rice und Malte Simon:
DIFIS-Impuls 2022/5: Hürden bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld während der Corona-Pandemie
weiterlesen
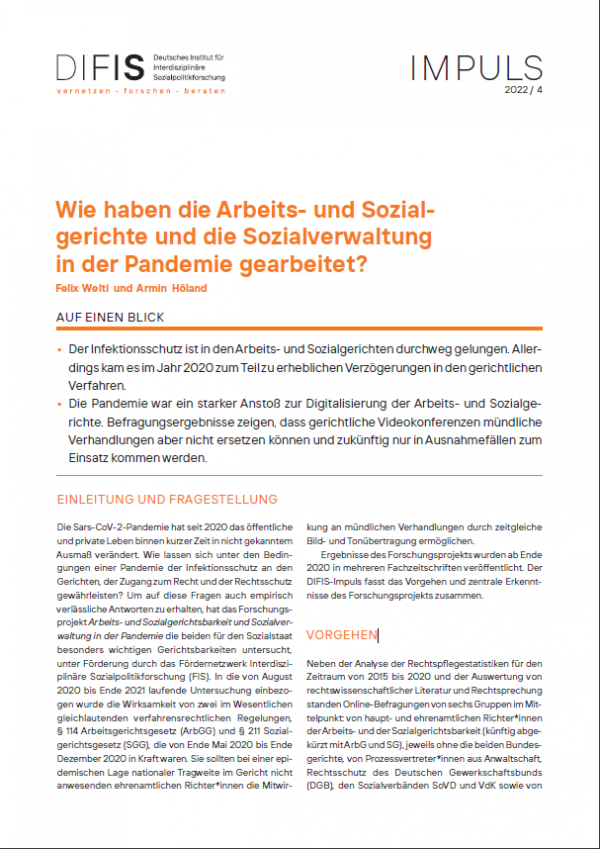
Felix Welti und Armin Höland
DIFIS-Impuls 2022/4: Wie haben die Arbeits- und Sozialgerichte und die Sozialverwaltung in der Pandemie gearbeitet?
weiterlesen
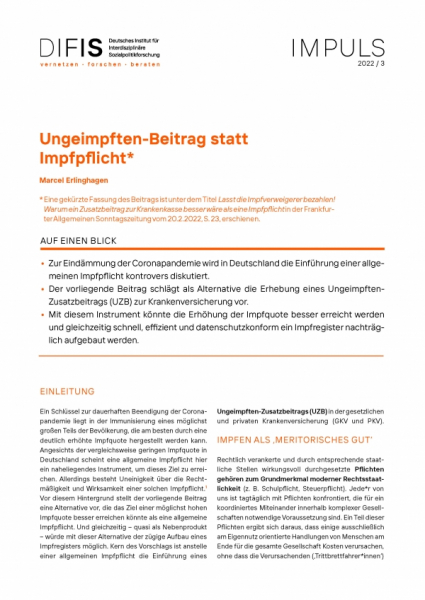
Marcel Erlinghagen:
DIFIS-Impuls 2022/3: Ungeimpften-Beitrag statt Impfpflicht
weiterlesen
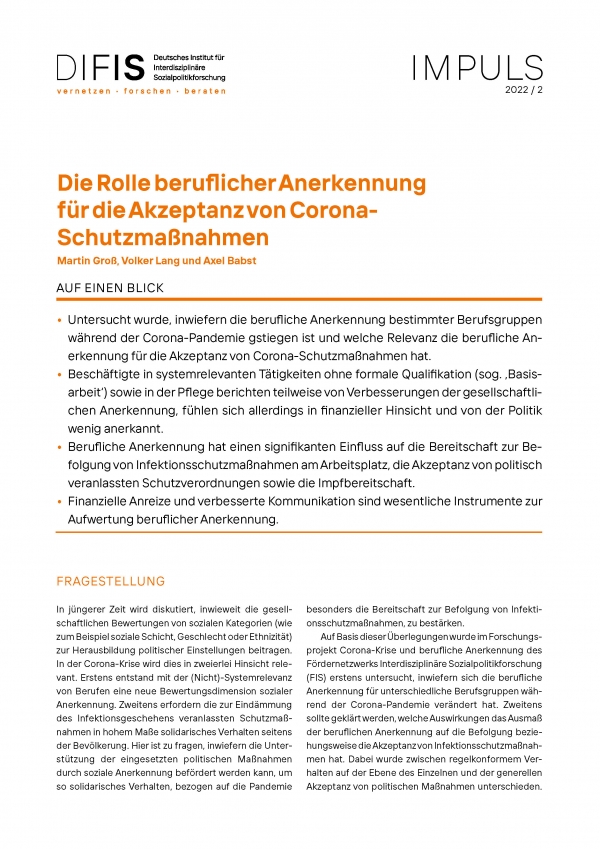
Martin Groß, Volker Lang und Axel Babst:
DIFIS-Impuls 2022/2: Die Rolle beruflicher Anerkennung für die Akzeptanz von Corona- Schutzmaßnahmen
weiterlesen
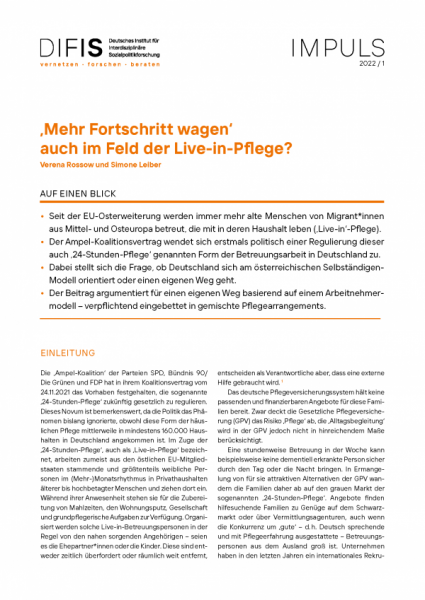
Verena Rossow und Simone Leiber:
DIFIS-Impuls 2022/1: 'Mehr Fortschritt wagen' auch im Feld der Live-in-Pflege?
weiterlesen